Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Smart Organisation - die Nutzung des ‘collective Mind’ der Mitarbeiter macht Unternehmen intelligenter
Unternehmen finden sich vermehrt in einem komplexen Umfeld, in denen die vorhersehbaren Entwicklungen abnehmen. Wie ist es möglich, als Organisation schnell zu reagieren um erforderliche Anpassungen an veränderte Situationen vorzunehmen? Dr. Birgit Feldhusen, Gründerin Organizing Future und Lektorin für Organisationsentwicklung, FH der Wirtschaftskammer Wien, rät Unternehmen sich ihres ‘Collective Mind’ bewusst zu werden und diese Qualität zu kultivieren.
Dass der Zugriff auf ein gut funktionierendes kollektives Bewusstsein auch Unternehmenserfolg bringt, beweist eine MIT Studie, die auch von Google weiterentwickelt wurde. In rein über auf Inhalten aufgebauten Organisationen entsteht kein ‘Collective Mind’. Eine Organisation, die durch Regeln und Ansagen aufgebaut ist, ist ‘dumm’. ‘Dumm’ deshalb, weil sie nur in dieser einen Situation handeln kann. Sobald sich die Situation verändert, weiss sie nicht mehr was sie tun soll. Bei einem ausgeweiteten ‘Collective Mind’ können sich die Mitarbeiter in jeder Situation verändern und die angemessene Haltung annehmen.

Credits: Dr. Birgit Feldhusen
Warum ist es notwendig, dass Unternehmen an ihrer Organisation und an ihren Führungsansätzen arbeiten?
Dr. Birgit Feldhusen: Viele Mechanismen und Managementpraktiken stoßen an ihre Grenzen und funktionieren nicht mehr, weil das Umfeld viel flexibler ist als die Organisation selbst und viel dynamischer als die Organisation flexibel. Um diese Herausforderungen meistern zu können, heißt es sich weiter zu entwicklen, neue Strategien der Zusammenarbeit zu entwerfen und den Collective Mind, d.h. den gewohnten Denk- Kommunikations- und Handlungsraum einer Organisation zu erweitern.
Wie kann man den ‘Collective Mind’ in der Organisationsentwicklung zu Tage bringen und nutzen?
Dr. Birgit Feldhusen: Organisationsentwicklung ist als Begriff viel zu kurz gegriffen. Die Idee ist, wie man generell das Zusammenwirken von Menschen nicht nur anders denkt sondern komplett anders begreift. Das derzeitige Bild von Organisation, das die Grundlage von Organisationsentwicklung ist, ist ein Kausales. Zunächst wird analysiert und Schwachstellen ausgelotet, um diese dann mit gewissen Methoden oder Techniken zu beheben. Ich sehe Organisation nicht als eine Maschine an der man ein Rad drehen kann, sondern als einen Geist, der dadurch geschaffen wird, dass Menschen miteinander umgehen, einander begegnen und das auf ganz verschiedene Art und Weise. Du kennst vielleicht den Satz: ‘Da ist etwas zwischen uns.’ Wenn Menschen miteinander in Beziehung treten, miteinander arbeiten, reden, Gesten machen, dann entsteht etwas zwischen ihnen - im positiven wie im negativen Sinn. Dieses ‘dazwischen’ nennen viele in den unterschiedlichsten Disziplinen ‘Mind’ oder ‘Collective Mind’. Der Zwischenraum ist das, wo eine Organisation stattfindet. Hier wird eine Organisation über das tägliche Miteinander immer wieder neu ins Leben gerufen. In einer klassischen Organisation ist es möglich, den Mitarbeitern durch Abbildungen in Organigrammen, Struktur nach Abteilungen, Vorschriften und Prozessabläufe eine gewisse Vorstellung davon zu vermitteln, was von ihnen erwartet wird. Mit dieser Vorstellung gehen sie dann in die Begegnung. Das Bild von Organisation immer wieder neu aushandeln zu lassen, wenn erforderlich, ist zwar schwieriger aber letztendlich sinnvoller und effektiver. Es erfordert allerdings eine hohe Aufmerksamkeit und Reflektiertheit.
Das heisst, die Überlegung der Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten in einem neuen Organigramm ist nicht sinnvoll, wenn davor nicht auf die Begegnungsqualität der Menschen im Unternehmen geachtet wird.
Dr. Birgit Feldhusen: Genau. Es ist die Begegnungsqualität, aus der die jeweils passenden Abläufe und Verantwortlichkeiten entstehen, nicht andersherum. Das was zwischen Menschen geschieht, dieser Zwischenraum, hat ganz unterschiedliche Qualitäten. Je nachdem was mit der Organisation erzielt werden soll, kann man unterschiedliche Qualitäten fruchtbar machen und nähren.
Wie würdest Du diesen Zwischenraum erklären?
Dr. Birgit Feldhusen: Die Begriffe ‚Teamgeist‘ oder den ‘Spirit von Organisationen’, weisen in diese Richtung. In diesem Zwischenraum entsteht der Sinn des gemeinsamen Handelns, er ist Träger von Wissen, Organisation und somit von Handlungsfähigkeit. Es geht einen Schritt über die Vorgangsweise der klassischen Systemik in der Organisationsentwicklung hinaus, hier wird nur die Kommunikation untersucht, egal welcher Mensch kommuniziert. Ich ergänze das systemische Organisationsbild um den ganzen Aspekt von Kognition, Wahrnehmung und Bewusstsein des Einzelnen. Denn der Mensch und sein kognitives System spielt eine ganz entscheidende Rolle damit das Gesamtsystem funktioniert.
Wie würdest Du im Zuge dieser Herangehensweise eine Organisation verändern, denn das ist ja das Ziel, etwas besser zu machen. Wo setzt Du an?
Dr. Birgit Feldhusen: Vor dem Hintergrund der Nutzung des ‘collective Mind’ sehe ich mich als jemand, der grundsätzlich fragt: ‘Was ist eine Organisation?’ Der erste Schritt zur Verbesserung ist immer die Erkenntnis, die Sicht auf sich selbst. Kollektive Intelligenz entsteht durch die Qualität menschlicher Interaktion und ihres Organisationsprozesses. Mit der Anregung zur Selbstreflexion setze ich mich mit den Entscheidungsträgern und mit den Mitarbeitern von Organisationen auseinander um ihren Blick dafür zu weiten, in was für einem Raum wir überhaupt arbeiten. Denn ich arbeite nicht in einer Maschine sondern in einem kollektiven Bewusstseinsraum. Für diesen Blickwinkel ist es notwendig über unser bestehendes Welt- und Organisationsbild hinauszudenken. Wenn wir mit diesem Verständnis auf eine Organisation schauen, dann sehen wir die Ansatzpunkte über die eine Organisation sich selber weiterentwickeln kann. Ich denke, es braucht nicht unbedingt Berater, die genau wissen, wie eine Organisation zu sein hat, sondern wir brauchen einfach nur Begleiter, die die Organisation in ihrem eigenen Reflektieren, ihrer Selbstreflexion begleiten.
Was ist der nächste Schritt nachdem diese Erkenntnis gewonnen wurde? Wie schaffe ich die tatsächliche Veränderung?
Dr. Birgit Feldhusen: Da gibt es ein ganz einfaches Mittel, das ist ‘das sich gegenseitig Beachten’. Ich nehme bewusst den Begriff ‘Beachten’ und nicht ‘Achtsamkeit’, denn der ist vom Buddhismus geprägt und hat eine ganz eigene Begriffswelt. Das Miteinander zu beachten, es zu gestalten und in den Fokus zu nehmen. Auf diese Art ist es möglich eine Organisation zu verändern. Nämlich in dem ich Empathie für das Gegenüber entwickle, indem ich ausgleichend zuhöre, also allen, die etwas beizutragen haben, zuhöre. Mit dieser anderen Qualität wird eine veränderte Art der Zusammenarbeit erreicht, die nachweislich Einfluß auf die Ergebnisse in der Problemlösung von Gruppenarbeit hat. Eine MIT Studie hat diese Herangehensweise zum ersten mal in Zahlen dargestellt. Das Ergebnis war, dass Teams und Gruppen dann umso intelligenter sind, je empathischer die Mitglieder aufeinander eingehen, je mehr sie vom anderen wissen - also zuhören - und je ausgeglichener alle Beteiligten einen Beitrag zu einer Lösung, zu einer Diskussion oder zu einer Aktion leisten.
Was wurde in der Studie erforscht?
Dr. Birgit Feldhusen: Es wurde mittels Regressionsanalysen aufgezeigt, dass zwei Faktoren maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die eine Gruppe bessere Lösungen entwickelt hat als die andere. Der eine Faktor wird ‘Social Sensitivity’ genannt, die Fähigkeit das Gegenüber zu erspüren und der zweite war ein ausgeglichener Redeanteil innerhalb einer Gruppe. Die Einzelintelligenzen der Gruppenmitglieder hatten keinen signifikanten Einfluß auf das Gruppenergebnis. Die Studie beweist, dass es nicht nur auf das Individuum ankommt, sondern auf die Interaktion, die menschliche Fähigkeit einander zu begegnen, nicht nur im privaten Raum, sondern im Geschäftsleben. Eine Gruppe mit geringeren Einzel-IQ‘s, aber hoher Qualität im gegenseitigen Verständnis kann weitaus smarter werden als eine Gruppe von Genies. Google hat diese Studie mit eigenen Analysen weiterentwickelt. Dies ging unter dem Titel ‘Nett sein ist intelligent’ durch die Medien. Das verkürzt das Thema etwas, aber es half ihnen bei der Umsetzung im Organisationsalltag. Wenn man Zusammenarbeit rein funktional sieht und nur über die Inhalte aufbaut, entsteht kein ‘Collective Mind’. Wenn eine Organisation durch Regeln und Ansagen aufgebaut ist, dann ist diese ‘dumm’. ‘Dumm’ deshalb, weil sie nur in einer Situation handeln kann. Sobald sich die Situation verändert, was wir laufend erleben, weiss sie nicht mehr was sie tun soll. Bei einem stark ausgeweiteten ‘Collective Mind’, können sich die Mitarbeiter in jeder Situation verändern und die angemessene Haltung annehmen. Sie können den inneren Freiraum nutzen und ein fluider Raum werden, der auf Unwegbarkeiten reagieren kann. Dafür brauchen sie aber auch äußeren Freiraum, in dem sie ihre eigene Expertisenutzen können anstatt von oben Expertise zu bekommen. Zwischen der vollkommen fluiden Organisation und der vollkommen starren Hierarchie gibt es alle möglichen Ausprägungen.
Du hast einen ganzheitlichen Ansatz, siehst die Umsetzung allerdings individuell. Es geht für das Unternehmen darum was zu ihm passt, das muss man ausprobieren. Und es geht darum was zwischen den Menschen entsteht. Wie bist Du darauf gekommen?
Dr. Birgit Feldhusen: Als ich nach dem Studium bei Unilever im Management arbeitete, erfuhr ich nach sechs Jahren eine massive Sinnkrise, weil das rein funktionale ausschließlich auf Rendite geprägte Management Denken sich in mir innerlich gesträubt hat. Ich habe nicht gesehen, dass es uns als Mitarbeitern gut gegangen ist und ich habe nicht gesehen, dass es den Kunden gut gegangen ist. Ich war danach einige Jahre als Beraterin tätig, doch die Hoffnung darauf, etwas Sinnvolleres zu tun wurde enttäuscht. Erst als ich mich in unterschiedlichen Ausbildungen der Persönlichkeit, der Sinngebung und dem Geist des Menschen widmete, fühlte ich mich auf dem richtigen Weg. Prof. Alexander Kaiser, der vorher auch mein Coach war, holte mich nach Wien an die Wirtschaftsuniversität, wo er ein ähnliches Thema erforschte. An der WU fand ich ein Biotop vor, wo ich mich mit der Frage beschäftigen konnte: ‘Was passiert eigentlich, wenn Menschen zusammen arbeiten? Wie entsteht der Effekt von 1+1= 3 und wie kann man diesen Effekt generieren?’ Ich hatte diesen Effekt in diversen Trainerausbildungen und beim Arbeiten mehrfach erlebt. Wenn Menschen in Gruppen zusammen arbeiten, kann es einen Moment geben, wo auf einmal das Miteinander schlagartig eine andere Qualität erfährt, auf eine andere Ebene gehoben wird. Das fasziniert mich. Wenn Menschen miteinander reden, arbeiten, lachen, spielen, zusammen interagieren, sich begegnen, kann etwas entstehen, das mehr als die Summe des Einzelnen ist.
www.organizingfuture.com
Knowledge Space 2018: Der Geist zukunftsfähiger Organisationen, 3./4.+ 17./18. März, Wien

Dr. Birgit Feldhusen
About:
Dr. Birgit Feldhusen war in Hamburg 7,5 Jahre in Revision, Controlling und Marketing der internationalen Konsumgüterindustrie und 7,5 Jahre auf Beratungsseite tätig, bevor sie 2010 nach Wien kam, um erneut in die akademische Welt einzutauchen. 2014 promovierte sie an der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Wissensmanagement zur Emergenz von kollektivem Wissen. Auf Basis ihrer Forschung liefert sie als Lektorin und wissenschaftliche Beraterin neue Perspektiven zur Organisation der Zukunft. In vielfältigen Formaten bringt sie die Kernthemen einer zukunftsfähigen Zusammenarbeit in den Dialog: in einem jährlichen ‚Knowledge Space‘, in akademischen Lehrveranstaltungen, auf dem monatlichen ‚Wiener Leadership Breakfast‘ sowie in verschiedensten Vorträgen.
0 notes
Text
Es ist kein Automatismus, dass eine Gesellschaft wohlhabend ist - Entrepreneurship Education
Früher war Entrepreneurship gleichgesetzt mit Start-ups. Heute ist Entrepreneurship viel breiter definiert. Es sind Menschen, die neue Ideen umsetzen, Gelegenheiten erkennen und wissen, was man dafür an Ressourcen und an Kompetenz braucht. ‘Alle Kinder und Jugendlichen, die derzeit in der Schule sind, werden irgendwann die Personen sein, die unsere Gesellschaft prägend mitgestalten’, sagt Prof. Johannes Lindner, selbst Entrepreneur als Evangelist der Entrepreneurship Education in Österreich sowie europaweit. Es ist kein Automatismus, dass eine Gesellschaft wohlhabend ist. Jede Generation muss für sich Weichen für die Gesellschaft stellen. Entrepreneurship Education möchte sie insofern unterstützen, dass sie lernen Gestalter der Gesellschaft zu sein.

Warum ist Entrepreneurship ein wichtiges Thema in Schulen?
Johannes Lindner: Man könne es mit dem Begriff Social Inclusion umfassen. Viele Personen oder Eltern erleben nicht, dass in unserer Gesellschaft alles möglich ist. Daher können sie auch für ihre Kinder keine Rollenbilder sein. Für Kinder ist es aber wichtig zu sehen, dass in unserer Gesellschaft sehr viel möglich ist und dass man auch selbst dazu beitragen kann. Das Selbstvertrauen zu haben etwas beizutragen und die Art und Weise auf die man wirksam etwas beitragen kann, muß man irgendwo lernen. Wir gehen eine lange Zeit in die Schule, in dieser Zeit sollte man auch lernen, wie man in der Gesellschaft Partizipation ermöglicht.
Der Zweite Grund hängt mit unserer demografischen Entwicklung zusammen. Wir haben heute im Durchschnitt eine Einkindfamilie. Das bedeutet, dass sich oft zwei Elternteile und vier Großeltern auf ein Kind konzentrieren. Es ist sehr schön, dass sie ihr Kind lieben. Es hat aber auch den Effekt, dass das eine Kind super serviciert wird und eigentlich ein Nesthäkchen ist. Wir haben in der Vergangenheit immer schon Nesthäkchen gehabt, allerdings hat es auch immer andere Kinder oder Jugendliche gegeben. Um aus einer ganzen Generation an Nesthäkchen soziale Wesen zu machen, schickt man sie früh zum Beispiel zu den Pfadfindern oder in Sportvereine. Man müßte aber noch überlegen, wie man ihre Selbstwirksamkeit stärken kann.
Kinder wollen an sich proaktiv sein, aber sie lassen es sich sicher auch gefallen, wenn man sie serviciert. Der dritte Grund ist, dass es kein Automatismus ist, dass eine Gesellschaft wohlhabend ist. Jede Generation muss aufs Neue überlegen, wohin sie die Gesellschaft und die Wirtschaft steuert und wie sie diese mitgestalten kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass möglichst viele Leute die Bereitschaft und die Kompetenz haben, mitzugestalten. Hier geht es nicht nur um Wirtschaft sondern auch um alle anderen Bereiche in der Gesellschaft. Alle Kinder und Jugendlichen, die derzeit in der Schule sind, werden irgendwann die Personen sein, die unsere Gesellschaft prägend mitgestalten. Entrepreneurship Education möchte sie insofern unterstützen, dass sie lernen Gestalter der Gesellschaft zu sein.
Du bist ebenfalls ein Gestalter der Gesellschaft. Du bist Initiator der Initiative for Teaching Entrepreneurship (IFTE.at) und des „EESI Impulszentrums“ für Entrepreneurship Education. Ihr habt ein Modell zu Entrepreneurship Education erarbeitet.
Johannes Lindner: Von 2000 bis 2007 gab es in Wiener Schulen einen Modellversuch. Einer der Outputs war das TRIO Modell, ein Erklärungsmodell von Entrepreneurship Education. Aus unserer Sicht besteht Entrepreneurship Education aus drei Elementen:
Co-Entrepreneurship Education: die Fähigkeit eigene Ideen zu entwickeln und zu wissen wie ich sie umsetze. Das beginnt bei kleinen Kindern bis zu Erwachsenen und steigert sich in der Art und Weise der Idee, die ich umsetzen möchte.
Entrepreneur Culture: behandelt das Thema wie ich jemanden ermutigen und inspirieren kann. Man lernt, dass jeder von uns eine bestimmte Energie hat, die er weitergeben kann und auch empfängt.
Im dritten Element wollen wir Jugendliche keine Ellbogen Mentalität lehren, sondern ihnen zeigen, dass sie Teil einer Gemeinschaft und Gesellschaft sind. Das nennen wir Entrepreneur Civic Education. Es befindet sich an der Schnittstelle zur politischen Bildung, man bringt eigene Ideen für die Gesamtgesellschaft ein.

Wo wird dieses Modell angewendet?
Johannes Lindner: Das TRIO-Modell für Entrepreneurship Education bietet die Grundlage für alle Schulen, die Pioniere sind die kaufmännischen Schulen in Österreich. Wir führen derzeit einen großen Feldversuch mit dem Youth Start Programm von der Volksschule bis zu verschiedenen berufsbildenden Schulen durch. Beim Youth Start Programm kooperieren wir mit fünf Bildungsministerien in Europa, das ist die höchste Art der Europäischen Bildungskooperation, die möglich ist und fallt unter den Begriff Policy Experimentation. Man macht bildungspolitische Experimente, die wissenschaftlich begleitet werden, um einen Beitrag für eine Implementierung zu leisten. Österreich hatte den methodischen Lead, Kooperationsländer sind Slowenien, Luxemburg, Portugal, Dänemark und bilateral Bulgarien. Das Programm für Volksschulen ist ganz neu. Wir sind sehr dankbar, dass hier viele Volksschulen mitmachen und haben gutes Feedback bekommen.
Was sieht eine Challenge beispielsweise in der Volksschule aus?
Johannes Lindner: Wir veranstalten zum Beispiel ein Trash Value Festival. Das ist eine ganz klassische Entrepreneurship Übung bei der es darum geht, dass man aus Dingen die keinen Wert haben, etwas mit Wert erstellt und darüber reflektiert was man für einen Wert jetzt geschaffen hat und welche Kompetenzen man eingesetzt hat, um das zu schaffen.
Du sprichst viel von Rollenbildern, gibt es auch ein Rollenbild für Entrepreneurship Education?
Johannes Lindner: Für ein Entrepreneurial Eco System haben wir in Österreich ein super Vorbild: unsere Schikultur. Wir wissen, dass unsere tollen Schifahrer oder Schispringer nicht vom Himmel herunter fallen. Es ist kein Automatismus. Es reicht nicht, dass man eine tolle Schanze baut, man muss davor Grundlagenarbeit leisten. Das Gleiche sehe ich auch bei Entrepreneurship. Der Prozess beginnt im Kindergarten oder in der Volksschule. wo man mit unterstützenden Elementen Kinder kleine Herausforderungen lösen lässt. In voller Kenntnis dessen, dass sie kontrolliert mit Risiken umgehen. Gregor Schlierenzauer sagte einmal in einem Interview, dass er 100 Meter oder mehr hinunter segle, wäre nicht riskant, riskant wäre manchmal das Umfeld oder das Wetter. Aber das könne er gut einschätzen. Riskanter war es, als er ein Volksschulkind war und 1,5 Meter sprang. Das fand ich sehr charmant. Wenn Kinder lernen mit bestimmten Aufgaben umzugehen, dann haben sie in weiterer Folge gelernt, wie sie mit grösseren Herausforderungen umgehen können.
Wie bist Du dazu gekommen, Dich dieses Themas anzunehmen?
Johannes Lindner: Ich war 1996 über die Uni in ein Projekt involviert, bei dem es um die Reform der Wirtschaftslehrerausbildung in Bulgarien ging. In Bulgarien hat es zwar 1989 die Ablöse des Präsidenten Schiwow gegeben, aber danach gab es noch lange Zeit eine kommunistische Regierung. Damals konnte man in vielen Ländern Europas beobachten, dass die erfolgreichsten ‘Unternehmer’ des Landes oft Personen waren, die politisch die richtigen Kontakte hatten, um bestimmte Dinge in ihr Eigentum überzuführen. Das Image der Wirtschaft war von Korruption geprägt und vielen Leuten wurde unterstellt, dass sie eigentlich Diebe sind.
Da dachte ich, wenn es keine Rollenbilder in der Gesellschaft gibt, an denen ich meinen Wirtschaftsunterricht orientiere, dann versuche ich, dass die Jugendlichen selber Rollenbilder werden. So bin ich zusehends auf Entrepreneurship gestossen. Günther Faltin schrieb damals ein Buch mit dem Titel ‘Reichtum von unten’. Er fasste seine Erfahrungen aus Südostasien zusammen, das passte für Bulgarien sehr gut. 1988/89 war ich Gastforscher an der Columbia Business School, bekam viele weitere Impulse zum Thema Entrepreneurship und lernte viele spannende Professoren kennen.
Das Thema hat Dich nach Abschluß des Studiums weiter begleitet.
Johannes Lindner: Es gab einen Modellversuch an der Schumpeter Handelsakademie in Wien. An dieser Schule lerne ich bis heute mit 2-3 Klassen pro Schuljahr. Es ist wichtig, dass man bei den Kollegen authentisch ist, wenn man in der Lehrerausbildung und an der Verbreitung eines Konzeptes arbeitet. Der Modellversuch wurde gut beleuchtet. Wir hatten verschiedenste kaufmännische Schulen als Pioniere, auch heute sind von 40 Entrepreneurship Schulen 38 kaufmännische Schulen. Es gibt eine hohe Bereitschaft Gestalter zu werden und ein anderes Bild von Wirtschaft mitzuprägen. Nämlich eines in dem man nicht passiv wartet, sondern aktiv Ideen generiert und umsetzt. Immer in Kenntnis dessen, dass das nicht für alle Schülerinnen und Schüler das zentrale Bild ist, was sie machen wollen, aber dass es ein wichtiges Bild ist, das Schüler erreichen wollen. Ich glaube, wenn es eine größere Akzentuierung von Entrepreneurship gibt, wird ein ganz anderes Ergebnis erreicht.
Das ist Dein Credo.
Johannes Lindner: Ja. Mein Hauptmotto ist die Social Inclusion. Ich möchte, dass jeder Schüler die Chance hat, an der Gesellschaft teilzuhaben.

Wie hat sich Entrepreneurship innerhalb der letzten Jahre entwickelt?
Johannes Lindner: Interessant ist, wie sich der Begriff geändert hat, früher war Entrepreneurship gleichgesetzt mit Start-ups. Heute ist Entrepreneurship viel breiter definiert. Heute sind es Menschen, die neue Ideen umsetzen, Gelegenheiten erkennen und wissen, was man dafür an Ressourcen und an Kompetenz braucht. Die Verbreiterung des Begriffs kommt uns natürlich entgegen, weil er heute viel kompatibler mit verschiedenen Arten der Schule und Familie ist.
Wie sieht die Zukunft aus, wenn die Entwicklung so voranschreitet?
Johannes Lindner: Man muss sich die Frage stellen: wie kann es funktionieren, dass eine Innovation im Bildungssystem von Dauer erhalten und auch längerfristig innovativ bleibt? Es ist essenziell, dass die Lehrer und Lehrerinnen sehen, dass sie die Gestalter des Unterrichtes sind. Das Pädagogikelement ist sehr zentral, denn das ist der Grund, warum die meisten LehrerInnen diesen Job ergriffen haben.
Zweitens ist es wichtig, dass noch mehr Jugendliche positive Rollenbilder zeigen. Ich glaube mit diesen Ideen sind wir auf einem schönen Weg. Ich bin beeindruckt was wir für kreative Jugendliche in Österreich haben. Das ist eine Freude. Die Schulstandorte, die Entrepreneurship Education betreiben, haben gleichzeitig Rollenvorbilder. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass Jugendliche sehen, die, die diese coolen Ideen hatten, sind so wie wir. Das können wir auch. Der Unterricht soll ihnen ermöglichen, an ihren eigenen Ideen, aber auch an Ideen für die Gesellschaft zu arbeiten. Für die Schüler ist es von großer Bedeutung zu sehen, dass sie nicht träges Wissen lernen, sondern dass das, was sie sich in der Schule aneignen, die Kompetenz dafür ist, die Gesellschaft mitzugestalten.
Für die Zukunft ebenfalls wesentlich ist, dass Entrepreneurship auch in der Bildungspolitik, auf Bundes- und regionaler Ebene, unterstützt wird. Damit etwas in einem System nachhaltig passiert, braucht es eine systemische Verankerung. Wir haben heute Entrepreneurship in verschiedensten Lehrplänen gut implementiert.
www.eesi-impulszentrum.at www.youthstart.eu www.entrepreneurship.at

Johannes Lindner
About:
Prof. Mag. Johannes Lindner ist der erste österr. Ashoka Fellow. Er unterrichtet Entrepreneurship und Wirtschaft an der Schumpeter Handelsakademie und ist Fachbereichsleiter für Entrepreneurship Education und Leiter des Kompetenzzentrums für wertebasierte Wirtschaftsdidaktik der KPH Wien/Krems. Er ist Initiator des „eesi Impulszentrums“ für Entrepreneurship Education (www.eesi-impulszentrum.at) des BMBWF und der Initiative für Teaching Entrepreneurship (www.ifte.at). Er ist seit über 15 Jahren im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der WirtschaftspädagogInnen. Johannes Lindner ist langzeit Lead-Experte des EcoNet-Projektes in zehn Südosteuropäischen Ländern (2001-2013), des Rotary-Projekts Young Entrepreneur in Bulgarien und Bosnien & Herzegowina und des TEA-Projektes in Ungarn. Er ist der Vertreter Österreichs in Arbeitsgruppen zu Entrepreneurship Education der EU-Kommission sowie Herausgeber der Handbuch-Reihe „Entrepreneur“, Co-Autor der Arbeitsbuch-Reihe: „Wirtschaft gestalten“ und zahlreicher Publikationen zu Entrepreneurship Education und Wirtschaftsdidaktik. Johannes Lindner ist Initiator von Programmen wie "Starte DEIN Projekt", „Misch dich ein – der Debattierclub“, des Betriebspraktikums „Lehrer/innen in die Wirtschaft“ und der Kitzbüheler Sommerhochschule für Entrepreneurship sowie Lehrbeauftragter für Entrepreneurship Education und Wirtschaftsdidaktik der Universität Wien.
0 notes
Text
Wertschöpfung im Digital Business - Überlebenskampf der Unternehmen
Selbstfahrende Autos werden die physische Bewegung verändern und die Grenzen für Menschen und Dinge (Internet of Things) grundlegend neu definieren. Viele glauben, dass man die bestehenden Strukturen mit den neuen Technologien optimieren kann, das ist ein gravierender Denkfehler. Unternehmen müssen nicht nur über ihre künftigen Geschäftsmodelle in den Value Ecosystems nachdenken, sondern auch ihre Autodynamik-Fähigkeit entwickeln, bevor es zu spät wird. Lorenzo Tural stellt der Welt andere Fragen, hat andere Antworten und eine ganzheitliche, vernetzte Weltsicht. Auch dieses Interview ist nicht nach dem Frage/Antwort Muster entstanden, sondern in Form eines Dialoges und in Zusammenarbeit. Danke Harald Katzenschläger und Hermann Gams von der DreamAcademia für die Verbindung.
Interview von Julia Weinzettl

Welcher Innovationsbereich ist im Moment für Dich der spannendste bzw. von welchen technologischen Verknüpfungen erwartest Du Dir die größte Veränderung?
Lorenzo Tural: Die Gestaltung der Digital Business Value Ecosystems und die dafür erforderlichen Autodynamikkompetenzen halte ich aus unternehmerischer Sicht für die größte Veränderung. Die Gesellschaft, Wirtschaft, Märkte transformieren sich derzeit rasant. Die Grenzen der Märkte, Unternehmen, Services, Produkte, Arbeit, vor allem der Unternehmenserlöse verschwimmen, lösen sich auf, werden transparent. Diese Entwicklung mit digitaler Transformation oder Digitalisierung zu beschreiben, greift zu kurz.
Noch werden die Diskussionen je nach dem Kompetenzschwerpunkt der Diskutanten technologiebezogen über einzelne Themen wie Internet of Things, Bots, Cognitive Computing, Künstliche Intelligenz, Robotics, Machine Learning, Deep Learning, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) etc. geführt.
Dabei wird versucht die Vergangenheit mit den Möglichkeiten der technologischen Entwicklungen in die Zukunft zu transportieren. Viele glauben, dass man die bestehenden Strukturen mit den neuen Technologien optimieren kann und gut ist es. Dann ist alles smarter. Das ist ein gravierender Denkfehler.
Kannst Du ein Beispiel anführen?
Lorenzo Tural: Ich möchte Elektroautos detaillierter veranschaulichen:
Verbrennungsmotoren (Benzin&Diesel)
Turbolader
Abgasanlage
Technik zur Emissionsreduktion
Tank und Treibstoffsystem
Getriebe und Kupplung
Einspritzsystem
Starter und Lichtmaschine
sind für die Elektroautos nicht erforderlich. Alles, was man zur weiteren Optimierung dieser Komponenten nutzt, gehört zur Kategorie Brückentechnologien. Die andere Brückenseite ist schon in Sichtweite.
In diesem Zusammenhang stelle ich mir zuerst die Frage: ‘welche Auswirkungen wird es auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Bildung und auf Unternehmen haben, wenn Benzin- und Dieselmotoren nicht mehr produziert werden?’
Kompetenzen und Berufe:
Was werden die Experten, die in den Themenfeldern Benziner&Diesel kompetent sind und ihr Geld verdienen, künftig machen? Wo werden die Schüler und Studenten, die heute für diese Themenfelder ausgebildet werden, Jobs finden?
Fabrik-Strukturen:
Was wird aus den Fabriken (BMW, VW, Daimler u.a.) und ihren Zulieferern, die diese Teile produzieren?
Volkswirtschaft:
Wie wird sich die Volkswirtschaft verändern, wenn BMW, Daimler, VW und andere europäische Hersteller Batterien von LG, Samsung und Panasonic einsetzen?
Die Elektroautos stellen dabei nur einen Streckenabschnitt auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto dar. Den Trend zum selbstfahrenden Auto sehe ich als bereits unumkehrbar. Irgendwann werden herkömmliche Autos aus den Innenstädten verbannt werden, weil sie zu gefährlich sind. Irgendwann werden Autofahrer im heutigen Sinne dann überhaupt nur noch auf Nostalgieveranstaltungen ans Steuer dürfen.
Technologie hat es an sich, dass sie unumkehrbar ist und Verweigerer zu Außenseitern macht.
(An autonomous car (also known as a driverless car, self-driving car, robotic car) and unmanned ground vehicle is a vehicle that is capable of sensing its environment and navigating without human input.)
Wenn Sie jetzt denken, so schnell wird es nicht passieren, wäre ich vorsichtig: ‘Waymo will im Frühjahr 2018 in der US-Stadt Phoenix einen Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos starten. Dazu baut die Schwesterfirma von Google ihre Flotte mit Tausenden Minivans des Chrysler-Konzerns aus.’
Bis die Autos ohne Lenkrad und Pedalen fahren, werden auf der Brücke Altes und Neues nebeneinander existieren. Die automobilen Ökosysteme werden sukzessive gestaltet, um den anderen Brückenkopf „Autonomous Cars“ gekonnt zu erreichen. Unternehmen müssen nicht nur über ihre künftigen Geschäftsmodelle in den Value Ecosystems nachdenken, sondern auch ihre Autodynamik-Fähigkeit entwickeln, bevor es zu spät wird. Im Moment beobachte ich noch ein gemütliches Vorwärtsgehen in der Komfortzone.
Dich kennen wir als Impulsgeber für disruptive Innovationen. Warum disruptive Innovationen?
Lorenzo Tural: Schon als Grundschüler interessierte mich ‘Unbekanntes’ mehr als ‘Bekanntes’. Das Unbekannte machte mich stets neugierig. Auch heute sträube ich mich gegen das Auswendiglernen des Bekannten, ohne nach seinem Sinn zu fragen. Um mit Heinz von Foerster zu sprechen: ‘Meine Lehre, so möchte ich hinzufügen, dass man keine Lehre akzeptieren soll.’ Nein, er stiftet mich nicht zur Respektlosigkeit vor dem geschaffenen Wissen an, sondern er motiviert mich zum Hinterfragen.
Hinterfragen wir gemeinsam:
Selbstfahrende Autos werden die physische Bewegung verändern und die Grenzen für Menschen und Dinge (Internet of Things) grundlegend neu definieren.
Wie wird das auf unseren Alltag auswirken?
Wearables, Doctor Inside, DNA-Selbstreparatur, Transhumanismus, Cyborgs oder die Geruchskommunikation (Bsp. oNotes) werden die menschlichen Fähigkeiten erweitern.
Wie und wo können sie in Unternehmensprozessen angewendet werden?
Bio-Sensoren werden schon heute in manchen Ländern, z.B. Schweden, den USA, im Alltag eingesetzt.
Wie und wo können sie in der Medizin angewendet werden? Könnten die Near-Field-Communication-Implantate die Kreditkarten ersetzen? Was wären die Auswirkungen auf die Banken-Strukturen?
Allein das Thema Bio-Sensoren verbirgt eine geballte Ladung Disruptionspotential für fast alle Branchen.
Nach Schätzungen wird eine Person in 2025 am Tag fast 4.800 Kontakte mit einem Internet-of-Things-Gerät haben – praktisch eine Interaktion alle 18 Sekunden.
Wenn wir uns ins Jahr 2025 versetzen, müssen wir uns die Frage stellen: ‘Ob und wie könnten Bio-Sensoren den Menschen bei den 4.800 Kontakten per Tag das Leben erleichtern?’
Nun möchte ich Sie zu einem Spaziergang in Smart City Wien einladen, um drei aufeinanderfolgende Bahnbrüche zu besprechen.
Im heutigen Wien gibt es:
153.000 Lichtpunkte, die an 3.400 Schaltstellen hängen,
14.000 Ampelanlagen mit 14.000 Schaltkästen
Die Lichtpunkte und Ampelanlagen sollen nach dem Stadtentwicklungsplan STEP 2025 als Stromquelle für Elektroautos dienen. Die Stromquellen werden mittels App auffindbar und reservierbar sein. Der Strom wird über eine App bezahlt. 90% der Apps werden allerdings in kommenden Jahren durch alexa und co. disruptiert, das heißt, der/die Autobesitzer|in kann per Bot anstatt App informiert werden. Zur Abbuchung der Stromtankrechnung kann die Stadt Ihre Daten von seinem/ihrem Bio-Sensor ablesen. Im übertragenen Sinne geht die Stadt Wien künftig unter die Haut.
Derzeit wird an technologischen Blockchain-Lösungen gearbeitet, damit das Auto in Zukunft auch in Wien
sich den günstigsten Stromtarif vor dem Tanken selbst aushandeln,
sich selbst aufladen und
Zahlungstransaktion selbst veranlassen kann.
Wenn dieser dritte Bahn-Bruch eintritt, braucht man weder Bots noch Bio-Sensoren.
‘Ich weiß, dass ich unweiß’ – Kannst Du diesen Satz, den Du öfters verwendest, näher erklären?
Lorenzo Tural: Berücksichtigen wir die weiteren Akteure im mobilen Ökosystem und die exponentielle steigende Anzahl der vernetzten Dinge, können wir die Herausforderung mit der sokratischen Ignoranz ‘ich weiß, dass ich nichts weiß’ beschreiben. Ich möchte damit nicht ausdrücken, dass ich keine Ahnung habe. Existiert das Wissen, kann ich recherchieren und mich schlau machen. Im Neuland Internet werden wir aber noch viele unentdeckte Facetten entdecken, für die noch kein Wissen existiert. Wir müssen vieles noch learning by doing erschließen, dafür neue Ideen finden und neues Wissen erzeugen. Das Verhältnis von Unwissen zu Wissen ist enorm groß.
Fokussiert sich der Ping Pong Thinking Prozess auf Unwissen? Soll dabei 'nicht existierendes´ Wissen erzeugt werden?
Lorenzo Tural: Genauso ist es.
Existiert das Wissen, kann es transferiert werden. Was nicht existiert, kann nicht transferiert werden. Für den Wissenstransfer gibt es erfolgreiche Vorgehensweisen wie Reverse Mentoring, Curated Learning, Agile Learning oder Frontalunterricht. Durch den technologischen Fortschritt werden sie immer mehr, z.B. Blended Learning. Bei solchen Transfer-Vorgängen weiß der/die Lehrende etwas, das die Lernenden noch nicht wissen.
Was müssen wir aber tun, wenn das Wissen noch nicht existiert?
Wir müssen Erkenntnisse gewinnen, neue Ideen finden, Wissen erzeugen. Bis 2020 werden ca. 22 Milliarden neue vernetzte Dinge zu den heute existierenden 28 Milliarden hinzukommen. Weltweit werden neue Digital Business Value Ecosystems entstehen, allerdings etliche der heute erfolgreichen Ökosysteme verschwinden. Unternehmen, die sich im Neuland der digitalen Ökosysteme zum gestaltenden Akteur entwickeln, werden Wertschöpfungs-Erfolge haben.
Wie könnten Unternehmen aber die für sie relevanten Dinge in der enorm großen Menge identifizieren oder selbst entwickeln, um die Wertschöpfungsökosysteme mitzugestalten?
Lorenzo Tural: Best Practices, Success Stories, Erfahrungsberichte stehen nicht zur Verfügung. Die neuen Geschäftsideen müssen Unternehmen selbst finden.
Wie sollen sich Unternehmen dafür organisieren?
Lorenzo Tural: Im organisationalen Zahnrad sollen Hierarchie, Projektorganisation und externe/interne Communities ineinandergreifen, wobei ich die Communities als Erkenntnisbrücken zwischen Outside und Inside sehe. Die Frage „how to bring the outside into the company?” müssen sich Unternehmen tagtäglich stellen, um mit der Dynamik der digitalen Ökosysteme Schritt halten zu können. Unseren Kunden schlage ich zum Beispiel die Bildung von Internet Ureinwohner Communities vor, um ihre Neuland-Kompetenz und ihren inneren Antrieb in Gebrauch zu nehmen.
Frei nach Kafka: „Alles reden ist sinnlos, wenn die Umsetzung fehlt.“
www.lorenzotural.com

Lorenzo Turals Speech beim Yard Forum März 2018 in Wien.

About: Lorenzo Tural wurde am 5.11.2001 in München geboren und besucht die elfte Klasse eines Gymnasiums. Seine Großeltern sind deutscher, kolumbianischer, niederländischer und türkischer Herkunft. Der Internet-Ureinwohner ist mit 16 Jahren bereits seit einigen Jahren als Unternehmer tätig. Unter dem Zweck eines Unternehmens versteht er Gewinn zu machen. Daher gründete er lorenzotural.com, ein Beratungsunternehmen im Bereich Leadership Development und Digital Business Ecosystems Management. Im Rahmen von Ping Pong Thinking Events sollen mit kreativen Methoden Problemlösungen für die Zukunft gefunden werden. Zusätzlich ist Lorenzo Tural Key Note Speaker für Business Innovation im deutschsprachigen Raum und Mentor für das Accelerator-Programm ‘Startup Autobahn’ der Daimler AG.
0 notes
Text
Desksharing ist out - ‘my desk is my castle’ heisst die Devise
Der Rechenstift der CEOs zum Reduzieren der Raumgröße in Form von ‘clean desk’ und ‘desksharing’ verliert im Kampf um die besten Mitarbeiter. ‘My desk is my castle’ heißt die Devise um die besten Köpfe zu bekommen. Nach dieser Philosophie produziert ein österreichisches Familienunternehmen, organisiert sich fraktal in einer Zwei-Kreisorganisation mittels autonomer Teams und Nahtstellenvereinbarungen, kommuniziert ‘auf Teufel komm’ raus’ in täglichen ‘Scrum ähnlichen’ Meetings und verkauft keine Möbelstücke mehr sondern Konzepte. Geliefert wird Just-in-Time innerhalb von 9 Tagen. Mag. Friedrich Blaha, Geschäftsführer und Eigentümer des Büromöbelherstellers Franz Blaha Sitz- und Büromöbel Industrie GmbH spricht über das Ende der Prognosen, den Umgang mit einer veränderten, komplexen Marktsituation und erklärt warum der Erfolg des Unternehmens darin liegt, das Gegenteil von dem zu tun, was alle machen.
Interview von Julia Weinzettl

Blaha Büromöbel ist ein österreichisches Traditionsunternehmen, das vor Ort produziert.
Mag. Friedrich Blaha: Ja, wir produzieren hier. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir nicht abwandern. Wir beherrschen alle Technologiebereiche, die man braucht, um Möbel zu machen. Wir fertigen in drei Haupttechnologien: Metall-, Holz- und Textilfertigung (Tapezieren, Polstern, Nähen). Das ist nicht üblich. In der Regel sind Fabriken - speziell Büromöbelfabriken - Assembling-Betriebe, die Metallgestelle und Platten europaweit zukaufen und mit vier Schrauben das Gestell mit der Platte verbinden. Das ist die Wertschöpfung. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir wollen die Wertschöpfungskette nicht nur im Haus haben, sondern sie noch vertiefen.
Die Philosophie der letzten 15 Jahre für den klassischen Manager war Outsourcing. Was können wir woanders mit niedrigeren Löhnen billiger produzieren?
Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben ‘in-gesourced’ und produzieren vom Rohmaterial weg. Das bedeutet wir haben keine Zulieferanten, außer Stahlblech und Stahlrohre, die wir von der VÖEST beziehen und Spanplatten von Egger GmbH in Tirol. Die Textilien kaufen wir europaweit ein. Durch die Tiefe der Fertigung setzen wir uns massiv von unseren Mitbewerbern ab. Diese Tiefe hat den Vorteil, dass wir alle Prozesse in der eigenen Hand haben. Wir sind autark und müssen nicht auf Vorlieferanten warten, die beispielsweise nur bei der Abnahme von einer Mindestmenge liefern.
Sie liefern just-in-time innerhalb von 9 Tagen.
Mag. Friedrich Blaha: Genau. Das ist aufgrund der tiefen Fertigung möglich, da wir die Prozesse beherrschen. Daher können wir sehr genau sagen, wie lange wir brauchen. Dieser Ansatz wurde von Ernst Weichselbaum, Unternehmensberater mit Vision, initiiert. Wir überprüften die Durchlaufzeiten in den einzelnen Technologien und ermittelten die kürzest mögliche Durchlaufzeit in der wir alle Produktlinien erstellen können. Das waren 9 Tage und ist daher unsere Lieferzeit.

Was hat Sie zum Umdenken gebracht?
Mag. Friedrich Blaha: Davor haben wir das getan, was auch heute noch die meisten klassischen Möbelhersteller machen: prognostiziert. Versucht zu erahnen, was der Markt möchte. Das hat viele Jahrzehnte, bis in die 1980er des vorigen Jahrhunderts funktioniert. Da konnten wir alles, was wir prognostiziert haben, verkaufen. Der Markt hat sich geändert, wir haben jetzt einen Käufermarkt und keinen Verkäufermarkt mehr. Bis 1990 war jeder, der produzieren konnte, der König. Jetzt ist der Kunde der König.
Die Märkte sind dynamisch und sehr komplex geworden. Es ist eine Riesenaufgabe für das Management, den Markt trotzdem zu erkennen. Wir nehmen die schnellen Veränderungen, die draußen passieren, nicht mehr wahr. Die Komplexität nimmt ständig zu und wir verstehen den Markt nicht mehr. Wir - damit meine ich die Führung - stürzen uns auf eine Kundengruppe, die aus Erfahrung unsere wichtigsten Kunden sind und bemerken gar nicht, dass sie am absinkenden Ast ist. Auf der anderen Seite poppen ganz neue Kundengruppen auf, die wir noch gar nicht erkannt haben.
Wie erkennen Sie dann was der Markt will?
Mag. Friedrich Blaha: Das Wissen liegt vor Ort beim Mitarbeiter - einerseits an der Maschine, andererseits draußen beim Kunden. Der Vertrieb - wir haben 20 Personen im Außendienst - ist dem Kunden am nächsten und erfährt, was die Kunden konkret wollen. Jetzt müssen wir eigentlich nur sicherstellen, dass diese Information auch die Führungsebene erreicht. Früher überlegte sich die Führung, wie die Anforderungen des Markt sein könnte, machte daraus Programme und verlautbarte sie als Anordnungen im Betrieb. Es gab Befehle von oben und die Meldung von unten, dass sie erledigt wurden. Das hat sich umgedreht.
Bottom up heißt die Devise?
Mag. Friedrich Blaha: Genau. Heute brauche ich eine Organisation, die von unten nach oben funktioniert und nicht umgekehrt. Das ist der Ansatz. Diese Umstellung vollzogen wir 1996. Das half uns, schnelle Veränderungen zu überleben. Das wars. Davor produzierten wir auf Lager, die Prognosen wurden aber immer schlechter. Wir prognostizierten immer für drei Monate und zogen dann diesen riesigen Bulk für drei Monate in Serien zusammen. Diese Serien jagten wir durch die Maschinenstraßen und führten die Teile, die herauskamen, in ein Lager. Danach warteten wir auf die Kundenaufträge und kommissionierten die Bestellung heraus. Zum Beispiel einen Schrank in einer bestimmten Farbe, den Unterteil, den Oberteil, die Rückwand, die Türe und so weiter. Nach den drei Monaten sollte das Lager immer leer sein. Aber es leerte sich immer weniger. Die nächsten drei Monate an Produkten kamen bereits aus der Fertigung, aber das Lager war noch nicht frei. Wir bauten permanent irgendwo Lagerflächen auf. Das ging so weit, dass wir auf den Parkplätzen riesige Bierzelte aufbauten und alles, was nicht verkauft wurde, hinein stellten. Als wir Ernst Weichselbaum kennenlernten, planten wir gerade eine riesige Lagerhalle. Weichselbaum fragte: ‘Wann wisst ihr wirklich, was der Kunde möchte?’ - das war die Schlüsselfrage. Der Verkauf sagte: ‘Eigentlich wissen wir das erst, wenn wir einen unterschriebenen Auftrag haben’. ‘Perfekt, das ist euer Ansatz. Ihr müsst das Konzept umdrehen. Der Kunde zieht den Auftrag und nicht ihr produziert etwas und hofft, dass ihr es verkauft.“
Die komplette Umkehr der bisherigen Strategie.
Mag. Friedrich Blaha: Ja, das war ein echter Paradigmenwechsel in unseren Köpfen.
Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es möglich ist, einfach zu warten. ‘Was ist, wenn nichts kommt, dann haben wir ja nichts zu produzieren! Und wenn zu viel kommt, was ist dann?!’ Diese Verwirrungen in unseren Köpfen lösten wir gemeinsam. Wir zerlegten das Unternehmen in Teams, weil wir erkannten, dass die Mitarbeiter selbst am besten wissen, wie sie produzieren müssen. Der Maschinenbediener weiß viel besser, wie die Maschine produzieren kann, als der, der sich das zwei Ebenen über ihm ausdenkt. Also gaben wir die Verantwortung in die Teams und vernetzten alle.
Ein sehr extremer Schritt, den heute viele Unternehmen noch nicht wagen. In Anbetracht dessen, dass er vor zwanzig Jahren geschah, ist er noch viel bedeutsamer. Wie haben Sie sich das getraut?
Mag. Friedrich Blaha: Dazu gibt es mein persönliches Erlebnis, das Heureka über die ‘Intelligenz der Mitarbeiter’. An einem Wochenende ging ich mit meinen Kindern wandern. Wir spazierten durch die Gegend und kamen zu einer Siedlung in der fleißig an Rohbauten gearbeitet wird. Plötzlich rief jemand von einem Rohbau herunter: „Grüß Sie, Herr Blaha!“. Ich schaute wer das sein könnte und erkannte einen meiner Mitarbeiter. Ich fragte, „Was machen Sie denn da?“. Er sagte: „Ich baue hier mein Haus.“ „Wer hat es denn geplant?“ „Ja ich habe die Pläne gezeichnet.“ „Und wer hat die Behördenwege erledigt?“ „Das habe alles ich gemacht.“ „Und wie ist denn das mit dem Material? Woher bekommen Sie das?“ „Herr Blaha, wenn sie wirklich mal etwas brauchen, fragen Sie mich. Im Umkreis von 50 Kilometern weiß ich die besten Quellen.“ „Toll, und wer organisiert Ihnen die Pfuscherkolonne?“ „Das mache auch alles ich.“ Da dachte ich: „Uh. Das ist ja ein richtiger Unternehmer! Und was macht er bei mir in der Firma?“
Ich schaute mir seinen Job an. Er machte jeden Tag einen einzigen Handgriff. Von in der Früh bis am Abend. Von Intelligenz nutzen keine Rede. So erkannte ich, dass wir gut ausgebildete, hochintelligente Leute haben, aber wir liessen sie, durch unsere Anordnungen und Regeln, ihr Potential nicht nützen.
Wie haben Sie diese Erkenntnis im Unternehmen umgesetzt?
Mag. Friedrich Blaha: Autonome Teams. Die Intelligenz ist vor Ort, die Leute wissen besser was sie benötigen und, wenn sie es nicht wissen, dann schulen wir sie. Oder sie sollen sich selber schulen. Wir verlegten die ganze Verantwortung von zwei Ebenen in diese Teams. Die Wartung und Materialbestellungen tätigte nicht mehr der Einkauf, sondern die Teams. Sie wissen am besten, wann sie nachbestellen müssen. Die Beschreibung der Tätigkeiten der Teams wurde in einem einzigen Dokument niedergeschrieben.
Es heißt: ‘Wir leisten, wir verantworten’. Das ist ein ganz einfacher, sehr kraftvoller Satz. Ich mache den Handgriff, ich bin verantwortlich.
Bis dato war es so: Ich bohrte das Loch. Ob das Loch am richtigen Platz war, lag in der Verantwortung der Konstrukteure, dafür, dass der Bohrer scharf war, war auch jemand anderer zuständig, kontrolliert wurde das Loch von der Qualitätsabteilung und dass es zeitgerecht gebohrt wurde, dafür war der Meister zuständig. Dann hieß es: Meister, ich habe kein Material. Meister, die Maschine geht nicht. Meister, mein Werkzeug ist gebrochen. Und so weiter. Die Meister waren der entscheidende Faktor in der Fertigung. Immer, wenn ich wusste, dass einer der Meister auf Urlaub ging, konnte ich schon drei Wochen vorher nicht schlafen, weil da klar war, dass die Produktion herunterfährt. Denn, ‘wenn kein Meister mehr da ist, was machen die Arbeiter denn dann?’ - Na die warten.
Diese Zugangsweise haben Sie komplett verändert.
Mag. Friedrich Blaha: Wir brauchen nur zwei Dokumente, um die ganze Firma zu organisieren. Die Teams fingen an, alles selber zu bestellen. ‘Leisten und Verantworten’ ist das Dokument Nummer 1. In ‘Leisten und Verantworten’ ist der tägliche Ablauf der einzelnen Teams enthalten - vom Beginn in der Früh, Maschine starten, Kontrollläufe durchchecken, Werkzeuge bereitstellen, die Tagesportionsliste mit den Kollegen durchgehen, etc. Das wurde einmal im Detail niedergeschrieben, von allen unterschrieben und ist der Teamjob. Es wird nur geändert, wenn es an neue Technologien angepasst werden muss. Dieses Dokument haben wir konsequent für die ganze Firma erstellt. Jeder ist Mitglied eines Teams. Auch ich bin in einem Team, dem Führungsteam. Als nächstes mussten wir die Verbindungen zwischen den Teams herstellen. Teams alleine funktionieren nicht, sie funktionieren nur in Verbindung miteinander, da kam die legendäre Erfindung von Herrn Weichselbaum ins Spiel: die Nahtstelle.
Ein großer Kreis (ein Team) und ein zweiter großer Kreis (ein weiteres Team) wird durch einen kleinen Kreis (die Nahtstelle oder Vereinbarung) verbunden, das sogenannte „Zwei-Kreis-Prinzip“. Zwischen dem vorlaufenden und dem nachkommenden Team gibt es eine Vereinbarung, wie wir miteinander arbeiten: die Nahstellenvereinbarung. Sie beschreibt Arbeitsschritte wie ‘Wann bekomme ich die ersten Teile von dir? Wo bekomme ich sie? Mit welchem Transportmittel werden sie bewegt? Wie sind sie verpackt?`. Diese Abläufe machen sich die Teams aus. Wenn das gemacht wurde, erhält man zwei Dokumente, das eine ist ‘Wir leisten, wir verantworten’ und das andere ist die Nahtstellenvereinbarung zwischen den Teams. Das ist die Firma. Das heißt, wir haben eine Organisation, die aus Regeln und Vereinbarungen besteht und nicht mehr aus Anordnungen und Steuerungseingriffen von einer übergeordneten Instanz. Die Aufgaben und die Abläufe sind klar. Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Das sind die zwei Hauptprinzipien der Produktion. Wenn man beschreiben will, wie wir uns organisieren, sagen wir, die Firma Blaha ist ein kommunikatives Netzwerk und besteht aus Fraktalen.

Ein Netzwerk zu managen ist für viele nicht einfach.
Mag. Friedrich Blaha: Bei einem Netzwerk haben Manager ein Problem, weil man gewohnt ist, nach einem hierarchischen Prinzip zu arbeiten, in dem die Kommunikationswege klar definiert sind, ‘wer redet mit wem und wer darf wem die Befehle geben?’. Bei einem Netzwerk haben die Manager nicht mehr alles Griff. Wenn ich dem Team so viel Autonomie gebe, weiß ich nicht mehr ganz genau, was es jeden Tag entscheidet und umsetzt, denn das Team entscheidet selbstorganisiert. Die Führung muss Entscheidungskompetenz abtreten und das tut vielen Führungskräften weh, weil sie die Kontrolle nicht mehr haben.
Also heisst das Zauberwort Management des Vertrauens.
Mag. Friedrich Blaha: Genau, denn wenn eine Firma in einem Netzwerk organisiert ist, muss man akzeptieren, dass man nicht mehr alles bis ins Detail weiss und daher auch nicht mehr kontrollieren kann.
Wie stellen Sie sicher, dass die Information dennoch alle erreicht?
Mag. Friedrich Blaha: Wir kommunizieren auf Teufel komm raus. Wir starten um sieben Uhr mit dem ersten Meeting, es heißt ‘Montage Ok.Punkt’. Wir liefern unsere Möbel aus und montieren sie auch. Die Monteure ‘müssen’ alles erfüllen, was wir auf der Verkaufsseite dem Kunden versprochen haben. Am nächsten Tag werden sie sozusagen abgefragt. Das gesamte Führungsteam der Firma Blaha ist anwesend und hört zu, was die einzelnen Teams berichten. Es wird über Ideen und Reklamationen gesprochen und geklärt, wer dafür zuständig ist. So erfahren wir hautnah, als Führungsteam, ob wir einen guten Job gemacht haben oder nicht. Dieser Ok.Punkt wird vom Logistikchef moderiert und ist genau geregelt. Wenn jemand ein Problem hat, wird es sofort dem Bereich zugewiesen, den es betrifft, z.B. im Metallbereich war ein Fuß nicht gerade. Die Regel ist, am nächsten Tag, wieder um sieben Uhr früh muß der Betroffene dem Anderen erzählen, wie er das Problem behoben hat. Damit konnten wir die Fehlerquote um den Faktor Zehn verringern. Wir hatten 6% Reklamationen, jetzt haben wir 0,6%. Alleine durch Kommunikation.

Um 10:30 haben wir den HauptOk.Punkt. Das ist der Moment, bei dem vom Verkauf alle Aufträge, die in neun Tagen ausgeliefert werden müssen, an die Produktion übergeben werden. Um 11 Uhr geht es zur Ausarbeitung, am nächsten Tag in die Arbeitsvorbereitung und später beginnt die Produktion. Es gibt klare Regeln, wie die Aufträge aussehen müssen, damit wir sie produzieren können. In dieser Besprechung wird entschieden, ob ein Auftrag übernommen wird oder nicht. Daher ist sie stark ritualisiert, wie in der Kirche. Wir haben einen eigenen Raum nur für diese halbe Stunde und ganz harte Regeln. Von den Führungskräften ist immer jemand anwesend und überprüft, ob alles so eingehalten wird, wie wir es vereinbart haben.
Der dritte OK.Punkt, der Sonderkonstruktionspunkt, findet jeden Tag um 12:45 statt. Die Bereichsleiter aus den Fertigungsbereichen, Holz, Metall, Forschung & Entwicklung und der Betriebsleiter kommen zusammen und warten, ob ‘Kunden’ kommen. Kunden sind die Verkäufer und Planer. Sie berichten von Kundenbedürfnissen wie z.B. Sonderlösungen und besprechen, ob es möglich ist, sie zu produzieren. Wenn diese Anfragen drei mal auftreten, wird die Frage aufgeworfen, ob wir daraus eine neue Produktlinie machen können. So erfahren wir, was der Markt will und können diese Wünsche auch schon gedanklich in ein neues Produkt einfliessen lassen.

Viele klassische Führungsaufgaben wurden durch diese Ansätze abgegeben. Welche Aufgaben haben Führungskräfte in einer Netzwerkorganisation dann noch?
Mag. Friedrich Blaha: Die wichtigste Aufgabe der Führungskräfte ist es mittlerweile die Mitarbeiter zur Selbstorganisation hin zuführen. Die Führungsdefinition heute heißt nicht mehr anordnen und kontrollieren, sondern eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Die Führungskräfte müssen das, was mit den Mitarbeitern vereinbart wurde, ermöglichen. Wir müssen ihnen die richtigen Werkzeuge geben, wir müssen die Prozesse - wie beispielsweise die richtige Software - zur Verfügung stellen, damit sie eine ununterbrochene Arbeit leisten können. Das ist unsere neue Aufgabe geworden.
Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit der Arbeitswelt von morgen, weil dort ihre Möbel stehen werden. Wenn man zehn Jahre in die Zukunft schaut, wie können die Arbeitsplätze dann aussehen? Mag. Friedrich Blaha: Als ich an der WU studierte (1969-1973), gab es Prognose-Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren und das hat sogar funktioniert. Das geht heute nicht mehr. Unser Horizont auf der täglichen Geschäftsebene ist genau ein Monat. Mehr weiß ich nicht. Ich kenne von heute weg die nächsten neun Tage und was mein Umsatz pro Tag ist. Wir können bestenfalls zweimal neun Tage erahnen. Mehr ist da nicht drinnen. Durch die Digitalisierung, aber auch durch das Internet getrieben, verändert sich die Bürowelt. Die große Wertschöpfung entsteht ja schon lange in den Büros und ist nicht mehr produktionslastig. Jetzt müssen wir, als Firma Blaha, Möbel zu einer veränderten Situation liefern. Auf einmal haben wir die falschen Produkte, bei dieser Entwicklung stehen wir gerade. Unsere Erkenntnis derzeit ist Folgende: die in den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelten Bürolösungen waren stark Rechenstift getrieben. Man hatte einen Arbeitsplatz mit einer gewissen Anzahl an Quadratmetern, dieser kostete eine gewisse Anzahl an Quadratmeter Licht, Miete, Reinigungskosten, etc. Man versuchte Quadratmeter und damit Kosten zu reduzieren, indem man den Mitarbeitern ein paar Quadratmeter wegnahm, bis hin zum ‘Desksharing’. Man hatte keinen eigenen Arbeitsplatz mehr. Man hatte zehn Personen, acht Schreibtische und wenn alle in die Firma kamen, hatten zwei keinen Platz. Die Philosophie hieß ‘Clean Desk’, es musste alles abgeräumt werden, denn am nächsten Tag saß ja jemand anderer da. Ich konnte meine Sachen, meine Brösel, die Bilder von meiner Frau, meinem Hund und so weiter, nicht stehen lassen. Die musste ich wieder einpacken. Desksharing war bei CEOs von großen Organisationen extrem beliebt, weil es über Skalierung starkes Einsparpotential hatte. Zum Beispiel: wir haben 4.000 Angestellte und brauchen nur 3.000 Arbeitsplätze, also ersparen wir uns den Betrag X, hochgerechnet auf 10 Jahre ergibt das X Millionen - Das schaut gut aus, das machen wir.
Übersehen wird dabei der Faktor Mensch. Niemand will in einem nackten Raum sitzen, indem ihm nichts gehört und wo man sich nirgendwo zurückziehen kann. Da fühlt man sich nicht wohl. Wie soll denn da die Intelligenz, die Kreativität und das Potential dieser Menschen gehoben werden?
Unternehmen haben heute ein grosses Problem: wo bekommen wir die besten Köpfe her, damit wir überleben können? Denn der Wettbewerbskampf ist um einen Faktor 10 größer als vor 30 Jahren. Firmen sind permanent auf der Suche nach den besten Köpfen, sagen aber zu den besten Köpfen, ‘Wo Sie täglich sitzen, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Gefällt Ihnen das, lieber zukünftiger Mitarbeiter?’.
Das ist nicht der richtige Ansatz, daher heißt unsere Herangehensweise: ‘My Desk is my castle’.
Ich brauche Rückzugsbereiche, ich brauche etwas, das mir gehört um mich wohl zu befinden. Wenn ich in einer unangenehmen Umgebung sitze, kann ich nicht kreativ werden und die beste Leistung bringen. In meinem Zuhause ist alles wunderschön. Jedes einzelne Stück habe ich mir ausgesucht, damit ich mich wohlfühle. Das ist der Bereich, in dem ich körperliches und seelisches Wohlbefinden habe. Dann komme ich in die Firma und finde dort genau die entgegengesetzte Welt. Das kann nicht funktionieren.
Wie wirkt sich diese Veränderung auf den Markt aus?
Mag. Friedrich Blaha: Wir merken diese Veränderung bereits in Gesprächen mit Kunden. Wir werden mit folgenden Kundenanfragen konfrontiert: ‘Ich brauche einen neuen Ansatz. Wie die Möbel dabei ausschauen, ist mir vollkommen egal. Ich will folgendes erreichen: Erstens, wenn ein möglicher Mitarbeiter zu uns kommt und ich ihm zeige, wie und wo wir arbeiten, muss der sagen, ‘Wow, das gefällt mir. Da möchte ich dabei sein.’ Zweitens, ‘wenn ich mit einem Kunden durch meine Büroräume gehe, dann muss der Kunde unsere Kompetenz spüren und uns zutrauen, dass wir in der Lage sind, seine Probleme zu lösen. So, und jetzt machen sie was.’

Das bedeutet, Sie verkaufen konkret keine Möbel mehr sondern Ambiente. Mag. Friedrich Blaha: Genau. Früher verkauften wir einen Schreibtisch, einen Schrank und einen Drehstuhl. Heute verkaufen wir Konzepte und Einrichtungsphilosophien. Nach dem Motto von Jan Teunen: ‘Wir müssen die Büros mit Schönheit fluten.’ befriedigen wir die Anforderungen unserer Kunden, indem wir Atmosphären schaffen, die durch Wohlfühlen, Kreativität und Wertschätzung die Arbeitsfreude fördern und Kompetenz ausstrahlen.

www.blaha.co.at

About:
Mag.Ing.Friedrich Blaha übernahm 1980 die Geschäftsführung der Franz Blaha Sitz- und Büromöbelindustrie. Gegründet wurde das Unternehmen 1933 von Franz Blaha vorerst als Feinkostkette. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Firma wieder aufgenommen mit Handel von Waren aller Art, mit allem, was man nach dem Krieg gebraucht hat. In den 1950er Jahren kamen Gartenmöbel als neues Geschäftsfeld zum Vertrieb hinzu. Das war Blahas innovative Idee um in die grauen Nachkriegstage Farbe zu bringen. Daraus entwickelte sich das heutige Unternehmen. Da es nicht genug Ware gab, wurde selbst produziert. 1960 wurde das Werk in Oberösterreich zu klein, die Firma kaufte in Korneuburg von der Finanzlandesdirektion ein Areal, das ehemaliges deutsches Heereseigentum war. Die Kasernen, die darauf standen, waren nie in Betrieb gegangen und befanden sich im Rohzustand. Als nächsten Schritt wechselte man von der Gartenmöbelproduktion, als Saisonprodukt, zu Möbel für den Innenraum, um das Risiko auszugleichen. 1978 fiel die strategische Entscheidung in den Büromöbelbereich einzusteigen. Die Blaha Büromöbel GmbH produziert ausschließlich in Österreich und ermöglicht durch Just-in-time Produktion eine Lieferzeit von 9 Werktagen.
#faktale Organisation#Desksharing ist out#Blaha Büromöbel#Ernst Weichselbaum#Nahtstelle#DreamAcademia
0 notes
Text
Groundsurfing - österreichische Schüler punkten bei einer internationalen Entrepreneurship Challenge in Russland
Groundsurfing heißt das Projekt von Yannis Olschewski, Peter Seyfang und Mario Jandrisevits, das im Rahmen der gemeinsamen Diplomarbeit entstand. Über ihre Plattform soll man nicht nur internationale Fußballtickets zu normalen Preisen erhalten, sondern gleichzeitig Unterkunft und Fananschluß zum gemeinsamen Matchbesuch erhalten. Ihr Mentor Johannes Lindner, Initiator der Initiative für Teaching Entrepreneurship (www.ifte.at), brachte sie zur Entrepreneurship Challenge nach Rußland, wo sie mit der Idee zum vereinfachten Fußballtourismus die russische Jury überzeugten und den zweiten Platz gewannen.
Interview von Julia Weinzettl

Wie seid Ihr zu der Challenge gekommen?
Mario Jandrisevits: Wir hatten von Johannes Lindner Ende Oktober die Einladung teilzunehmen bekommen, weil noch Nachfrage bestand und es als Finalrunde eine Reise nach Moskau zu gewinnen gab. Mitte Oktober meldeten wir uns an, es gab drei Phasen, bei denen wir jeweils in die nächste Runde kamen, jetzt sind wir Ende November nach Moskau geflogen.
Und habt den zweiten Platz gemacht, Gratulation!
Hattet Ihr Eure Projektidee schon davor?
Peter Seyfang: Wir sind im Abschlußjahrgang auf der Schumpeter Handelsakademie in Wien 13 und müssen ein Projekt ausarbeiten. Weil wir selber fußballbegeistert sind und auch gerne auf Matches im Ausland gehen, ist uns die Idee gekommen, Fußballreisen einfacher zu machen. Wir haben uns schon vor dem Sommer zusammengesetzt, viel früher als wir müssten, weil es uns wirklich interessiert das Projekt auch zu machen. Die Struktur bestand daher schon, für den Wettbewerb machten wir noch eine Umfrage.
Um was es geht es bei Groundsurfing?
Yannis Olschewski: Bei Fußballreisen ins Ausland entstehen immer Mehrkosten bei der Ticketbeschaffung durch Ticketplattformen. Wir wollen Fußballfans aus aller Welt miteinander vernetzen, damit sie kostengünstig und mit dem größtmöglichen Erfahrungs- und Spassfaktor verreisen können.
Wie geht das?
Peter Seyfang: Ein Beispiel: Ich habe Verwandte in Manchester, in England. Als ich sie besuchte, wollte ich auf ein Manchester United Match gehen. Das war damals ein Cupspiel, ich versuchte in Österreich Tickets zu bekommen. Manchester United ist aber nicht darauf ausgelegt, an Fans aus dem Ausland Tickets zu verkaufen, daher sind sie um ein vielfaches teurer. Ich hätte für das Ticket statt 29 GBP 129 GBP bezahlen müssen. Mein Onkel hat aber Freunde, die Manchester United Fans sind und für mich das Ticket besorgten. Mit ihnen ging ich auch gemeinsam auf das Match. Mit ansässigen Fans mitzugehen, gemeinsam zu singen und danach ins Pub zu gehen, war natürlich die viel bessere Erfahrung. Unsere Ticketplattform soll sozusagen meinen Onkel ersetzen, sie soll die Verbindung zu lokalen Fans herstellen.
Wie kommen die internationalen Fußballfans auf eure Plattform?
Mario Jandrisevits: In Österreich ist unser Kooperationspartner der Betreiber des größten deutschsprachigen Fußballforums. Über dieses Forum konnten wir Kontakte mit unserer Zielgruppe knüpfen und durften dort auch posten. Als nächstes werden wir an die Zielorte fahren und die Zielgruppe über die Vereine direkt ansprechen. Das geht recht schnell, weil Fußballfans sehr gut vernetzt sind.
Yannis Olschewski: Zusätzlich gibt es Marketingmöglichkeiten, wie zum Beispiel über Youtube, hier werden in einschlägigen Kanälen 100.000 Klicks/ Woche erreicht. Mit gezielten Marketingmaßnahmen ist es möglich eine relativ große Zielgruppe in unseren Zielländern zu erreichen.
Was sind eure Zielländer?
Peter Seyfang: Wir haben eine Umfrage gemacht, an der vor allem Leute aus Österreich und einige aus Deutschland, Holland und England teilnahmen. Die populärsten Zielländer sind UK, vor allem England, dann Deutschland, Österreich und Spanien. Das sind die Länder, mit denen wir beginnen.
Wenn ich Member der Plattform bin und auf ein Spiel nach Barcelona möchte, was mache ich dann?
Peter Seyfang: Die Stadt und den Verein auf unserer Plattform eingeben. Als Ergebnis erscheinen alle Personen des Netzwerks, die Tickets besorgen können und die Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, sollte das auch gewünscht sein.
Wie verdient ihr Geld?
Peter Seyfang: Wir verrechnen eine Buchungsgebühr, weiters bieten wir für Frequent Users eine Premiummitgliedschaft an, über die sie Rabatte und Goodies bekommen.
Wie war das Auswahlverfahren um an der Challenge teilzunehmen?
Mario Jandrisevits: Das war sehr lustig. In der ersten Runde mussten wir einen Fragebogen ausfüllen, der vermutlich mit Google Translate übersetzt wurde, daher auch Interpretationsspielraum offen ließ und ein Essay über die Idee schreiben. Ende Oktober kam die Info, dass wir es in Runde zwei geschafft hatten. Wir erhielten am 25. Oktober eine Email, die uns aufforderte, am 31. Oktober ein Pitchvideo abzugeben. Der Termin war mitten in den Herbstferien. Peter war zu dieser Zeit auf einer Fußballreise in Stuttgart, wir beide drehten das Video und er schnitt es in einer ‘Nacht und Nebel’ Aktion. Mitte November kam die Einladung nach Moskau, alles in sehr engem Zeitrahmen. Von 25. bis 29. November flogen wir nach Moskau.
Was geschah dort?
Mario Jandrisevits: An der Challenge nahmen zwölf Teams aus sechs Ländern teil. Österreich, Slowenien, Russland, Weissrussland, Turkmenistan, Tatschikistan und Kirgisien waren vertreten. Beim Pitchen wurde uns klar, dass hier eine andere Präsentationskultur herrschte. Die Präsentation war bei allen Teilnehmern - außer Österreich und Slowenien - beschränkt auf einen Präsentator, der an einem Pult die Inhalte ablas, die beiden Teammitglieder saßen daneben und klickten die Slides weiter. Für uns sehr ungewohnt, wir hatten uns in unserem Pitch auf Emotion und Storytelling konzentriert.

Yannis Olschewski: Auch ungewohnt, aber natürlich notwendig, war die Übersetzung. Jeder Satz, den wir auf englisch sprachen, wurde danach auf Russisch übersetzt, dadurch dauerte die Präsentation 45 Minuten. Wir bekamen gutes Feedback, es hat bestimmt geholfen, dass die Fußball WM im nächsten Jahr in Rußland stattfindet.
Am nächsten Tag wurden die Gewinner während des Synergy Global Forum Moskau 2017 vor 20.000 Menschen im Fußballstadion verkündet. Was war das für eine Veranstaltung?
Mario Jandrisevits: Das war eine große Inspirationsveranstaltung, ähnlich einer Tedxkonferenz. Richard Branson hat unter anderen gesprochen, ebenso wie Nick Vujicic und Guy Kawasaki. Die Veranstaltung dauerte neun Stunden. Gegen Ende wurden die drei Gewinner der Challenge verkündet. Während dessen gab es auch Tanzauftritte und Feuerspucker, sehr imposant.
Yannis Olschewski: Eine Stunde bevor der Gewinner verkündet wurde, hat der Veranstalter uns angewiesen unter die Bühne hinunter gehen, weil wir jede Minute gerufen werden können. Zwölf Teams standen dort eine Stunde nervös. Wir haben natürlich nicht verstanden, was sie gesagt haben, denn es war fast alles auf Russisch.

Dann seid Ihr auf die Bühne gegangen.
Peter Seyfang: Das war sehr aufregend, wir haben sogar dem russischen Wirtschaftsminister die Hand geschüttelt und wussten es gar nicht. Es war ein bisschen surreal.
Was macht Ihr als nächstes?
Yannis Olschewski: Bis März 2018 steht die Diplomarbeit und der Schulabschluss im Vordergrund, danach werden wir uns der Plattform widmen. Man kann sich auf der Website aber schon für den Newsletter anmelden.
www.groundsurfing.com Blog groundsurfing www.ifte.at
#Groundsurfing#fußballreisen#Entrepreneurship Challenge#Synergy Global Forum Moskau 2017#Johannes Lindner#IFTE#DreamAcademia
0 notes
Text
Shift of trust - from institution to individual and machine
Caused by disappointment in the government, institutions and organizations the trust that used to flow upwards to regulators, experts, leaders and other traditional forms of authority, is now flowing sideways to colleagues, peers, friends and sometimes complete strangers of the internet. Rachel Botsman, author of ‘Who can your trust’ an Oxford lecturer, identifies the start of the third biggest trust revolution in the history of humankind, the shift from the monolithic to the individualized. Due to technological advancement it also means trusting machines and bots to do things humans used to do; making informed judgements about people. The key to using these tools is that we don’t lose context or autonomy around making a decision. Thank you Hermann Gams, DreamAcademia, for inspiring this interview.
Interview by Julia Weinzettl

Why would we trust individuals more than institutions or why would we still trust at all?
Rachel Botsman: A society cannot survive, and it certainly cannot thrive. Trust is fundamental to almost every action, relationship and transaction. To take any kind of risk you need trust. There is plenty of trust in society; it is just flowing in a different direction from institutions to individuals. What if trust, like energy, cannot be destroyed and instead just changes form? That is what I think is happening now. Trust that used to flow upwards to regulators, experts, leaders and other traditional forms of authority, is now flowing sideways to colleagues, peers, friends and sometimes complete strangers of the internet. In fact, I think we are at the start of the third biggest trust revolution in the history of humankind; from the monolithic to the individualised.
How much value will personality analysis tools like StumbleUpon or IBMs personality insights have in the future?
Rachel Botsman: Increasingly we will be looking for tools that provide insights in to what someone is really like and predicting future behaviours by looking at digital footprints. For instance, from someone’s blogs, tweets, posts etc. we will be able to extract whether we are say, polite, boisterous, dominating, thoughtful, adventurous, collaborative and so on. It’s an attractive proposition for many. These algorithm-based technologies will help fill a ‘trust gap’ for say recruiters, the void between what they know and don’t know about a candidate. What are their interests? Will they fit into the team? Essentially, it means trusting machines and bots to do things humans used to do; making informed judgements about people. But the key to using these tools is that we look at the details of the information and don’t lose the context or autonomy around making a decision.
How do you think peoples trust is going to evolve towards clearly transparent technologies like blockchain or 100% secure technologies like quantum cryptography in the future?
Rachel Botsman: We experience every day how the internet has transformed the transfer of information - from emails to music. In around five years’ time, we’ll look back and be able to see how blockchain technologies have reinvented the transfer of all kinds of value. I think it’s inaccurate to describe the blockchain as a trust-less technology or as 100% secure. A more accurate description is a transparent truth machine around moving assets.

Cryptography, miners, digital wallets, smart contracts and even the idea of a digital ledger without the need for any central person or company is still a massive trust leap for most people. However, in the same way we’ll get in a self-driving car and let a machine take over the wheel, when we can feel the benefit or experience of the so called ‘killer app’ of the blockchain, millions of people will start to place their trust in encryption technologies. The key to getting people to trust an innovative technology is to focus on the WIFM (What’s in it for me.) For example, people are more likely to invest their trust in a system that protects credit card information and can’t be hacked than ‘quantum cryptography’ (even if that is the tech behind the system.)
If the current development proceeds how and who do you think we will trust within the next ten years?
Rachel Botsman: I think trust is in a state of transition versus crisis. We are in the middle of a very messy period of democracy and a wave of anti-rationalism where it is very difficult to figure out whom to trust. What is the difference between fact and fiction, rumors and fake news? Ironically, trust is trumping the truth. This trust shift is in fact an opportunity for traditional institutions including government, banks and the media to demonstrate they are critical and most importantly, trustworthy. Trust is not a given; it must be earned and sustained regardless of wealth, status or power. I think many institutions will undergo a radical transformation and come out the other side more inclusive and accountable. Well, that is my hope. I also think that the major tech platforms such as Facebook, Amazon, Uber and Google will enter a new age of accountability, working a lot harder to keep their users trust.
Which three persons influenced /inspired you most along your life path? - asked by Hermann Gams, DreamAcademia
Rachel Botsman: The author Michael Lewis. He has a remarkable ability to take complicated and what could be very dry topics such as the in’s and out’s of financial trading and turn them into compelling human stories. Nelson Mandela. As President Obama put it, he is an example of what ‘human beings can do when they’re guided by their hopes and not by their fears.’ I’m also inspired by artists, musicians and athletes who push themselves to their creative or physical limits.
Who can you trust? - book

rachelbotsman.com

About: Rachel Botsman is the world-renowned expert on an explosive new era of trust and technology. An award-winning author, speaker and University of Oxford lecturer, she has contributed to The New York Times, Harvard Business Review, The Wall Street Journal, The Economist, and more. She’ s also a contributing editor at Wired. She has appeared on NPR, CNN, BBC, and will present in the upcoming documentary series for PBS series First Civilizations on the history of trade. Her latest book, Who Can You Trust? How Technology Brought Us Together – and Why It Could Drive Us Apart (Penguin Portfolio, 2017) will revolutionise our perception of trust. She is also the co-author of, What’s Mine is Yours, (HarperCollins, 2010) which defined the theory of collaborative consumption and was named one of TIME’s Ten Ideas That’ll Change the World. Rachel’s TED talks have 4 million views. Monocle named her in the world ’s top 20 keynote speakers.
www.ted.com/rachel botsman we’ve stopped trusting institutions and started trusting strangers
She was named one of the Most Creative People in Business (Fast Company); a Young Global Leader (World Economic Forum) and received the Breakthrough Idea Award (Thinkers50) for a radical idea which has the potential to change the way we think about business forever. She has worked on every continent (except for Antarctica!) and divides her time between Sydney, where she lives with her husband and two children, and London.
#who can you trust#rachel botsman#predicting future behaviour#fake news#personality analysis#DreamAcademia
0 notes
Text
China and Africa - the next manufacturing powerhouse
‘This place is just like my hometown 20 or 30 years ago’ - Chinese entrepreneurs are investing in Africa, seizing market opportunities and creating their business with the same mindset that changed China’s economy within the last two to three decades. Chinese companies built with local partners what they learned to build in China: a global manufacturing powerhouse. Entrepreneurship and foreign investment based on business opportunities rather than aid programmes create jobs and thereby help to lift millions out of poverty. Irene Yuan Sun quit her job at McKinsey to research this topic as it seemed important to her. Only three years later she returned to McKinsey to lead a large-scale research project about Chinese investment in Africa. Irene is the author of ’The Next Factory of the World,’ a book about how Chinese factories in Africa are transforming the future of the continent, which was presented at the Global Peter Drucker Forum. ‘The Dance of the Lions and Dragons’, the report she led at McKinsey about the Africa-China economic relationship was released a few months ago at the World Economic Forum in China.
Interview by Julia Weinzettl

What are the reasons for Chinese entrepreneurs to build factories in Africa? Irene Yuan Sun: Over the last decade thousands of Chinese entrepreneurs have found their way to Africa. Their reasons are - what I call - the push and pull factors. In China itself different kinds of costs are rising, most significantly labour costs, which have been rising at more than ten percent per year for a decade now. Manufacturers in China are finding that their profitability levels are declining. That’s pushing them out of China. Now Africa - at the same time - is pulling in these entrepreneurs because of the outstanding market opportunities today. Manufacturers in Africa make some of the highest margins in the entire world. That’s due in some countries to labor costs that are significantly lower, for example, in Ethiopia. The other reason for the pull effect are market niches that have very little competition. A factory, in eastern Nigeria for example, has hardly any competitive imports or competition from other factories - at least yet. That´s why it´s possible to make very good businesses in these local market niches across the continent.
Are there also Chinese start-ups coming to Africa to build their business? Irene Yuan Sun: Absolutely. There are many examples of successful Chinese start-ups in all kinds of industries, not only manufacturing. ‘StarTimes’ is one of my favorite examples. They acquired a TV-license in Rwanda, a small market, and built that into a business that now spans 30 countries and surpassed DStv as the largest pay-TV business in all of Africa by subscriber volume this year. In China this company has no customers. But in Africa they are a multinational business with subscribers in 30 countries.
How many Chinese entrepreneurs are conducting business in Africa at the moment? Irene Yuan Sun: Right now there are more than 10,000 Chinese firms already operating in Africa. About a third of them - the biggest segment - are manufacturers. Three-quarters of those companies were not in Africa ten years ago. This is a phenomenon that is very much ‘in the now’ and growing in importance. There are the giants, state-owned enterprises like oil and gas or infrastructure companies, but the majority are successful small and medium-sized firms. Almost all of them - around 90 percent - are privately owned, market-driven enterprises.
Are these investments focussed on certain African countries? Irene Yuan Sun: We find Chinese investment in all countries in Africa that have diplomatic relationships with China. This is around 52 countries out of the 54 countries in Africa. It changes a bit year by year but Chinese enterprises are operating everywhere on the continent.
Did digitisation have an impact in building those factories? Are they more advanced now that there has been a leap in technology? Irene Yuan Sun: There is a strong technology transfer element happening with manufacturing investment from China to Africa. About half of the Chinese firms going into Africa are introducing a new product or service into their market and about a third of those companies are doing some sort of technology transfer. This leads to the modernization of production processes and the modernization of markets. Innovation is often thought of as being a tech topic, but for a lot of developing countries production process innovation and mass-oriented innovation in terms of lowering production costs, to make products affordable for more people, are critical for success.
From your point of view, if this development proceeds, what is the perspective for Africa or for certain African countries within the next ten years? Irene Yuan Sun: One common refrain that I hear from Chinese entrepreneurs working in Africa today is that ‘this place is just like my hometown 20 or 30 years ago’. That’s very striking to me, because it indicates how quickly things can change for the better. I personally experienced as a child, growing up in China, a place where you had to have state-issued coupons to buy meat. Beverages like Coke and Sprite were luxury items. No one had a car. This was the reality in China only 25 years ago. The China of today looks completely different, former luxury items are commonplace now. I think that’s the opportunity and a very realistic scenario of what Africa can look like a generation from now. That if Africa industrializes, if it makes smart use of foreign investment from China and from other places, if it regulates these firms in the right way that helps them grow in a way that’s compatible with social interest, we could absolutely be looking at multiple countries in Africa that have a large middle-class and that are participating in the global economy with firms of their own that are globally competitive and employing many people.
Protection of nature and industrialization usually don´t go along very well. Irene Yuan Sun: Yes, that was my opinion as well. In the course of my research I met someone who turned that question around for me. I had the privilege of spending time with Dr. Richard Leakey, a famed conservationist and scientist. He discovered some of the most important fossils of early humans that we have today and he also is the head of the wildlife commission in Kenya, managing Kenya’s wildlife resources, which are considerable. Normally a question like yours is posed as ‘industrialization will be bad for the environment and so how do we deal with that?’. But Dr. Leakey said: ‘What happens to the environment if we don’t industrialize? If we don’t lift millions - in Kenya’s case - tens of millions of people out of poverty? What do you think they are doing to the environment in the mean time? Human development and environmental protection need to be managed hand in hand, because desperate humans are the worst thing that could happen to the environment.’
Obviously there is a lot of work to be done in terms of creating the right regulations, creating inspections, creating the right civil society in order to make sure that the industrial firms are respecting the air, the water and the amazing natural resources in Africa. Nevertheless I think to see industrialization as necessarily the enemy of conservation is short-sighted.
What is your personal motivation? Why did you take up this topic? Irene Yuan Sun: I was born in China and was raised in the US. In high school I became interested in Africa and I studied African history in college. I wrote my undergraduate thesis about Kenyan history and then I moved to Africa with a classic Western-style attitude: ‘I’m a young person and I want to do good for the world!’. So I volunteered as a school teacher in a public school in a rural part of Namibia, in southwestern Africa. Later I joined McKinsey - another fairly Western type of institution. My work at McKinsey included trying to improve public health and other kinds of aid projects in Africa Curiously I was never so interested in China until I realized that China was important for Africa. It was through experiences working in Africa, first as a teacher and then as a McKinsey consultant, that I ran into a lot of Chinese people. They would come up to me and ask me what I was doing there in Chinese. When I asked them about their profession in turn, they would say: „Oh, I run this sort of business... or I’m building this road... or I’m building this stadium…“. It eventually sunk in that what they were doing was really important for the future of this place that I cared so deeply about, which is Africa. And that a lot of people had questions about what China is doing in Africa, but not a lot of people had access to the answers. So I took it upon myself. I quit my job at McKinsey and went to studying this topic full-time. Literally the day that I quit McKinsey, I flew to Nigeria. In Nigeria I slept in a friend’s house and went around meeting as many Chinese entrepreneurs as I could. It was a very boot-strapped endeavor. I looked into this amazing world of crazy entrepreneurs and the very inspiring workers who are working in these factories. The more personal stories I heard the more I realized that this development was a hugely important, interesting and exciting story at the human level that deserved to be told. That’s my journey.
How many people did you interview for your book? Irene Yuan Sun: I ended up interviewing or visiting more than 50 Chinese factories in Africa in the course of writing this book. I also interviewed many of the people in and around those factories: government officials, union officials, but also the workers inside and entrepreneurs. Life is so funny. I left McKinsey because I thought what China is doing in Africa is so important. Later I ended up going back to McKinsey for the same reason. The partners of McKinsey also started to realize that Chinese development was a big deal in Africa. About a year ago I went back to McKinsey to lead a large-scale research project about Chinese investment in Africa. We interviewed more than a thousand Chinese firms across Africa and created a large-scale data set. The report was released a few months ago at the World Economic Forum in China. That report has gotten great attention. Now we are helping clients to figure out how they can seize these opportunities of the China-Africa burgeoning relationship. McKinsey has seven offices in Africa now and a similar number of consultants in Africa as in China. It’s funny how life comes full circle sometimes. I think it’s awesome how the spark of one person, who is really passionate about something, can pull off a huge outcome.
Irene Yuan Sun: Yeah, I’ve been very very lucky. And I’ve had a tremendous amount of help along the way.
I think you put a lot of your heart in there. It’s incredibly rewarding for many people if somebody is courageous enough to follow his/her passion. Irene Yuan Sun: Being at McKinsey is a very privileged job. Four years ago people thought I was crazy when I left. It was such a tiny niche. It’s been amazing to see how more and more people are waking up and realizing that there is an incredible shift happening in the world where China is moving from being a recipient of development aid and developmental advice to being a giver, an example for other countries. There are massive opportunities for all of us, whether it’s Africa or China itself, whether it’s business or government—also for the world. That this is the moment we live in. It’s been amazing to see people of different institutions and different backgrounds waking up to this realization.

Irene Yuan Sun
Podcast Harvard Business Review McKinsey Report - Chinese economic engagement in Africa, June 2017
About: Irene Yuan Sun is a leading expert on the Africa-China economic relationship. She is the author of The Next Factory of the World, a book about Chinese investment in Africa and the opportunity it affords for Africa to industrialize (Harvard Business Review Press, November 2017). The book was shortlisted for the Financial Times’ Bracken Bower Prize for the best business book proposal. Irene also co-leads McKinsey & Company’s research and client work on Africa-China business and economic development. She is the lead author of a major McKinsey report on this topic entitled Dance of the Lions & Dragons, which created the largest fact base to date about the Africa-China relationship. The findings from this report have been featured in the Economist, the New African, CGTN (formerly known as CCTV), and Xinhua. Irene is a graduate of Harvard College, Harvard Business School, and Harvard Kennedy School.
#The next factory of the world#Irene Yuan Sun#Chinese investment in Africa#the dance of lions and dragons#Global Peter Drucker Forum#Harvard Business Review Press#Ecotec#dreamacademia
0 notes
Text
Wirtschaftlicher Erfolg durch Systemüberwindung
‘Wenn Du die Welt verändern willst, beginne bei den Mustern in Deinem Kopf.’
Dieses Statement kam von Ernst Weichselbaum, preisgekröntem Berater, Visionär und Philosoph auf einer Transformation Journey in Marokko. ‘Bestehendes optimieren reicht nicht,’ sagt Weichselbaum auf die Frage nach den Grundlagen zu seinen Überlegungen. Unternehmenserfolg stellt sich mittlerweile nicht mehr einfach ein, wenn man Verbesserungen vornimmt. Systemüberwindung heißt das Zauberwort, das Ernst Weichselbaum propagiert. Seine Erfolge geben ihm recht. Interview von Julia Weinzettl

Foto: Lean knowledge base
Du hast einen komplett anderen Ansatz in der Beratung von Unternehmen.
Ernst Weichselbaum: Die meisten Organisationsprojekte optimieren das Bisherige und geben durchaus professionelle Antworten auf die Frage: ‘Geht es nicht besser?’. Mein Ansatz geht einen Schritt weiter und stellt die Frage: ‘Geht es anders nicht viel besser?’. Diese Fragestellung mobilisiert auch ungewöhnliche, bisher unentdeckte Potenziale eines Unternehmens.
Wie ist Deine Vorgangsweise?
Ernst Weichselbaum: Ich verzichte auf jede klassische Analyse, weil ja der Analysierende im Besitz objektiver Maßstäbe sein müsste, damit er bewerten kann. Stattdessen wechsle ich gemeinsam mit dem Firmeninhaber die Perspektive von der Innensicht zur Außensicht des Unternehmens. Was wünschen sich die Kunden dieser Firma, unabhängig davon, ob es derzeit machbar erscheint oder nicht. Dabei kommt man zu völlig ungewöhnlichen Lösungen, die zu außergewöhnlichen Erfolgen führen. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist das Optimieren der bisherigen Systeme oft zu wenig, deshalb ist Systemüberwindung das Gebot der Stunde.
Kannst Du ein praktisches Beispiel nennen?
Ernst Weichselbaum: Bisher galt die Kapazität eines Unternehmens als fixe Größe. Sie sollte gleichmäßig und maximal ausgelastet sein. Das führt, je nach Auslastung, zu ungleich langen Lieferzeiten für den Kunden. Systemüberwindung bedeutet nun, bisherige fixe Annahmen zu neuen Überlegungen in Wettbewerb zu setzen. Z. B. was wäre, wenn nicht die Auslastung sondern die Lieferzeit eine konstante Größe wäre, hätte das Vorteile? Das Herausarbeiten dieser Vorteile und das Umsetzen dieser Gedanken sind nun typische Projektarbeiten.
Das heißt, dass Firmen, die mit garantierten neun Tagen Lieferzeit für z. B. Fenster, Küchen, Waschbecken usw. werben, von Dir beraten wurden.
Ernst Weichselbaum: Ja, so ist es. Man kann auch mit intelligenten Prozessen Werbung betreiben. Bei diesem System profitieren nicht nur die Firmen mit besseren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, sondern alle am Entstehungs- und Kaufprozess Beteiligten: das Unternehmen, sowie die Kunden als auch die Lieferanten und die Belegschaft durch höhere Transparenz der Prozesse.
Gibt es weitere Beispiele für Systemüberwindung?
Ernst Weichselbaum: Für viele Fachleute ist es zunächst verblüffend, dass man mit Hilfe von Lohnerhöhungen die Lohnstückkosten senken kann.
Wie geht das genau?
Ernst Weichselbaum: Man überwindet zunächst die Idee, dass Unternehmer und Mitarbeiter naturgemäß entgegengesetzte Interessen haben müssen. Man lässt die Angestellten in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich auch ihr Unternehmertum ausleben und teilt den so erzeugten Produktivitätsfortschritt zwischen Unternehmer und Angestellten.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ernst Weichselbaum: ‘Unternehmen’ ist ein scheinbar klarer Begriff. Die meisten Menschen verstehen darunter den Inhalt von Besitzgrenzen, wie er über Bilanzen und an den Börsen dargestellt wird. Man kann aber genauso denken, dass ein Unternehmen all das ist, was sich bewegt, wenn ein Kunde einen Auftrag unterschreibt. Die eine Sichtweise möchte das Innenleben einer Firma gegen den Rest der Welt optimieren, die andere Sichtweise führt zur Stärkung von Netzwerken, die über die Firmen hinausgehen. Diese Grundhaltung kann, mit den gleichen Effekten, ebenso nach innen angewendet werden. ‘Internes Outssourcing’ stellt zwischen Abteilungen eine gleichgestellte Beziehung her, hinterfragt Hierarchien und ist die Grundlage der Fraktalen Organisation. Der Unternehmer ist bei ersterem ein Eigentümer, bei zweiterem ein Interaktionspartner an Nahtstellen zur Erzeugung von Nutzen auf beiden Seiten.
Was bedeutet Nahtstelle? Heißt es nicht Schnittstelle?
Ernst Weichselbaum: Nein. Die Nahtstelle ist der Primäre Ort von Organisation und eine wechselweise Verpflichtung mit konkretem Inhalt. Gibt es in der Organisation einen Schnitt, dann bedeutet das einen Nachteil und Reibungsverluste für beide Partner. Stell Dir einen Schneider vor: wenn er nur Schnittstellen hat, fallen die Kleider vom Körper. Der Zwirn, der beide Teile zusammenfügt, ist die Essenz dieser Verbindung. Nahtstellen sind die Synapsen der Wirtschaft.
Das bedeutet aber, dass der Einkäufer, der seine Lieferanten zu immer niedrigeren Preisen zwingt, auf Dauer kontraproduktiv ist?
Ernst Weichselbaum: Das ist völlig richtig, aber auch der, der stets die höchsten Rabatte gibt, zerstört genauso Wirtschaftsstrukturen.
Das klingt gut, trotzdem müssen sich Unternehmen am Markt durchsetzen.
Ernst Weichselbaum: Durchsetzen kann man sich durch Missbrauch, Macht, Lobbying usw., oder durch die Attraktivität des Angebotes an alle Beteiligten. Dabei geht es sowohl um Lieferanten und Kunden als auch um Unternehmer und Belegschaft.
Und wer bezahlt?
Ernst Weichselbaum: Wenn man die Reibungsverluste durch unterschiedliche Werte, Gedanken, Sprachen, Handlungen vermeidet, lassen sich durchaus marktgerechte, faire Einkaufspreise, entsprechende Löhne und Gewinne vereinbaren.
Wo kann man konkret Geld sparen?
Ernst Weichselbaum: Eines meiner, mit dem Constantinus Award prämierten Projekte, „Swinging Production“ zeigt auf, dass das ganze Unternehmen vom Angebot bis zur Faktura inklusive der Lieferanten im Rhythmus der Kunden zu schwingen hat, denn ungleiche Rhythmen erzeugen Reibungsverluste. Beim Mitschwingen werden an vielen Stellen Lager vermieden und weder Material noch Arbeitsstunden vergeudet, nur weil der jeweilige Kunde Änderungswünsche hat.
Gibt es weitere Beispiele?
Ernst Weichselbaum: Ressourcenverschwendung entsteht oft auch dadurch, dass es eine Arbeitsteilung zwischen einem Verantwortlichen und einem Handelnden gibt. Z. B. hält man den Meister für die Qualität der Arbeit seiner Gesellen verantwortlich. Ich meine aber, nur wer das Loch bohrt, kann für die Qualität des Loches verantwortlich sein. Ein Leitsatz lautet somit: ‘Handlungsstrecke und Beeinflussungsstrecke müssen ident sein, sonst kann es keine unmittelbare Verantwortung geben’. Der Geselle hat das Recht, eben durch Mithilfe des Meisters, zu lernen, wie man ein Loch gerade bohrt. So wird der Meister vom Vorgesetzten zum Dienstleister und seine Anstrengung nachhaltiger.
So gesehen gibt es dann tatsächlich niemanden im Unternehmen, der nicht konkret Verantwortung trägt, und die Verantwortung geht somit über den exklusiven Zirkel der Führungskräfte hinaus?
Ernst Weichselbaum: Das war noch nie anders, es wurde nur immer anders gesehen und dargestellt. Wenn man Führungskraft durch Führungsleistung ersetzt, bekommt das Wort eine ganz andere Bedeutung. Es heißt Leistung erbringen und nicht Kraft ausüben. Jeder kann Führungsleistung erbringen. Wenn es in meinem Unternehmen brennt, bin ich sehr froh, wenn die Feuerwehrleute Führungsleistung erbringen.
Wer gibt denn nun den Rhythmus vor, wenn ein Unternehmen mit dem Markt mitschwingt?
Ernst Weichselbaum: Die ganze Welt schwingt. Die Erde um die Sonne im Jahr, der Mond um die Erde im Monat, und die Erde täglich um die eigene Achse. Auch die Wirtschaft schwingt. Jeder kennt Konjunkturzyklen, Saisoneinflüsse und auch die wiederkehrenden Moden. Hausfrauen beim Kochen und die Bauern beim Wirtschaften leben selbstverständlich im Rhythmus des Lebens und argumentieren nicht mit idealen Losgrößen, Rüstzeiten und Economy of Scale.
Die Konstruktivisten Watzlawick, von Förster, von Glasersfeld waren guten Bekannte von Dir. Haben diese Begegnungen Deine Weltsicht beeinflußt?
Ernst Weichselbaum: Natürlich, denn der Mensch ist das Tagebuch seiner Begegnungen. Mit Heinz von Förster und Ernst von Glasersfeld verbindet mich als ‘Heimatvertriebener’ das gleiche Jugendschicksal. Innerhalb kurzer Zeit lebten wir an verschiedenen Orten und lernten die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln kennen. Dieses Schicksal verhalf uns neue Perspektiven als etwas Alltägliches zu empfinden. Wenn man die Welt nur aus einer Richtung wahrnimmt, hält man alle anderen Sichtweisen oft für falsch. Die Konsequenz daraus ist, dass jenseits der jeweiligen Grenzen immer die Bösen und Blöden wohnen, was für mich eine gefährliche und unmenschliche Lebensanschauung ist.
Welche Entwicklungen können wir, Deiner Meinung nach, in der Zukunft erwarten?
Ernst Weichselbaum: Ich denke, dass wie die „.com“ Blase, auch die Finanzblase platzen wird. Trotzdem bin ich Optimist und glaube, dass eine lebenswerte Zukunft an vielen Stellen schon begonnen hat. Ich sehe, wie einige Wissenschaftler auch, die Vernetzung aller Systeme als vierte industrielle Revolution. Die Netzwerke in der Familie, am Arbeitsplatz zwischen den Firmen und auch zwischen den europäischen Staaten als Vorreiter, werden unser aller Leben genauso nachhaltig verändern wie die anderen drei industriellen Revolutionen durch Mechanik, Elektrotechnik und den Computer. Die bisherigen drei Revolutionen hatten die Entwicklung von Maschinen und deren Weiterentwicklung als Anlass, die vierte Revolution, die Vernetzung, kümmert sich wieder um den Menschen und erzeugt Begegnungsqualität.
Hast Du eine allgemeine Empfehlung?
Ernst Weichselbaum: Nachzudenken über die ‘Jetztheit’. Im Jetzt ist der Augenblick in dem wir einander alles geben können, was wir einander geben können. Mehr geht nicht. Alle schwelgen in der Vergangenheit und fliehen in die Zukunft. Aber jede Interaktion ist eine Jetztheit, die die Welt verändert, wenn auch nur bei der 1.000 sten Stelle hinter dem Komma. Verantwortung entsteht aus diesem Moment. Wenn man die Jahre rückwärts zu zählen beginnt, schreibt man entweder Memoiren oder man verfasst einen kategorischen Imperativ. Ich sage: ‘Verhalte dich so, dass die Summe des Lächelns zunimmt’. Denn beim Lächeln trägt der Mensch die Seele im Gesicht!

About: Ernst Weichselbaum ist Unternehmer in Waidhofen und Mastermind der Weichselbaum-Consulting, einer Beratungsfirma, die mit ungewöhnlichen Lösungsansätzen für mehr als 100 Kunden sehr erfolgreich tätig ist. Derzeit arbeitet er weiters an einer Akademie zum Entlernen. Er wurde mehrfach mit dem Constantinus Award, von der österreichischen Wirtschaftskammer verliehen, ausgezeichnet. Weichselbaum beschreitet bei der Beratung seiner Kunden und in seinen Analysen oft völlig neue Wege und führt die Unternehmen so zu wirtschaftlichem Erfolg und neuer Unternehmenskultur.
0 notes
Text
Quantensprung - Quantenkryptografie oder bye bye Hacker!
Ende September 2017 gab es das erste 100 prozentig abhörsichere Telefonat. Es wurde mittels Quantenkryptografie verschlüsselt. Die Technologie ist in der Entwicklung und dementsprechend teuer, dennoch ist die gelungene Vorführung der Dooropener für ein neues Zeitalter der Verschlüsselung und dem Eintritt der Quantentechnologie in unser Leben - wenn auch vorerst verhalten. Möglichkeiten der Anwendung gibt es im Privacy Bereich, die Nachfrage nach absolut sicherer Verschlüsselung wird mit fortschreitender Entwicklung von beispielsweise self driving cars immer wichtiger. Auch in der Medizin werden bessere Ergebnisse erwartet, wenn die Rechnerkapazität eine andere Dimension erreicht. Der Weg ist noch lange, so Dr. Rupert Ursin, Gruppenleiter und Vize-Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wir sind heute in der Quantentechnologie ungefähr dort, wo die Computerindustrie in den 50er Jahren war. Die theoretischen Grundlagen waren gelegt, aber wir hatten noch keine Ahnung, wie wir in die Umsetzung gehen können. Interview von Julia Weinzettl

Ihr habt das weltweit erste interkontinentale völlig abhörsichere Videotelefonat abgehalten. Zur Verschlüsselung wurde Quantenkryptografie verwendet. Wie funktioniert das?
Dr. Rupert Ursin: Ein chinesischer Satellit hat mittels Quantentechnologie einen Schlüssel nach Graz und einen Schlüssel nach Peking übertragen. Dieser Schlüssel wurde an beiden Orten auf eine Festplatte geschrieben, dann wurde getestet, ob er sicher ist. Der Schlüssel war viele 100 Megabyte groß, das bedeutet es waren viele Überflüge des Satelliten notwendig, um ihn zu generieren. Bei dem Telefonat wurde das Videosignal verschlüsselt und die Kommunikation ganz klassisch über Voice Over IP geführt. Am Schluss ist es eine völlig prosaische Angelegenheit.
Was ist so besonders an dem Quantenschlüssel?
Dr. Rupert Ursin: Die Quantenkryptografie braucht eine eigene Technologie. Bei der Verwendung von herkömmlicher Software Security wie SSL, RSA und HTTPs ist man der Ansicht, dass der Computer eines Hackers nur zehn mal besser sein darf als die Marktüblichen. Dann nimmt man Sicherheit an. Ob es jemanden gibt, der einen Computer mit viel höherer Rechenkapazität hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wenn er ausreichend gut wäre, dann wäre die Verschlüsselung nichts wert. Es ist unbestreitbar, dass die kryptografischen Methoden, die heute verwendet werden, nicht 100 prozentig sicher sind. Die Quantenkryptografie ist sicher, sie ist allerdings auch intrinsisch teuer.
Wie funktioniert Quantenkryptografie?
Dr. Rupert Ursin: Quantenzustände sind Zustände, die ein einzelnes Teilchen trägt. Wenn eine Messung an dem Teilchen vorgenommen wird, ändert sich dadurch der Zustand unweigerlich.
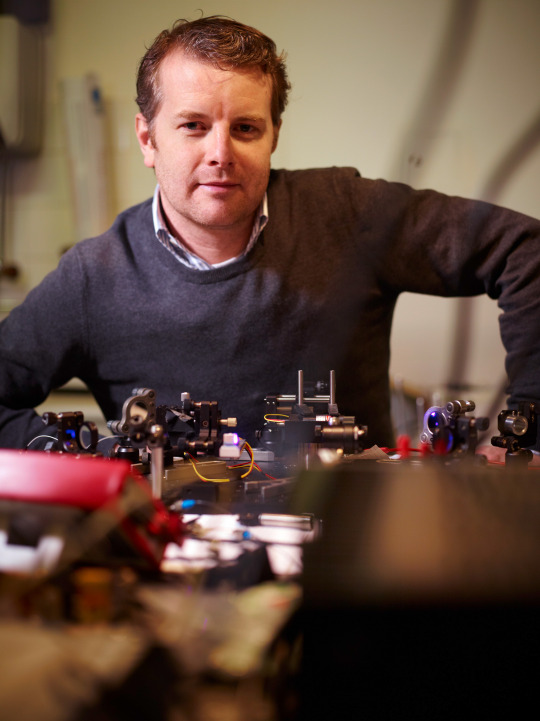
Dr. Rupert Ursin, Gruppenleiter und Vize-Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichische Akademie der Wissenschaften
Wenn ich beispielsweise ein Thermometer in einen See halte, messe ich die Temperatur. Weil das Thermometer im Vergleich zum See so klein ist, ist die Auswirkung vernachlässigbar. Wäre das Thermometer aber so groß wie der See, würde das Thermometer den See durch die Messung verändern. Dieses Verhalten ist in der Quantenphysik so. Das bedeutet, der Messapparat den der Abhörer hat, wird unweigerlich diesen Quantenschlüssel ändern. Das ist feststellbar. In der Kommunikation zwischen zwei Personen verursacht der Abhörer einen Fehler und diese Fehler kann man messen. Das ist bei einer klassischen Verschlüsselung nicht möglich. Man kann bei der Verwendung eines USB-Sticks nicht wissen, ob jemand den Schlüssel kontaminiert hat oder nicht. Ein Quantenzustand ist sehr empfindlich, man muss ihn in der Superposition halten.
Wie bei Schrödingers Katze...
Dr. Rupert Ursin: Genau. Die Kunst ist, diesen labilen Überlagerungszustand zwischen tot und lebendig zu halten. Diese Empfindlichkeit wirft die Schwierigkeit auf, einen Speicher, der tatsächlich nicht misst sondern nur speichert, für den Schlüssel zu konstruieren. Um einen sicheren Schlüssel zu generieren ist diese Empfindlichkeit aber unschlagbar.
Das Generieren solcher Schlüssel ist außerordentlich teurer. Wenn die Entwicklung so fortschreitet und wir einen Blick in die nächsten zehn Jahre werfen, was könnten die ersten Anwendungen für Quantenkryptografie sein?
Dr. Rupert Ursin: Es verlässt wirklich mein Wissen, wer Anwender dieser Kryptografie sein könnte. Der Fakt, dass es Geld kostet, wird dazu führen, dass es der normale Customer vermutlich nicht verwenden wird. Obwohl vor dreißig Jahren sicher jeder gesagt hat, dass man Telefone nicht tragen kann.
Wenn ich heute bei Amazon ein Buch bestelle kostet das 9,90 €. Wenn ein Hacker diese 9,90 € stiehlt, ist quasi kein Schaden passiert. Ich glaube aber schon, dass das zentrale Buchungssystem von Amazon mit seiner Bank quantenkryptografisch verschlüsselt sein will, denn, wenn Milliarden verschwinden, ist es ein Problem für den Konzern.
In einem zweiten Schritt kann ich mir vorstellen, dass diese Verschlüsselung auch am Handy für uns eine ganz normale Sache wird. Wir befinden uns in den Anfangsphasen der Privacy. Ich vergleiche das immer mit dem österreichischen Kaiser. Nach dem ersten Autounfall in Wien hat der Kaiser verfügt, dass vor jedem Auto ein Mann mit einer Fahne gehen soll. Das waren die ersten ungelenken Versuche einen Straßenverkehr zu regeln. Wir wissen, wie kompliziert das heutzutage ist. Unsere Gesellschaft ist derartig frei geworden, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, bevor man postet. Wir werden ein Reglement dafür finden müssen.
Hier gibt es viele Anwendungen für Quantenkryptografie, wenn beispielsweise alle Autos selbst fahren, ist es wichtig, dass es nicht möglich ist die Software zu manipulieren. Ich denke, es ist eine ganze gesellschaftliche Entwicklung notwendig. Wir Physiker liefern nur die technischen Grundlagen. Diese haben mit Digitalisierung und Privacy zu tun. Dabei geht es nicht nur um Kommunikation, sondern auch darum, dass zum Beispiel die Bilder, die ich auf Facebook hinauflade, sicher sind und auch dort bleiben. Das kann die Quantenkryptografie garantieren, denn ein quantenkryptografisch verschlüsseltes Bild kann, auch wenn es von Facebook gestohlen wird, von niemandem gelesen werden, der den Schlüssel nicht hat.
Wir nennen das Backwardsecurity. Selbst wenn sich die Computerindustrie weiterentwickelt und die heutigen Verschlüsselungsmethoden ausgehebelt werden, das quantenkryptografisch verschlüsselte Bild bleibt auch in Zukunft sicher.
Eine weitere Frage ist, was Quantencomputer zu leisten im Stande sein werden. Hier denken wir, dass es möglich ist, chemische Prozess zu simulieren. Wenn wir weit komplexere Systeme simulieren können, steht da natürlich die Hoffnung im Raum, dass das in der Medizin einen Durchbruch bringt. Dort wartet man ja schon lange auf technologische Möglichkeiten, die wir vielleicht liefern können. Das ist wirklich spekulativ, es gibt Versuche Many-Body-Systeme zu simulieren, das sind noch sehr primitive Wechselwirkungen. Die Vision ist allerdings schon da. Dann könnte die Gesellschaft auf mehreren Ebenen davon profitieren, im Sinne der Digitalisierung sowie bei der Heilung von Krankheiten. (grinst) Da lehne ich mich gerade aus dem Fenster, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Wann wird es möglich sein Quantencomputer massentauglich zu verwenden?
Dr. Rupert Ursin: Bei Quantencomputern fehlen noch dramatische Teile. Wir wissen nichtmal ob es einen Unterschied zwischen Software und Hardware gibt. Es gibt noch konzeptionelle Probleme beim Quantencomputer. Kann man den überhaupt programmieren? Wenn ja mit welcher Sprache? Das sind alles Konzepte, die derzeit erarbeitet werden, dafür gibt es noch keine Lösung. Einen skalierbaren und universalen (die heutigen Computer sind mit jeder Software programmierbar) Quantencomputer zu bauen, scheint zwar möglich zu sein, aber wie wir das machen werden, ist unklar. Wir sind ungefähr dort, wo die Computerindustrie in den 50er Jahren war. Die theoretischen Grundlagen waren gelegt, aber wir hatten noch keine Ahnung, wie wir das bauen sollten.
Was passiert, wenn Blockchain auf die Quantentechnologie trifft? Bei Blockchain gibt es viele Visionen, aber es fehlt an der Rechenkapazität um sie umzusetzen.
Dr. Rupert Ursin: Eine Blockchain zu rechnen ist ein anderer Algorithmus, da kann der Quantencomputer heute nicht helfen. Man kann natürlich die Methode zur Berechnung der Blockchains ändern, da gibt es, soweit ich weiss, noch keine effizienten Rechenverfahren. Ein Quantencomputer ist nicht im allgemeinen schneller. Damit bekommt man seine Email auch nicht früher. Er kann aber ganz bestimmte Aufgaben schneller durchführen, wie zum Beispiel die Suche in ungeordneten Datenbanken.
Du hast Dir als Forschungsbereich die Quantenphysik ausgesucht, was fasziniert Dich daran?
Dr. Rupert Ursin: Die Quantenphysik ist zu einem Großteil eine paradoxe Angelegenheit. Man kann sie aus unserer Alltagsphysik heraus nicht verstehen. Dazu kann man sich Paradoxien überlegen und diese auch in Experimenten realisieren. Man sieht tatsächlich, wie der Quantenzustand die Logik verletzt. Das geht zum Teil in anderen Physikfächern auch, aber dazu werden große Maschinen benötigt wie in CERN beispielsweise. In der Quantenphysik können wir mit relativ primitiven Tabletop Experimenten vieles selber machen. Mich fasziniert zu lernen, was die Natur tut. Als Physiker ist es unsere Pflicht das zu verstehen. Ich akzeptiere die Effekte, die die Quantenphysik hervorbringt und staune darüber, aber im nächsten Schritt muss ich auch etwas damit machen. Ich bin ein Experimentator, kein Theoretiker, die ergötzen sich an der logischen Deduktion, an der axiomatischen Herleitung einer Quantenphysik. Das ist ein hehres Ziel, aber es hat in den letzten 100 Jahren noch nicht geklappt. Das ist nicht das, was mir wichtig ist. Ich möchte diese Paradoxien verwenden. Die Quantenphysik ermöglicht neue Technologien, wir versuchen diese nutzbar zu machen damit die Gesellschaft davon partizipieren kann.
https://www.iqoqi-vienna.at/team/ursin-group/rupert-ursin/
About:
Dr. Rupert Ursin ist Gruppenleiter und Vize-Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung von Quantenkommunikations- und Quanteninformationsverarbeitungstechnologien, vor allem für Freiramübertragung bis hin zu Satelliten, aber auch für faserbasierte Systeme. Ziele seiner Arbeit reichen von kurzfristigen Ingenieurlösungen für die sichere Schlüsselaufteilung (Quantenkryptographie) bis hin zu spekulativer Forschung (Entkohärenz verschränkter Zustände in Gravitationsfeldern). Experimente zur Quantenkommunikation und Teleportation mit verschränkten Photonenpaaren gehören zu seinen Interessen, mit dem langfristigen Ziel eines zukünftigen globalen Quantennetzes. Er ist experimentell in zahlreichen internationalen Kooperationen in Deutschland, Italien, Spanien, USA sowie in Japan tätig. Bisher wurden einige seiner Publikationen als jährliche Highlights des britischen PhysikWebs und anderer ausgewählt. Im Jahr 2008 erhielt er den Award für das Telecommunications Advancement Research Fellowship (Nationales Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie NICT, Tokio, Japan) und 2010 den Christian-Doppler-Preis. Er hat mehr als 60 Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie Science und Natur veröffentlicht. Er hat auf mehr als 100 renommierten internationalen Konferenzen eingeladene Vorträge über seine wissenschaftlichen Ergebnisse gehalten. Er ist auch Gastprofessor an der Universität für Wissenschaft und Technologie (USTC) in Shanghai, China.
#Quantenkryptografie#quantencomputer#privacy#security#digitalisierung#Dr. Rupert Ursin#Österreichische Akademie der Wissenschaften
0 notes
Text
Cross Product Innovation - neue Sicht auf Altbewährtes
Was haben Teile in einem Auto mit einem Abseilgerät für Höhenrettung oder der Schischuhschnalle zu tun? - Für uns sind das ganz klare Zusammenhänge, wir entwickeln ein Produkt und überlegen uns wo man es noch anders einsetzen kann, sagt Dr. Christina Rami-Mark, Geschäftsführerin MARK Holding, Spital am Pyhrn. Gefördert wird dieses Mindset durch eine eigene Akademie zur Wissensverteilung, Integration von Augmented Reality in die Lehre und Aufbau eines Technikums zur Prototypenherstellung und kundenunabhängiger Forschung quer durch den Betrieb. Interview von Julia Weinzettl
Dr. Christina Rami-Mark spricht am 12. Okt. 2017 beim Austrian Innovation Forum in Wien.

Welche Ansätze verfolgen Sie zur Förderung des Innovationsklimas im Unternehmen?
Dr. Christina Rami-Mark: Für uns ist der Mut zu neuen Ideen und zum Querdenken ein wichtiger Faktor in unserer Unternehmenskultur. Dabei geht es nicht nur darum Neues zu entdecken, sondern auch Altbewährtes anders zu sehen, in andere Relationen zu stellen und auf diese Art komplett neue Produkte zu entwickeln.
Sie holen sich Inspiration nicht, wie viele Unternehmen aus anderen Industrien, sondern wenden bestehende Ideen auf neue Produkte an, sozusagen Cross Product Innovation statt Cross Industry Innovation?
Dr. Christina Rami-Mark: Unserer Kerntechnologie ist das Tiefziehen, das ist spanloses Zugdruckumformen eines Blechstreifens. Auf diese Art kann man hochpräzise Teile aus einem dünnen Metallstreifen herstellen. Diese Technologie ist in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Wir fertigen zum Beispiel Teile für die Automobilindustrie an, die in Getrieben, Airbags, Einspritzsystemen, Autolampen oder im Motormanagement vorkommen. Mittlerweile haben wir fast 200 Teile in jedem europäischen Auto. Wir sind aber auch Erfinder der Schischuhschnalle und seit neuestem auch eines Rettungsgerätes. Man glaubt auf den ersten Blick, dass diese Dinge nichts miteinander zu tun haben. Für uns sind das aber ganz klare Zusammenhänge, wir entwickeln ein Produkt und überlegen uns wo man es noch anders einsetzen kann.
Welches Produkt ist hier ein Beispiel?
Dr. Christina Rami-Mark: Wir haben zum Beispiel in unserem Höhenabseilgerät die Fliehkraftbremse des Autos verwendet. Die gleiche Komponente wird mit einem anderen Ansatz in einem komplett anderen Feldern angewendet und löst so Probleme das wir sonst nicht lösen könnten. Unser Produkt ermöglicht es Personen, egal wie schwer sie sind und egal aus welcher Höhe, sich mit stets konstanter Geschwindigkeit abzuseilen. Das Prinzip ist das der Fliehkraftbremse in einem Auto, wenn ich in der Kurve bremse oder auf der Geraden brauche ich dabei zweierlei Kräfte.

MARK Save A Life
Das sind sehr unterschiedliche Produkte. Wie steuern Sie Technologietransfer von Abteilung zu Abteilung um zu solchen Ergebnissen zu gelangen?
Dr. Christina Rami-Mark: Wir fördern in unserem Unternehmen die Technologie und den Forschergeist sehr stark. Dazu betreiben wir eine MARKakademie. Dort stellen wir allen Mitarbeitern alle Prozesse und unser Wissen und Können zu Verfügung. Die Kurse werden von unseren Mitarbeitern selbst gehalten. So verteilen wir unser Know-how auf ganz viele Köpfe. Zusätzlich gibt es Meetings in denen Forschung, Sales, Geschäftsleitung sowie Konstruktion und Simulation zusammensitzen und neue Ideen entwickeln. Wir versuchen die Wissensträger in verschiedenen Bereichen an einen Tisch zu bekommen und überlegen uns die strategische Weiterentwicklung. Wir haben einen hauseigenen Maschinenbau und konstruieren die Maschinen, die wir zur Produktion neuer Produkte benötigen, selbst. Wir bauen dabei nicht nur die Werkzeuge sondern die kompletten Maschinen wie beispielsweise Prüfautomaten, bei denen es um Hochtechnologieanwendungen geht. Wir entwickeln auch die Software, die wir benötigen und sind so kaum von anderen Unternehmen abhängig. Die Ideen, die wir ausarbeiten, können wir selbst als Prototypen mit finiten Elementen oder anderen Simulationsverfahren simulieren. Wir konstruieren diese Teile dann mit unserem eigenen Werkzeugbau oder unserer maschinellen Fertigung. Weiters bilden wir unsere Mitarbeiter und Facharbeiter selber aus und beschäftigen jedes Jahr durchschnittlich 35 Lehrlinge.
In vielen Produktionsbetrieben herrscht Angst um den Verlust des Jobs aufgrund der Digitalisierung und dem vermehrten Einsatz von Robotern. Wie werden diese Themen bei Mark behandelt?
Dr. Christina Rami-Mark: Ich glaube, dass die Mitarbeiter in unserem Unternehmen keine Angst vor Robotik oder der Digitalisierung haben. Wir haben gerade unseren Standort in Spital am Pyhrn um 10.000 m2 erweitert und betreiben jetzt ein 20 Meter hohes, vollautomatisches Hochregallager. Wir haben Mitarbeiter, die 56 Jahre alt sind und jetzt den Computer bedienen, der vollautomatisch die Teile dort einlagert und wieder herausholt. Sie sind begeistert und sehen eigentlich nur den Nutzen der Digitalisierung, denn sie müssen die Paletten nicht mehr suchen sondern können sich weiterentwickeln und haben einen erleichterten Arbeitsablauf. Ich glaube, es geht darum die Technologie für sich selbst zu nutzen und nicht darum, dass die Technologie uns die Arbeitsplätze wegnimmt. Die Schritte, die man automatisieren kann, wie zum Beispiel mechanische Bearbeitungen in der Nachtschicht von Robotern durchzuführen, werden vermehrt auftreten. Da setzen wir auch ganz stark darauf, weil uns das die Möglichkeit bringt, über Kostenersparnis den Standort in Österreich weiter zu erhalten und das Abbauen der Technologien nach Indien und China zu verhindern. Dadurch können wir auch direkt Arbeitsplätze schützen. Die ultrapräzisen Arbeitsschritte, die wir machen, können niemals von Robotern oder anderen Technologien abgelöst werden. Ich glaube geht es vielmehr um Synergien und Zusammenarbeit. Zum Beispiel können wir, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, durch digitale Simulationen die Leute an der Werkbank auf die kritischen Stellen vorbereiten, auf die sie sich dann konzentrieren. Wir sind gerade dabei in unsere Lehre Augmented Reality aufzunehmen. So können die Lehrlinge schon vorher am Zusammenbau von virtuellen Teilen üben, bevor sie im Produktionsalltag anfangen. Wir bauen gerade ein Technikum auf damit unsere Forschungsabteilung mit den Arbeitern aus der Produktion und den Lehrlingen gemeinsam neue Dinge entwickeln können, wie beispielsweise Prototypenbau oder kundenunabhängige Forschung, damit wir auf diese Weise weiter innovativ in die Zukunft arbeiten können.
Welche Jobs werden Sie in Zukunft benötigen, die heute noch keinen Namen haben?
Dr. Christina Rami-Mark: In Zukunft werden Leute, die theoretisches und praktisches Wissen vereinen können, immer wichtiger. Wir haben um auch in Zukunft die besten Mitarbeiter zu bekommen, gemeinsam mit vier anderen Firmen, eine Schule in unserem regionalen Bereich gegründet, die KTLA. Die Schüler haben ein duales Lernsystem, sie sind 3 Tage bei uns im Betrieb und machen eine Lehre, die anderen zwei Tage machen sie eine HTL. So entwickeln wir die perfekten Facharbeiter. Sie wissen genau wie unser Werk läuft und wo die Probleme enthalten sind. Gleichzeitig verstehen sie die Technologie dahinter und können die Probleme lösen. An der Universität zu lernen ist eine Sache, das theoretische und praktische Wissen zu vereinen ist aber das was uns in Zukunft besonders macht.
www.mark.at www.savealife.at www.markhydraulik.at www.ktla.at

Dr. Christina Rami-Mark, Geschäftsführerin MARK Holding, Spital am Pyhrn About: Dr. Christina Rami-Mark hat sich nach der Dissertation in Chemie von der Hirnforschung zurück in den Familienbetrieb begeben. Als Geschäftsführerin der MARK Gruppe und Projekt-Portfolio-Managerin hat sie die Chance ergriffen innovative Produkte (weiter-) zu entwickeln. Mittlerweile sorgen in jedem europäischen Auto etwa 200 Einzelteile von MARK dafür dass Sie sicher von A nach B kommen.
0 notes
Text
Genetik meets Innovation
Der Mensch ist nicht nur auf seine Gene reduzierbar sagt Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger, Leiter des Instituts für Medizinische Genetik. Gene sind die Grundausstattung, wie Talente entdeckt und gefördert werden bestimmt letztendlich wieviel wir aus unseren Grundvoraussetzungen machen oder machen können. Denn, das Bildungssystem fördert den Durchschnitt und keine Begabungen, kritisiert er. Um aber zu großen Lösungen und Erfolgen zu kommen bedarf es Teamarbeit und den gezielten Einsatz von inter- und intrapersonellen Skills. Interview von Julia Weinzettl

Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger, Leiter des Instituts für Medizinische Genetik
Prof. Hengstschläger spricht am 12.10. 2017 am Austrian Innovation Forum in Wien.
Sie sind preisgekrönter Genetiker, dennoch hat eines Ihrer wichtigsten Themen, die Abwendung vom Durchschnitt, und die Erkenntnis und Anwendung der eigenen Talente, gar nichts mit Genetik zu tun. Wie verbinden Sie die beiden Themen?
Prof. Markus Hengstschläger: Wieviel Talent angeboren ist und welchen Einfluss die Umwelt hat, ist die wahrscheinlich am stärksten diskutierte Frage dabei. Ich sage: der Mensch ist bei seinen Talenten auf jeden Fall nicht auf seine Gene reduzierbar. Gene sind nur Bleistift und Papier, die Geschichte schreibt jeder selbst. Ohne Übung geht nichts, aber Üben führt nicht bei jedem zum Gleichen- weil jeder eben auch genetisch individuell ist.
In Ihrem Buch 'Die Durchschnittsfalle' zeigen Sie auf, dass es falsch ist, Kinder an ihren Fehlern zu messen und Wert darauf zu legen, dass sie sich in Gegenständen mit schlechteren Noten verbessern, anstatt zu versuchen sie in ihren Talenten zu fördern. Ich finde Sie haben recht, meine Frage ist: Wo sollte die Grenze gezogen werden? Ab wann würde dann Information vernachlässigt, die oft notwendig ist um Querverbindungen zu ziehen oder kreative Impulse zu geben?
Prof. Markus Hengstschläger: Ich bin ein starker Anhänger davon, dass jeder ein gutes und breites Bildungsspektrum erfährt. Meine Angst ist ja nur, dass Kinder einfach zu sehr ausschließlich mit dem Ausbessern ihrer Schwächen beschäftigt werden und ihnen dadurch einfach zu wenig Zeit und Lust bleibt ihre Stärken zu stärken und diese kreativ und innovativ einzusetzen.
Unternehmen sollen die inter- und intrapersonellen Skills der Mitarbeiter stärken um einen höheren Gehalt an Innovation und Kreativität ins Unternehmen zu bringen. Was sind die Benefits, wie sollen diese Skills gefördert werden?
Prof. Markus Hengstschläger: Intrapersonelle Intelligenz steht bei mir dafür, dass jeder möglichst viel über sich selbst wissen sollten: wo sind meine Stärken und Schwächen, was will ich und was nicht? Interpersonelle Intelligenz steht für Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, Empathie etc. Große Lösungen und Erfolge werden im Team erarbeitet.
Ausblick: 10 Jahre in der Zukunft - welche Änderungen, Verbesserungen wären in Ihrem Bereich möglich?
Prof. Markus Hengstschläger: In der Life Science hoffe ich, dass die ersten Patienten mit somatischer Gentherapie oder neuen Stammzelltherapien behandelt werden können. In der Bildungsfrage wünsche ich mir, dass jedes Kind, unabhängig vom Einkommen seiner Eltern, eine faire Chance hat, dass seine individuellen Talente entdeckt und gefördert werden.
Welche Jobs werden wir aus Ihrer Sicht in Zukunft benötigen, die heute noch keinen Namen haben?
Prof. Markus Hengstschläger: Wie kann ich das wissen? Ich weiß lediglich, dass junge Menschen, die ihre inter- und intrapersonellen Intelligenzen mutig einsetzen um alte Wege zu verlassen und Neue zu gehen, unsere größte Ressource für die Zukunft sind.
http://www.meduniwien.ac.at/medizinische-genetik
About: Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger arbeitete er an der Yale University in den USA und wurde mit 35 Jahren zum Universitätsprofessor berufen. Heute leitet er das Institut für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien und ist auch als Unternehmer in den Bereichen genetische Diagnostik, Forschung und Entwicklung und Innovationsberatung tätig.
0 notes
Text
Optogenetic- Technologie für potentere Medikamente
Die Optogenetik erlaubt es, genetisch identifizierte Zellen durch Licht zu steuern. Gero Miesenböck, Waynflete Professor of Physiology und Director des Centre for Neural Circuits and Behaviour an der Universität Oxford, erforscht an Fruchtfliegen grundlegende Fragen der Gehirnfunktion, beispielsweise die Regulation des Schlaf-Wachrhythmus. Diese Einsichten könnten es ermöglichen, nach massgeschneiderten Substanzen zu suchen, welche die Funktion bestimmter Schlüsselmoleküle in diesen Zellen gezielt beeinflussen. Solche neuen Medikamente haben das Potenzial, potenter und ärmer an Nebenwirkungen zu sein als derzeit erhältliche Pharmazeutika. Professor Miesenböck spricht am 25.8.2017 beim Technologiesymposium in Alpbach. Interview von Julia Weinzettl

Light Simulation
Sie gelten als Begründer der Optogenetik, was kann man sich darunter vorstellen?
Prof. Dr. Miesenböck: Optogenetik ist eine Technologie, die es erlaubt, genetisch identifizierte Zellen im intakten Gehirn durch Licht zu steuern. Die zwei essentiellen Bausteine dieser Technologie sind die Genetik, die benutzt wird, um die Zellen so zu verändern, dass sie auf Licht empfindlich reagieren, und die Optik, die es erlaubt, die elektrischen Impulse der Nervenzellen durch Licht zu steuern. Wir haben in unseren Augen lichtempfindliche Zellen. Das Grundprinzip der Optogenetik ist es, Zellen, die normalerweise nicht lichtempfindlich sind, zu Fotorezeptoren zu machen. Dazu transplantieren wir genetisch lichtempfindliche Moleküle, ähnlich den Lichtrezeptoren in unseren Augen, in diese Zellen. Für unsere Experimente verwenden wir vornehmlich Fruchtfliegen, da wir hier die Möglichkeit haben, viele genau definierte Nervenzelltypen genetisch anzusteuern. Wenn man das ganze Tier beleuchtet, dringt genügend Licht durch das äußere Chitinskelett, um auch Nervenzellen tief im Gehirn zu aktivieren. Das Tier wird in der Keimbahn genetisch so verändert, dass bestimmte Zellen im Gehirn diese Lichtrezeptoren enthalten und somit optisch steuerbar werden. Das ist der Trick - die Genetik löst das ‘Stecknadel im Heuhaufen Problem’, unter den 100 000 Zellen bei der Fliege (oder den 100 Milliarden Zellen beim Menschen) die richtigen Neuronen herauszufinden und durch Licht anzusteuern. Verschiedene Typen von Nervenzellen im Gehirn schalten bestimmte Gene ein und aus. Wir koppeln die Produktion der lichtempfindlichen Moleküle an dieselben genetischen Schalter, welche die Identität der Zellen bestimmen. Dadurch ist es möglich, dass man nur ganz bestimmte Zellen ansteuert, wie zum Beispiel bei der Fliege die Zellen des Flugmotors. Oder beispielsweise auch Zellen, die für das Einschlafen oder Aufwachen verantwortlich sind, die für das Empfinden, dass eine Handlung zu einer Belohnung oder Bestrafung geführt hat, zuständig sind oder auch für den Ausdruck des sexuellen Balzverhaltens.
Ist es medizinisch möglich, aufgrund der Beeinflussung der Zellen auch beispielsweise eine Suchtprävention vorzunehmen?
Prof. Dr. Miesenböck: Von der direkten medizinischen Anwendung sind wir noch ein Stück entfernt, denn ein wichtiger Baustein dieser Technologie ist die genetische Veränderung. Das bedeutet, um die Forschungsergebnisse direkt beim Menschen einzusetzen, müsste man das menschliche Gehirn so verändern, dass bestimmte Zellen lichtempfindlich werden. Das ist eine Form der Gentherapie. Doch die zur Optogenetik nötigen genetischen Eingriffe unterscheiden sich wesentlich von den ‘Standardformen’ der Gentherapie. Deren Ziel ist es, ein defektes menschliches Genprodukt durch ein korrektes Genprodukt derselben Art zu ersetzen. Im Fall der Optogenetik würde man ein fremdes Genprodukt, nämlich dieses lichtempfindliche Molekül, einführen. Das ist komplizierter als die Reparatur eines defekten Gens.
Das Große Potenzial der Optogenetik liegt zur Zeit in der Identifikation der Zellen, die für bestimmte Aspekte unseres Denkens oder Verhaltens verantwortlich sind. Wir erforschen das, indem wir die Zellen ein- und ausschalten und dann die Konsequenzen dieser Intervention auf das Verhalten oder das Denken beobachten.
Was wären hier Anwendungsgebiete?
Prof. Dr. Miesenböck: Derzeit arbeiten wir an der neuronalen Steuerung von Schlaf-Wach Zuständen und haben Zellen im Fliegenhirn, die ganz deutliche Parallelen zum Gehirn des Menschen haben, identifiziert. Wenn wir diese Zellen ein- und ausschalten, versetzen sie das Tier entweder in Dauerschlaf oder halten es ständig wach. Wenn man die normale Funktion dieser Zellen und die normalen Signale, die diese Zellen ein- und ausschalten, bestimmt, erhält man Erkenntnisse über die biologische Rolle des Schlafs. Die Experimente bringen Verständnis darüber, wo man medikamentös ansetzen muss. In den meisten Fällen weiß man heute eigentlich gar nicht, wo die wirksamsten Angriffspunkte für medikamentöse Therapien sind und welche Zellen wirklich die Entscheidenden sind. Wenn man wüsste, was die wichtigsten Zellen und die wichtigsten Moleküle in diesen Zellen sind, dann könnte man natürlich nach maßgeschneiderten Substanzen suchen, die die Funktion dieser Moleküle in diesen Zellen gezielt beeinflussen. Diese Medikamente wären viel potenter und auch ärmer an Nebenwirkungen als derzeit erhältliche Pharmazeutika.
An welchen Tieren forschen Sie?
Prof. Dr. Miesenböck: Mein Labor beschäftigt sich mit Fruchtfliegen. Das Ziel dieser Forschung ist, fundamentale Gehirnprozesse zu entschlüsseln, die allen Tieren gemeinsam sind. Wie erwähnt gilt dies beispielsweise für den Schlaf-Wach Schalter, der in ganz ähnlicher Weise funktioniert wie beim Menschen, aber bei Fliegen um vieles einfacher zu erforschen ist. ‘Einfache’ Systeme wie die Fruchtfliege erlauben grundlegende Einsichten in biologische Funktionen, die dann aber generelle Gültigkeit für andere Lebewesen haben.
youtube
Optical Activation
Wie denken Sie wird sich die Optogenetik in zehn Jahren weiterentwickelt haben?
Prof. Dr. Miesenböck: Im nächsten Jahrzehnt werden wir einen kompletten Zensus der verschiedenen Nervenzelltypen im Gehirn erstellen. Derzeit ist es immer noch eine offene Frage, wie viele Klassen von Neuronen es gibt und welche Rollen diese verschiedenen Klassen von Nervenzellen in den verschiedenen Gehirnfunktionen ausüben. Wir werden mehr über diese Rollen wissen, indem wir die verschiedenen Zelltypen gezielt ein- und ausschalten und immer genauere Verhaltensmessungen vornehmen. Die große Lücke - und die wird weder durch Technologie noch durch immer größere Datenmengen zu schließen sein - ist jedoch ein theoretisches Verständnis des Gehirns. Derzeit gibt es nicht einmal ein unvollständiges theoretisches Gebäude, an dem sich unsere experimentellen Forschungen orientieren könnten. Wir stochern noch viel mehr im Dunkeln herum als zum Beispiel die Physiker. Ich glaube natürlich, dass es auch allgemeine Prinzipien in der Biologie geben wird und vor allem auch in der Neurobiologie. Wir werden beispielsweise wissen, wie bestimmte Schaltkreise gebaut sein müssen, damit sie bestimmte Operationen, wie ein Signal zu verstärken, zwei Signale zu vergleichen, ein Signal über Zeit hinweg zu mitteln und überhaupt Zeit im Gehirn zu kodieren, durchführen können. Ich glaube, die fundamentalen Fragen sind: Was sind die kanonischen Schaltkreise, die nicht nur unserem Gehirn, sondern jedem Gehirn ermöglichen, diese Art der mathematischen Operationen vorzunehmen.
Was ist Ihr langfristiges Forschungsziel?
Prof. Dr. Miesenböck: Mein Traum ist, dass man die meisten der Vorgänge, die heutzutage in der Domäne der Psychologie oder der Kognitionswissenschaften angesiedelt sind, auf biophysikalische Prozesse reduziert. Zu verstehen, welche physikalischen Vorgänge im Gehirn diesen mentalen Ereignissen zugrunde liegen. Die meisten Neurowissenschaftler würden zustimmen, dass unser gesamtes Selbstverständnis, unsere emotionale und geistige Welt aus physikalischen Vorgängen in unserem Gehirn entsteht. Es ist ein materialistisches Weltbild: unsere Intelligenz entspringt physikalischen Vorgängen in der Materie unsres Gehirns. Aber wie genau dieser Sprung von der unintelligenten Materie zur Intelligenz vor sich geht - das ist die große Frage, die wir zu beantworten suchen.
Würde diese Erkenntnis nicht die Psychologie eliminieren und alles, was wir über zwischenmenschliche Beziehungen gelernt haben, für null und nichtig erklären?
Prof. Dr. Miesenböck: Ich glaube nicht, dass es sie eliminieren würde oder den Reichtum unserer zwischenmenschlichen Beziehungen in irgendeiner Weise beeinträchtigen würde. Im Gegenteil, ich denke, es würde uns immens bereichern und unser Selbstverständnis grundlegend verändern, wenn wir wüssten, welche physikalischen Vorgänge unserer Psychologie zugrunde liegen.

Prof. Dr. Gero Miesenböck, Waynflete Professor of Physiology und Director des Centre for Neural Circuits and Behaviour an der Universität Oxford
About: Gero Miesenböck (* 15. Juli 1965 in Braunau am Inn) ist ein österreichischer Neurophysiologe. Er gilt als einer der Pioniere des wissenschaftlichen Forschungsgebiets der Optogenetik. Miesenböck studierte an der Universität Innsbruck Medizin. Er wurde 1991 sub auspiciis Praesidentis rei publicae mit der Dissertationsschrift Relationship of triglyceride and high-density lipoprotein metabolism promoviert. Als Postdoktorand arbeitete er von 1992 bis 1998 bei James Rothman am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City.
1999 erhielt er eine Assistenzprofessur für Zellbiologie und Genetik und für Neurowissenschaften an der Cornell University in New York; 2004 ging Miesenböck als Associate Professor für Zellbiologie und für Zelluläre und Molekulare Physiologie an die Yale University School of Medicine in New Haven, Connecticut. 2007 erhielt Miesenböck einen Ruf an die University of Oxford als Waynflete Professor für Physiologie. 2011 wurde er Gründungsdirektor des dortigen Centre for Neural Circuits and Behaviour.
Ab 1999 legte Miesenböck die Grundlagen der Optogenetik, mit deren Hilfe sich Neuronen mittels Licht selektiv aktivieren lassen. Miesenböck befasst sich mit neuronalen Erregungskreisen, die er überwiegend am Modellorganismus der Drosophila melanogaster studiert. Hierbei sucht er nach den elementaren Schaltkreisen, die Vorgänge wie Informationsintegration über längere Zeitintervalle, die Anwendung von Schwellenwerten bei der Entscheidungsfindung, Fehlersignale oder Informationsspeicherung realisieren. Optogenetische Techniken erlauben dabei, mit hoher Genauigkeit bestimmte Gruppen von Neuronen zu aktivieren, die für bestimmtes Verhalten verantwortlich sind, und Erregungskreise von Neuronen zu erkennen und Hypothesen über ihre Funktionsweise zu testen.
0 notes
Text
Mensch-Maschine-Interaktion - wohin gehen wir?
,Das Thema Mensch-Roboterinteraktion in der Produktion hat einen Durchbruch erreicht, sagt Prof. Dr. Alin Albu-Schäffer, Direktor des Instituts Robotik und Mechatronik am DLR und Leiter des Lehrstuhl für Sensorbasierte Robotersysteme und intelligente Assistenzsysteme, TUM. Das heißt konkret, dass gewisse Tätigkeiten nicht mehr entweder von Menschen oder Maschinen durchgeführt werden, sondern von einem Team aus Robotern und Menschen. Wir sind an einem Punkt angelangt bei dem die technische Machbarkeit nicht mehr der einzige relevante Faktor ist, ethische Aspekte werden vor allem in den Bereichen autonomes Fahren oder Assistenzsysteme in der Altenpflege miteinbezogen.
Interview von Julia Weinzettl
Prof. Albu-Schäffer spricht am 24.8.2017 am Technologiesymposium beim Europäischen Forum in Alpbach

Wie wird sich unser Alltag durch neue autonome Systeme verändern? - ein Blick in die Ereignisse der nächsten zehn Jahre
Prof. Alin Albu-Schäffer: Wir sehen jetzt schon, dass in Fabriken, vor allem im Produktionsbereich, große Veränderungen passieren. Es werden immer mehr autonome Systeme und Roboter, die mit Menschen interagieren, eingesetzt. Dieser Trend hat sich in den letzten drei bis vier Jahren herausgebildet, wir forschen allerdings schon seit zwanzig Jahren in diesem Bereich. Es sind daher relativ lange Entwicklungszyklen, die diesem Prozess vorangehen, aber jetzt hat das Thema Mensch-Roboterinteraktion in der Produktion tatsächlich einen Durchbruch erreicht. Das heißt, dass - konkret zum Beispiel in der Automobilproduktion - die Getriebeherstellung nicht mehr entweder von Menschen oder Maschinen durchgeführt wird, sondern von einem Team aus Robotern und Menschen und dass die Materialzuführung über autonome Systeme stattfindet. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren intensivieren.
Wie wirkt sich die Automatisierung auf andere Bereiche aus?
Prof. Alin Albu-Schäffer:
Im persönlichen Bereich konnte man einige Produkte wahrnehmen wie Staubsauger- und Rasenmäher-Roboter beispielsweise. Der nächste große Schritt wird ist das autonome Fahren, ob das jetzt als Robotik bezeichnet wird oder nicht. Alle großen Automobilhersteller haben Pläne in den nächsten zehn Jahren fast vollständigen autonom fahrende Autos zu entwickeln. Die Entwicklung wird in Form eines Stufenplans verlaufen. Es wird zunehmend viele Assistenzfunktionen geben, aber alle Hersteller haben das Ziel bis 2025 autonom zu fahren. Für den Alltag bedeutet das, dass man sich am Abend im Restaurant vom autonomen Taxi abholen lassen kann.
Ein großes Thema, an dem wir zurzeit intensiv arbeiten und gerade ein zweites großes Projekt in Bayern starten, ist Assistenzrobotik im Alter. Wir haben in Deutschland ein demografisches Problem: Die jahrgangsstarken Jahrgänge gehen in zehn bis fünfzehn Jahren in Rente, die nächste Generation ist deutlich kleiner - mit einem ein Unterschied von einer halben Million Menschen pro Jahrgang. Es gibt etliche Pflegegipfel in denen darüber diskutiert wird, wie man mit der Pflege in den nächsten zwei Jahrzehnten umgeht. Ganz klar ist, wenn man Leuten helfen kann ein oder zwei Jahre länger zuhause zu bleiben und mehr Selbstständigkeit mit Hilfe von Assistenzsystemen zu behalten, wäre das ein großer Zugewinn. Dieses Thema wird natürlich auch aus unterschiedlichen ethischen Aspekten diskutiert. Interessant ist aber, wenn man betroffene Personen fragt, sagen alle: ‘Wenn ich einen Roboter hätte, der mir hilft einfache Dinge zu bewerkstelligen, wie Sachen vom Boden aufzuheben oder die Küche zu putzen, dann würde mir das sehr helfen.’ Im Pflegealltag haben ältere Menschen oft nur ein paar Stunden am Tag Unterstützung und sind sonst auf sich selbst angewiesen. Ob dieses Thema einen breiten Durchbruch in zehn Jahren erreichen wird ist noch unklar, ich glaube aber fest daran, dass künftig Haushaltroboter eingesetzt werden, die einem beim Putzen und Aufräumen helfen werden, aber auch in medizinischen Notfällen eingreifen können. Auch diese Entwicklung wird schrittweise vorangehen.
Ein dritter Bereich, in dem Roboter jetzt schon vermehrt eingesetzt werden, ist die Medizin oder Medizintechnik. In der Chirurgie werden heute schon Roboter, die von Chirurgen ferngesteuert werden, erfolgreich eingesetzt. Dieser Anwendungsbereich wird sich deutlich verstärken. Im Krankenhausbereich arbeitet man an mobilen Robotern und autonomer Zulieferung von Essen.
Das sind die Hauptbereiche von denen ich denke, dass sie den größten Einfluss in den nächsten Jahren haben werden. Wobei Robotik im Haushaltsbereich vermutlich als letztes am Massenmarkt den Durchbruch erleben wird, da hier der Preisdruck sehr gross ist. Für einen Preis von zum Beispiel 20.000 Euro wird im Haushalt schon sehr viel von einem Roboter erwartet. Ein Chirurgieroboter hingegen kann eine Million Euro kosten, wenn er tatsächlich effizient ist und Leben rettet.
Gibt es Pläne in der Altenpflege die Anschaffung von Robotern zu subventionieren?
Prof. Alin Albu-Schäffer: Ich denke, dass derzeit wir für ältere Personen Assistenzsysteme entwerfen, die sie tatsächlich unterstützen. Wenn der Mehrwert gegeben ist, dann werden vermutlich auch Modelle entstehen, bei denen die Krankenkasse oder Pflegekassen subventionieren. Der Hauptkritikpunkt ist ein Ethischer. Man argumentiert, dass die Leute verwahrlosen, wenn sie nur mehr mit Maschinen interagieren. Ich glaube aber, dass genau das ist ja nicht der Fall ist. Es geht darum im Alltag für die einfachsten Handhabungen Unterstützung zu bekommen. Man muss hier klar unterscheiden, ein Roboter ist natürlich kein Ersatz für die menschliche Interaktion, aber er ist in seinen Assistenzfunktionalitäten sehr hilfreich.
Es geht nicht mehr nur darum was technisch möglich ist, sondern die ethischen Aspekte sind zu einem wichtigen Entscheidungsfaktor geworden. Ist die Beachtung von ethischen Fragen ein Thema, dass Sie in ihre wissenschaftliche Arbeit miteinbeziehen?
Dr. Alin Albu-Schäffer: In den letzten fünf Jahren haben wir uns intensiv an den unterschiedlichsten Workshops und Symposien beteiligt, die die ethischen Aspekte in Betracht ziehen. Ich bin jedes Jahr bei drei bis fünf Veranstaltungen an denen Soziologen, Juristen und Personen aus der Pflege teilnehmen. Diese Veranstaltungen finde ich sehr wichtig, denn es ist ganz klar, dass solche Entscheidungen in einem öffentlichen Diskurs herausgearbeitet werden müssen, um zu definieren wo die Grenzen und ethischen Linien liegen.
Eine oft diskutierte ethische Frage, beispielsweise im Bezug auf autonomes Fahren, wäre: Soll ein selbstfahrendes Auto - wenn es in einer engen Straße keinen Ausweg gibt - in ein Kind, einen Radfahrer oder in eine Mauer fahren und dadurch das Leben der Insassen gefährden?
Prof. Alin Albu-Schäffer: Ein ethischen Dilemma ist dadurch definiert, dass es keine zufreidenstellende Lösung hat. Das Dilemma zu konstruieren und sich dann den Kopf zu zerbrechen, wie man es löst ist eine interessante Übung, aber in der Praxis wird es tatsächlich ganz anders sein. Es wird erstmal darauf ankommen, ob man nachweisen kann, dass autonome Fahrzeuge die Unfallrate um einen Faktor Zehn oder mehr verringern können. Wenn das der Fall ist, werden sich autonome Fahrzeuge durchsetzen. In Deutschland sterben nach wie vor über 3.000 Personen pro Jahr im Straßenverkehr, wenn man diese Zahl auf 300 reduziert, wird man immer noch 300 tödliche Unfälle haben. Vielleicht wird dann ein Unfall pro Jahr so ein Dilemma sein. Natürlich muss man sich der ethischen Fragen annehmen, weil man, im Gegensatz zum impulsiven Verhalten des Menschen, bei einem Fahrzeug in voraus so eine Entscheidung einprogrammieren muss. Aber die Unfälle werden vermutlich nach wie vor nicht vorwiegend wegen Dilemmatafällen entstehen, sondern weil vielleicht doch hin und wieder die Technik versagt. Die viel wahrscheinlicheren Ursachen für Unfälle sind, dass die Technik nicht immer 100% funktioniert.
Welche Jobs werden in Zukunft in der Robotik benötigt, die heute noch keinen Namen haben?
Prof. Alin Albu-Schäffer: Die Robotik ist ein Schmelztiegel und höchst interdisziplinär. In unseren Teams sind die klassischen Ingenieursdisziplinen wie Maschinenbau und Elektrotechnik vertreten ebenso wie Informatiker und Biomediziner. Wir beschäftigen zusätzlich Psychologen und Designer. Designer im Sinne der äußeren Gestaltung des Roboters sowie auch Interaktions- und Prozessdesigner. Die Anforderungen sind extrem breit gefächert, denn man will ja eine Maschine bauen, die bestimmte Fähigkeiten des Menschen nachbildet. Das spannende an der Robotik ist, dass wir primär versuchen den Menschen zu verstehen und dieses Verständnis anhand technischer Systeme verifizieren. Wir forschen daher ebenfalls an den Schnittstellen zum menschlichen Körper, an den Funktionalitäten der Muskelströmen und leiten Daten aus den Nerven und dem Gehirn ab, um zum Beispiel Prothesen direkt anzuschließen. Da verschwindet manchmal auch die Grenze zwischen den technischen Systemen und der Biologie.
http://www.robotic.de/Alin.Albu_Schaeffer
https://www.professoren.tum.de/albu-schaeffer-alin
www.alpbach.org

Prof. Dr. Alin Albu-Schäffer, Alin Albu-Schäffer, Leiter des Lehrstuhl für Sensorbasierte Robotersysteme und intelligente Assistenzsysteme TUM, Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik des DLR
About: Prof. Albu-Schäffers (*1968) Forschungsgebiet ist der Bereich der Konzeption, sensorbasierten Programmierung, Steuerung und Regelung komplexer Robotersysteme für Manipulation und Lokomotion. Insbesondere entwickelt er Roboter und Algorithmen für die direkte, sichere und intuitive Interaktion mit Menschen und unbekannten Umgebungen. Dabei spielt die Rückkopplung vielseitiger Sensorinformationen in ultraleichten, nachgiebigen, dem Menschen nachempfundenen Roboterkonzepten eine zentrale Rolle. Vorwiegendes Anwendungsgebiet ist die robotische Assistenz von der Raumfahrt über die industrielle Produktion, Medizin und Health-Care bis hin zu persönlichen Assistenzsystemen.
Prof. Alin Albu-Schäffer studierte Elektrotechnik an der TU Timisoara, Rumänien, und promovierte 2002 an der TUM. Seit 1995 ist er im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) tätig, wo er zuletzt seit 2009 die Abteilung Mechatronische Komponenten und Systeme leitete. Prof. Albu-Schäffer wurde 2012 zum Professor an der Fakultät für Informatik und gleichzeitig zum Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik des DLR berufen. Er ist derzeit an der TUM zwecks der Institutsleitung am DLR beurlaubt. Trotzdem ist er im reduzierten Umfang an der TUM in der Lehre tätig und leitet hier eine kleine Robotik-Forschungsgruppe.
0 notes
Text
Als die Dinge fühlen lernten - Emotional Intelligence
Dinge werden ‘smart’, können Daten in Information umwandeln und anhand dessen Handlungen vornehmen. Dennoch sind die Fakten unvollständig, denn obwohl aufgrund der Daten, die vorhanden sind, Empfehlungen abgegeben werden können, fehlt doch ein wichtiger Punkt: der emotionale Zustand indem sich der Benutzer gerade befindet. Mit dieser Information werden Empfehlungssysteme viel genauer, da sie den Istzustand kennen und danach handeln können. Hyve Vorstand Dr. Michael Bartl entwickelt dazu ein Produkt.
Interview von Julia Weinzettl
Hyve ist ein Innovationsunternehmen, dass sich mit Produkt Design, Marktforschung, Data Science, Software und Anwendung von Innovationstechniken auseinandersetzt. Ihr hostet Startups und Unternehmen und begleitet sie in der prototyping Phase und arbeitet auch an verschiedenen Research Projekten. Immer wieder launcht Ihr auch Euer eigenes Produkt. Was hat Euch dazu bewogen, Tawny - emotionale Intelligenz für Dinge - zu starten?
Michael Bartl: Tawny fällt in den Bereich Affective Computing. Dieser Begriff wurde von der MIT Professorin Rosalind Picard geprägt. Sie sagt, dass wenn wir wollen, dass Computer intelligent sind und natürlich mit uns interagieren, müssen wir die Computer mit der Möglichkeit ausstatten menschliche Emotionen zu erkennen, zu verstehen und selbst auch auszudrücken. Wir arbeiten daran Systeme menschliche menschliche Befindlichkeiten oder emotionale Zustände erkennen und verarbeiten zu lassen.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Michael Bartl: Der Computer, bzw. in unserem Fall die App, erkennt zum Beispiel ob du gerade über- oder unterfordert bist, ob du dich konzentrierst, traurig oder glücklich bist. Dieser Zustand wird über Sensoren erkannt. Hier gibt es unterschiedliche Zugangsweisen wie mittels Kameras, die die Gesichtsmuskeln analysieren und dann als Facial Coding System erkennen wie du dich fühlst oder Wearables, die mittels Hautkontakt die Analyse vornehmen. Diesen Anwendungsbereich verfolgen wir bei Tawny.

Diese Emotionserkennung wird dann mit den Internet der Dinge verbunden. ‘Smarte’ Dinge erkennen die Emotion und liefern einen Mehrwert für den Anwender?
Michael Bartl: Ganz genau.
Das bedeutet der Kühlschrank weiss, dass ich hungrig bin und reagiert dann darauf?
Michael Bartl: Das Gedankenspiel ist wirklich, dass du eine Maschine bist und weißt wie sich dein Benutzer fühlt. Unser erster Use Case war tatsächlich eine Küchenmaschine. Der Thermomix - eine vernetzte Küchenmaschine, in die man Rezepte aufladen kann. Wir konnten mittels Armbändern auf Basis der Schlafdaten ziemlich gut vorhersagen in welcher Grundstimmung die Person sich befindet. Gut, schlecht, traurig, gelangweilt, etc.. Dieses Wissen haben wir mit den persönlichen Vorlieben für Rezepte und dem Ort an dem sich die Person befindet kombiniert. Zum Beispiel dem sonnigen Spanien oder dem verregneten München. In Abhängigkeit dieser emotionalen Daten + den Vorlieben + der Ortsangabe werden dann Rezepte empfohlen, die automatisch in der Küchenmaschine aus dem Internet geladen werden. Dann gibt es eine Cooking Journey, die dir dann vielleicht empfiehlt 100 Gramm Zucker, eine Limette und einen Schuss Vodka zusammenzumischen, denn du brauchst jetzt einen kühlen Drink. (grinst)
Man kann diese Idee natürlich weiterspinnen. Wenn du ein Auto wärst und merkst, da steigt jetzt zum Beispiel der Hans ein und ist heute wieder total aggressiv, dann würdest du die Fahrerassistenzsysteme so anpassen, dass sie sensibler reagieren und beispielsweise früher bremsen. Wenn du ein Smart Home System wärst, dann würdest du vielleicht die Lichtverhältnisse anpassen, weil ich gerade in der Verfassung bin konzentriert zu arbeiten, und die Musik spielen, die ich gerade hören will.
Die Dinge bekommen nicht nur Fakten als Information, sondern werden mit dem emotionalen Zustand in dem sich der Benutzer zu dem Zeitpunkt befindet. Dadurch wird die Information über den Benutzer vervollständigt.
Michael Bartl: Die Dinge werden smarter und smarter und immer mehr vernetzt, aber eigentlich nur auf der Intelligenzachse, denn sie analysieren und vergleichen ja nur Daten. Zum Beispiel was du gestern gegessen hast, was essen Leute noch, die so essen wie du oder welche Filme hast du dir in der Vergangenheit angesehen, welche könnten dich interessieren. Die Recommendation Systeme beziehen im Moment die Emotion nicht mit ein. Es wäre aber wichtig und vollständiger zu wissen, wie du dich fühlst, wenn du nach hause kommst. Neben dem IQ fehlt der EQ (Emotional Quotient), denn erst dann werden Produkte ja wirklich smart und empathisch. Im Moment wird allerdings hauptsächlich am IQ gearbeitet. Emotion ist aber immens wertvoll für Recommendersysteme. Die Empfehlungen anhand des emotionalen Zustands ist viel genauer als mit simpler Faktenanalyse.
Wie werden die Emotionen gescannt?
Michael Bartl: Die Emotionen können durch die Kamera, durch Stimmanalyse oder eben auch durch Wearables und Frequenzbänder gescannt werden. Sensoren messen die elektrodermale Aktivität der Haut. Die Messung funktioniert ähnlich wie ein Lügendetektor, man sieht ob jemand gerade aufgeregt ist, schwindelt oder die Wahrheit sagt. Es ist der beste Prädiktor für Stress und misst auch die Herzfrequenz und die Heartrate Variabilty, die Unterschiede oder die Zeiten zwischen den Herzschlägen und wie sehr diese variieren. Dadurch lässt sich relativ genau herauslesen, wie sich jemand gerade fühlt.
Welche Anwendungsbereiche gibt es für emotional intelligente Systeme wie Tawny?

Michael Bartl: Ein großes Thema ist Arbeitssicherheit. Hier geht es darum zu messen, ob Menschen über- oder unterfordert sind. Dazu gibt es verschiedene Theorien wie beispielsweise die Flow Theorie. Hier geht man davon aus, dass jeder Mensche einen optimalen Zustand hat, bei dem die Fähigkeiten zu den Herausforderungen passen. Wenn ich etwas sehr gut kann, die Herausforderung aber nicht so hoch ist, dann bin ich gelangweilt. Wenn meine Herausforderung zu hoch ist, bin ich gestresst oder habe Angst. Das optimale Verhältnis zwischen Über- und Unterforderung ist der Flow. Eigentlich sollte man in einem Unternehmen beispielsweise am Fließband immer diesen optimalen Grad an Über- und Unterforderung haben, damit sich jeder wohlfühlt. Diese Messung ist jetzt nicht im Sinne der Überwachung zu verstehen, sondern im Sinne der Arbeitssicherheit, Risikominimierung und Fehlervermeidung.
Die emotionale Intelligenz neben der Datenintelligenz mitaufzubauen ist ein großer Sprung und eine große, sehr spezifische Erweiterung.
Irgendwie ist diese totale Ehrlichkeit der Emotionen zu Personen, die man überhaupt nicht kennt ja doch etwas unheimlich und oft vielleicht nicht unbedingt gewollt?

Michael Bartl: Ja, da gebe ich dir recht. Ich denke, dass es hier Abstufungen geben wird. Die erste wäre totale Abgrenzung und keine Freigabe der Emotionen. Eine weitere Stufe könnte sein, dass man den emotionalen Zustand für sich selber misst (so wie ich das gerade mit meinem Armband mache) im Sinne von quantify yourself wie das verschieden Sport Apps ja auch mit dem körperlichen Leistungen machen. Die Auswertung gibt einem selbst Auskunft darüber wie häufig ich gut und schlecht drauf bin, wie häufig ich in den letzten Monaten über- oder unterfordert war. Das gibt ein schönes Bild über die eigene emotionale Landschaft - Selbstmanagement der Emotionen. Eine Stufe weiter ist, dass ich meine Emotionen Dingen zur Verfügung stelle um meine Umgebung an meine Stimmung anzupassen, beispielsweise gebe ich der Beleuchtung, der Musikanlage und der Küchenmaschine meine Emotionen frei. So wie man jetzt mittels Bluetooth zu verschiedenen Devices verbinden kann. Die letzte Phase wäre die, dass man seine Emotionen anderen Menschen zur Verfügung stellt. Das bedeutet ich könnte in Echtzeit die Emotionen meiner Frau und meiner Kinder auf dem Handy sehen. Ich glaube es muss eine Art empathischer Permission Levels geben, vom totalen Ichbezug bis zu Dingen und anderen Menschen.
Es sind ja auch medizinische Daten.
Michael Bartl: Ja, da herrschen natürlich auch extreme datenschutzrechtliche Vorgaben. Wir haben jetzt unsere erste Forschungsapp entwickelt, hier ist Datenschutz natürlich ein wichtiges Thema, das von Anfang an mitbedacht werden muss.
Leserfrage von Reinhard Birke: Hat man in einer perfekten Umgebung, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind noch die Möglichkeit zum Wunsch?
Michael Bartl: Ich glaube, dass man sich viele Dinge wünschen kann, die die Umgebung nicht perfekt anpassen kann. Eigentlich sollte die Anforderung eines solchen Systems sein den Raum für Wünsche zu schaffen, denn Dinge sind erledigt. Es gibt zwei Arten von Wünschen - der eine richtet sich nach etwas Positivem, der andere möchte etwas Negatives weghaben. Alle negativen Wünsche sollten durch so ein system eliminiert werden. Sobald Assistenzsysteme soweit sind, dass alles negative eliminiert ist, ist es möglich sich auf andere Dinge zu konzentrieren.
Leserfrage von Christoph Strnadl:
Current A.I. seems to be excellent - after lots of training of a highly specialized and humanly fine tuned - at solving point problems, i.e., answering questions in a relatively confined semantic domain. Additionally, we have not - yet - seen any signs of a "Moore's law" in software engineering - casting severe doubts on a (exponential) evolution of this technology. How would these observations fit into the wider A.I. and perspective in general and HYVE's ambitions for the future in particular?
Michael Bartl: I agree that most of the A.I. -based solutions we’ve seen so far have a very narrow focus on a certain task. However, there are promising attempts at generalizing from narrow tasks and transferring knowledge from one problem to another. In recent years, we’ve seen several breakthroughs even most experts expected to be achievable only several years from now. So there is no real doubt that A.I. will play a major role in the future.
www.hyvescience.net

Dr. Michael Bartl, Vorstand HYVE AG
About: Dr. Michael Bartl ist Vorstand der HYVE AG in München. Zuvor war er bei der Audi AG im Bereich Entwicklung Elektrik/ Elektronik in Ingolstadt tätig Seine Promotion und Studien der Wirtschaftswissenschaften schloss er in London, München und an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar ab. Dr. Michael Bartl ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen in international renommierten Journals und Autor des E-Journals “The Making-of Innovation” (http://www.makingofinnovation.com). Von 2011-2014 war er als Bundesvorstand des Berufsverbands Deutscher Markt- und Sozialforscher tätig. In 2012 erfolgte die Berufung zum Senator in den Senat der Wirtschaft.
0 notes
Text
Kulturwandel mit Knall
Verhaltensveränderung hervorzurufen ist eine der schwierigsten Aufgaben, vor allem in großen Unternehmen. Meistens sind Mission statements etwas, das von der Belegschaft zwar hin- aber nicht ernst genommen wird. Zum einen weil es Resistenzen gegen Veränderung gibt. Zum anderen aber auch weil Mitarbeiter nach der nächsten großen Ankündigung meistens keine tatsächliche Veränderung wahrnehmen. Ottogroup hat diese Glaubwürdigkeit mit einem Knall erreicht. Ein deutsches Traditionsunternehmen, dem vom Vorstand von einem Tag auf den anderen das ‘DU’ angeboten wird, hat die Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Mitarbeiter gewonnen.
Interview von Julia Weinzettl
Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 Tobias Krüger sprach am 16. 5. 2017 am Corporate Culture Jam in Wien.
Wie kam es zu dem Fokus auf den Kulturwandel in einem Unternehmen?
Tobias Krüger: Vor zwei Jahren gab es das schlechteste Ergebnis der gesamten Ottogroup als Holding. Man stand da vor zwei Möglichkeiten - die klassische, althergebrachte: Billiger und mehr zu produzieren sowie Personen zu entlassen. Oder die Situation zu analysieren und zu versuchen auf eine andere zeitgemäße Art zu einer Verbesserung zu kommen. Für uns war das der Auftakt sich damit zu beschäftigen welchen Herausforderungen wir uns angesichts der Digitalisierung stellen müssen.

Wie seid Ihr hier vorgegangen?
Tobias Krüger: Es gab unterschiedliche Themen, die aus der Organisation gekommen sind, wo der Veränderungsbedarf identifiziert wurde. Beispielsweise die Frage: Wie steuere und plane ich eigentlich in einer digitalen Welt? Business pläne sind schwierig einzuhalten, vielleicht sind andere KPIs nötig um zu steuern und welche Tools brauchen wir dazu? Dieses Thema wurde von einem Vorstand bearbeitet, der sich mit einer bunt gewürfelten Gruppe an Mitarbeitern dieser Frage genähert hat. Was bedeutet das für uns und was sind unsere Antworten darauf. Auf dieses Art hat man sich dem Problem angenommen. Das hat im ersten Schritt dazu geführt, dass die Vorstände in andere Kontakte und andere Dialoge mit den Mitarbeitern gekommen sind. Jeder Vorstand hat mit einer Gruppe gearbeitet, die mehrperspektivisch besetzt war, dadurch kam es zu einer spannenden Dynamik und sehr erfolgreich Ergebnissen.
Was waren die Learnings?
Tobias Krüger: Ein großes Learning war wohl das Aha-Erlebnis das jeder Vorstand an einer bestimmten Stelle hatte. Das kam an unterschiedlichen Stellen für jeden unterschiedlichen Vorstand. Aber tatsächlich hat jeder Vorstand für sich erkannt, dass die eigene Wahrnehmung der Organisation nur ein Teil der Perspektive ist und dass ein ganz wesentlicher Teil fehlt, wenn man nicht aus unterschiedlichen Sichten auf das Gleiche blickt. Man konnte im Endeffekt viele blinde Flecken, die es gab, schliessen. Das heisst nicht, dass es heute nicht auch noch blinde Flecken gibt, aber die ganze Kommunikation hat dazu geführt aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Gemeinsame zu schauen und so zu einem gemeinsamen Lernen zu kommen. Es war allerdings schon so, dass die Vorstände meinten: ‘ätzend’ - meine Wahrnehmung ist gerade korrigiert worden.
Man hat auch von einem Tag auf den anderen beschlossen sich im Unternehmen zu duzen.
Tobias Krüger: In der Ottogroup gibt es eine monatliche Vorstandssitzung. Dann hatte der Vorstand hat beschlossen, zusätzlich zur Vorstandssitzung auch einen monatlichen Workshop zu machen, um für sich zu erkennen, wie sie mit dem Thema Unternehmenskultur umgehen wollen. - Ich bin mir bewusst, was das für ein Luxus ist - Innerhalb dieses Workshops haben die Vorstände gesehen, dass sie nicht die ganze Zeit vom ‘wir’ sprechen können, wenn sie selber kein Team sind. Aus dieser Erkenntnis kam die Conclusio: wir müssen uns duzen, denn um aus dem ‘Ich’ - dem Silo - ins ‘Wir’ zu kommen müssen wir über das ‘Du’ gehen. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass die Vorstände gesagt haben, wenn wir uns hier innerhalb des Vorstands duzen um uns einander anzunähern, dann müssen wir uns doch alle duzen. Das war der erste grosse Knall, das hat so richtig etwas geschüttelt. Und ein Zeichen gesetzt, dass die Veränderung auch ernst gemeint ist. Der Vorstand hat das ‘Du’ als Angebot formuliert - wer will kann das machen, wer nicht will muss nicht. Es gab auch einige Fälle, die das am Anfang nicht gemacht haben, die sind aber so isoliert gewesen, dass sie das nicht durchhalten konnten.
Wie habt ihr diesen Kulturwandel 4.0 weiter verfolgt? Beziehungsweise es wurde sogar die Position des Bereichsleiter Kulturwandel, Deine Position, geschaffen, wie kann man sich das vorstellen?
Tobias Krüger: Grundsätzlich ist es so, dass wir als Ottogroup, aufgrund der Herausforderungen der Digitalisierung um die faktotischen Dinge wie Strategien, Prozesse, digitale Infrastruktur oder IT-Infrastruktur nicht herumkommen. Damit haben wir uns auch schon länger auseinandergesetzt. Aber es gibt auch einen ganz wesentlichen Aspekt, der sich auf der Ebene der Verhaltensweisen, des Miteinander, der Mitarbeit und der Organisation bezieht. Mit dieser ganzen Ebene der Mitarbeiter und Organisation beschäftigen wir uns unter dem Thema Kulturwandel 4.0. Das bedeutet die Vernetzung von allen in der Breite für unsere Unternehmenskultur, in dieser Programmatik bewegen wir uns. Meine Position als Bereichsleiter ist die Bezeichnung für die Leitung dieser Programmatik mit meinem Team als Stabsstelle unseres CEOs.
Wie kann man sich diesen Kulturwandel konkret vorstellen, den ihr hier vorantreibt?
Tobias Krüger: Wir haben 630 wesentliche Gesellschaften, die auf 4 Kontinenten verteilt sind. Wir haben 52.000 Kollegen und Kolleginnen, die für die Ottogroup arbeiten. Wir können eigentlich aus der Logik eines Headquarters heraus keine bestimmte Definitorik vorgeben und diese in der gesamten Gruppe exerzieren. Wir haben gemeinsam bestimmte Glaubenssätze aufgestellt. Die Mitarbeiter und die Kollegen und Kolleginnen vor ort sind ja Experten für ihre eigenen Felder und auch für die Felder der Zusammenarbeit und sie wissen auch warum sie in bestimmten Themen sehr gut und kooperativ zusammenarbeiten.

Welche Glaubenssätze sind das?
Tobias Krüger: Wir haben offene und partizipative Prozesse. Wichtig ist, dass wir erkannt haben, dass es keinen „One Size Fits All“ Ansatz geben kann aufgrund unserer Vielfalt der Unternehmen - wir sind 123 Unternehmen in 30 Ländern. Dadurch ergeben sich große kulturelle Unterschiede. Große inhaltliche Unterschiede ergeben sich durch die Art der Unternehmen, Multichannel-Einzelhandel sowie Finanzdienstleistungen und Service. Wir glauben, dass wir daher eine dezentrale Umsetzung benötigen, allerdings - und das ist ganz wichtig - bei gemeinsamer Verantwortung. Wir wissen auch, dass die Organisationseinheiten tatsächlich selbst am besten wissen was sie brauchen und wir glauben an intendierte Regelbrüche um Innovation zu schaffen und Weiterentwicklung voranzutreiben.

Tobias Krüger/Bereichsleiter Kulturwandel 4.0, Ottogroup
Was war bisher die größte Hürde?
Tobias Krüger (grinst): Dass es mich hier immer noch gibt. Wir haben wirklich viel geschaffen in diesen 2 Jahren und ich denke es wäre auch gar nicht möglich gewesen, wenn die Vorstände dieses Thema nicht voll unterstützen würden. Aber Verhalten zu ändern, Vertrauen zu schaffen und dieses Änderungen schlußendlich auch umzusetzen geht nicht ohne Widerstände. Wir sind auf dem Weg, aber bestimmt noch nicht fertig.
www.ottogroup.com
About:
Tobias Krüger ist Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 in der Otto Group mit Sitz in Hamburg. Er steuert den Kulturwandel 4.0 der 130 Gesellschaften der Gruppe. Auf 4 Kontinenten arbeiten für diese ~50.000 Mitarbeiter. Zuvor verantwortete er als Bereichsleiter Corporate Strategy & Development eine Vielzahl strategischer Projekte.
0 notes
Text
Radikale Innovation in Unternehmen - nur mit Brückenschlag möglich
Zukünftig erfolgreiche Unternehmen werden von außen immer noch groß und mächtig aussehen, aber intern wird die Struktur einem Zusammenschluß von ganz vielen kleinen Unternehmen ähneln. Wir werden keine großen Abteilungen haben, die für nur eine spezifische Funktion verantwortlich sind - beispielsweise eine Marketing- oder Verkaufsabteilung. Sondern Abteilungen werden in viel kleinere Einheiten unterteilt sein, die fast wie Unternehmen funktionieren und eher lose Schnittstellen zu anderen internen Abteilungen haben, die auch quasi Unternehmen sind. Die radikalen Innovationen werden vermutlich immer noch aus einem Team kommen, dass nicht unter Umsatzdruck steht, sagt Jean-Philippe Hagmann, Gründer Innopunk, Experte für radikale Innovation.
Interview von Julia Weinzettl
Jean-Philippe Hagmann spricht am 16.05.2017 am Corporate Culture Jam in Wien.

Wie ist Innovation aus Ihrer Sicht am optimalsten in der Unternehmenskultur eingebettet?
Jean-Philippe Hagmann: Ich beziehe mich hier auf radikale Innovation, beziehungsweise auf das Gegenteil dessen, was man als die Hausaufgabe von Unternehmen bezeichnet, nämlich die Produkte und Dienstleistungen, die man bereits hat, besser zu machen. Ich spreche davon, wirklich neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu etablieren. Um das in einem Unternehmen am besten umzusetzen, braucht es zwei verschiedene Welten. Es werden zwei verschiedene Organisationen innerhalb eines Unternehmens benötigt. Die Eine beschäftigt sich mit dem Tagesgeschäft und der effizienten Umsetzung. Die zweite Organisation ist eine kleine Gruppe, die nur wenigen Personen benötigt, aber das sind diejenigen, die die Fühler in die Zukunft ausstrecken, Neues entwickeln und neue Konzepte testen.
Wie treffen diese beiden Welten dann wieder aufeinander? Oft wird diese zweite, lean aufgesetzte Unternehmensform ja auch gleich mit einem Startup umgesetzt, das im Unternehmensrandbereich angesiedelt wird. Wie wird es möglich die Innovation dann wieder in das Unternehmen zu integrieren?
Jean-Philippe Hagmann: Es gibt verschiedene Arten dieser Innovationsabteilung oder Avantgardeabteilung - wie ich es nenne. Sie kann outgesourced sein, ich empfehle Unternehmen aber diese Abteilung intern aufzusetzen. Wenn Innovation immer als etwas Externes empfunden wird, dann ist es schwer diese Denke auch in der Unternehmenskultur als echten Pfeiler zu verankern. Die Wiedereingliederung der Innovation, die ja im Unternehmen umgesetzt werden muss, stößt auf Widerstände. Entsteht die Innovation aus einem hausinternen Team, dann ist die Rückführung einfacher. Hier muss eine Brücke zwischen den zwei Welten geschlagen werden, die einen ganz speziellen Typ Mensch benötigt, der dazwischen fast schon als Übersetzer agiert und in beiden Welten zu Hause ist. Meine Empfehlung ist daher, wenn ein Unternehmen eine Innovationsabteilung ins Leben ruft, auch externe Personen zu beschäftigen, aber vor allem interne Personen, die Interesse an Innovationen haben, in das Team zu integrieren. Diese Personen können die Brücke bauen um die Innovation ins Unternehmen zurück zu führen. Sie machen im Unternehmen glaubwürdig Werbung dafür, dass das was in der Innovationsabteilung entsteht etwas Gutes ist. Wenn es diese Brücke nicht gibt, dann entsteht oft eine Abstoßungsgefahr. Die Personen, die für die erfolgreichen Produkte verantwortlich sind, denken, dass hier Geld für ein Team ausgegeben wird, das am Unternehmenserfolg zu diesem Zeitpunkt gar nichts beiträgt. Dafür braucht es interne Brückenbauer, die den Innovationen Rückhalt geben.

Jean-Philippe Hagmann, Gründer Innopunk/Experte für radikale Innovation
Welche Tools wenden Sie an um Unternehmen zu helfen, diese Widerstände und Resistenzen zu überwinden?
Jean-Philippe Hagmann: Eigentlich ist es nicht möglich wirklich innovativ zu sein ohne den Rückhalt der Geschäftsleitung zu haben. Die Geschäftsleitung muss sich auch bewusst sein, dass dieses Commitment auch einschneidende Veränderungen einher bringt. Wenn das gegeben ist, dann geht es um interne Bewusstseinsbildung und internes Marketing. Es muss eine tatsächliche gemeinsame gelebte Vision geben. Tools oder Werkzeuge wende ich situationsbezogen an, da ich nicht daran glaube, dass es die eine Methode gibt, die immer funktioniert. Aber ich arbeite gerne mit Konzepten wie Design Thinking und agilen Methoden.
Derzeit stehen Unternehmen vor der Tatsache, dass sie innovieren müssen um weiter zu bestehen. Das ‘Crumbling’ hat angefangen und es muss etwas getan werden. Das ist der Status quo der Innovation. Wie sehen Sie die Transformation von Unternehmen in der Zukunft, wenn dieses Entwicklung fortgeführt wird?
Jean-Philippe Hagmann: Viele der nicht innovativen Unternehmen werden vermutlich nicht überleben. Wenn ich mir Strukturen von zukünftig erfolgreichen Unternehmen ansehe, dann denke ich, dass Unternehmen von außen immer noch groß und mächtig aussehen, aber intern wird die Struktur einem Zusammenschluß von ganz vielen kleinen Unternehmen ähneln. Wir werden keine großen Abteilungen haben, die für nur eine spezifische Funktion verantwortlich sind - beispielsweise eine Marketing- oder Verkaufsabteilung. Sondern Abteilungen werden in viel kleinere Einheiten unterteilt sein, die fast wie Unternehmen funktionieren und eher lose Schnittstellen zu anderen internen Abteilungen haben, die auch quasi Unternehmen sind. Dadurch ist es fast so als würde man mit vielen Startups zusammenarbeiten - die Innovation entsteht dann auch in diesen Abteilungen, aber das werden dann auch inkrementelle Innovationen sein. Die radikalen Innovationen werden vermutlich immer noch aus einem Team kommen, dass nicht unter Umsatzdruck steht.
Denken Sie, dass radikale Innovation weiterhin hauptsächlich von Startups kommen wird?
Jean-Philippe Hagmann: Ich bin überzeugt, dass etablierte Unternehmen bessere Voraussetzungen haben, radikal zu innovieren als Startups. Das Paradoxe ist aber, dass sie einfach sehr viele Hindernisse in ihren Prozessen haben. Diese gilt es abzubauen und Voraussetzungen zu schaffen, dass diese radikalen Innovationen auch möglich sind. Aber eigentlich haben sie die besseren Karten. Ich glaube es werden vermehrt radikale Innovationen und auch Disruptionen von etablierten Unternehmen kommen.
Welche Hindernisse müssen da ausgeräumt werden?
Jean-Philippe Hagmann: Einerseits das halbherzige Commitment Innovation gegenüber. Fast alle Unternehmen haben Innovation in ihren Statuten verankert, das heißt aber nicht, dass diese auch aktiv gelebt wird. Oft geschieht das, was ich Innovationstheater nenne - Unternehmen schicken Teams ins Silicon Valley, machen Kreativitätsworkshops oder kaufen eine Software für Open Innovation und bauen einen Raum um, sodass er flexible Wände hat. Das sind alles eigentlich gute Maßnahmen, aber wenn sie alleine stehen - und das geschieht sehr häufig - entsteht zwar der Eindruck man wäre innovativ, aber es passiert nichts. Und das steht oft der echten Innovation im Weg. Um Innovation umzusetzen bedarf es dem Mindset, der versteht, dass es sich um eine längere Phase handelt in der man testet und probiert. Und erst dann in die Umsetzung geht. Es geht auch darum die richtigen Personen zu finden und nicht allen vorzuschreiben innovativ sein zu müssen.
Welcher Job wird in Ihrem Bereich benötigt, der heute noch keinen Namen hat?
Jean-Philippe Hagmann: Ich glaube, es wird viele dieser Jobs geben, die heute noch keinen Namen haben. Einen Job, aus dem Kontext den ich beschreibe, habe ich Lead Avantgardist genannt. Das ist eigentlich der CEO der Innovationsabteilung, ich nenne ihn nicht gerne CEO, weil der eine ganz andere Funktion hat. Er ist zum einen der Wegbereiter der Innovatoren und zum anderen das Bindeglied zum tatsächlichen CEO des Unternehmens, mit diesem funktionert er im Tandem. Ich habe festgestellt, dass innovative Firmen dann große Innovationen herausgebracht haben, wenn die Person, das Unternehmen geführt hat, auch visionär war. Diesen visionären Geschäftsführer braucht es vielleicht nicht im Tagesgeschäft, aber als Innovationsführer.
www.innopunk.com
www.jeanphilippehagmann.com

Vorbestellung ‘Hört auf Innovationstheater zu spielen’
About: Jean-Philippe Hagmann hinterfragt ständig den Status Quo. Er ist Redner auf internationalen Kongressen und Unternehmensveranstaltungen. Der diplomierte Industriedesigner mit einem Background als Maschinenbau-Ingenieur ist Mitbegründer von INNOPUNK, dem Berater und Befähiger für mehr radikale Innovationen in deutschsprachigen Unternehmen. Ausserdem ist Jean-Philippe Dozent für Innovationsmanagement, Autor sowie leidenschaftlicher Innovations-Vordenker der neuen Generation.
0 notes
Text
Die 50er kommen!
Mit 50 Jahren die Karriere nochmal komplett umkrempeln wäre früher undenkbar gewesen. In einer Welt in der sich gerade alles ändert, überrascht das aber gar nicht so sehr. Verschiedene Faktoren spielen zusammen: eine längere Lebenserwartung, die Aussicht auf eine ausreichende Pension ist am Schwinden, generelle körperliche und geistige Fitness lassen heute 50 Jährige immer weniger an die Pension denken. Mit 50 Jahren stehen Wissensarbeiter mitten im Leben aber oft plötzlich vor der Tatsache, dass sie beruflich eigentlich alles erreicht haben - die Karriere ist am Stillstand, neue Perspektiven gibt es in dem angestammten Unternehmen nicht. Es folgt Langeweile und oft Frustration, denn vorbereiten auf die Pension ist noch lange nicht angesagt. Das ist genau der Zeitpunkt um sich etwas Neuem zu widmen. Die Erfahrung, die in vielen Jahren gesammelt wurde, zu bündeln, in etwas ganz Anderes fließen zu lassen und so Neues zu schaffen.
Diesem Bedürfnis und Wissensdrang leistet das Europa-Instituts für Erfahrung & Management METIS Folge. Die Grundlage für diese Initiative bildet ein im Vorjahr abgeschlossenes internationales Forschungsprojekt, in dem die FH Burgenland, die Rheinische FH Köln (D) und die FHS St. Gallen (CH) zusammen arbeiteten.
Start des ersten Programms ist die Kurzausbildung „Innovationswerkstatt: Lebenserfahrung 2017“ — Lernen durch konkrete Arbeit am gesellschaftlichen Innovationsprojekt.
Die beiden Gründer, Prof. für Innovation Regina Rowland und Wirtschaftsprofessor Sebastian Eschenbach an der FH Burgenland, haben sich einiges überlegt.
Interview von Julia Weinzettl

FH Professor Dr. Dr. Sebastian Eschenbach, Managementspezialist, Leiter Department Wirtschaft der FH Burgenland
Was war die Initialidee für Euer Projekt?
Prof. Sebastian Eschenbach: Wenn man eine Fachhochschule, wie die FH Burgenland, mitführt und merkt, dass es aufgrund der Geburtenrückgänge viel weniger Studenten gibt, wird man eigentlich dazu gezwungen, sich etwas zu überlegen. Wo ist eine wachsende Zielgruppe? Es gibt kein Angebot für Personen ab 50 oder auch 60, die noch zwanzig aktive Jahre vor sich haben. Der Anteil der Personen, die sich betätigen wollen und auch betätigen müssen, steigt immer mehr. Und es hat einen Shift gegeben, die immer mehr verstärkt wird - die Personen, die bei der ZiB 2 einschlafen wollen, stehen denen gegenüber, die eigentlich die Gesellschaft schupfen und das auch wollen. Es gibt immer mehr Beispiele von Personen, die ihren wichtigsten Karriereschritt oder ihr wichtigstes Projekt gemacht haben, nachdem Gleichalte in Pension waren. Bekannte Beispiel sind Nelson Mandela, oder Helmut Schmidt, der nach dem Amt als Bundeskanzler der Herausgeber der ‘Zeit’ wurde oder Peter Drucker, Pionier des modernen Management. Diese zweite Karriere gibt es für Personen, die besonders talentiert sind oder sie ergeben sich, wenn der Zufall eine Rolle spielt. Damit dies aber auch „Normalsterblichen“ gelingt, sind speziell dafür konzipierte Lernprozesse ein hilfreicher Rahmen. Denn es geht nicht um Weiterbildung im angestammten Fachbereich, sondern um das Neulernen eines Fachgebietes. Diesen Rahmen wollen wir liefern, die Inputs kommen möglicherweise nur zu einem kleinen Teil von uns in Form der Methodik, viele Inputs werden durch den Austausch untereinander entstehen.

FH Professorin Dr. Regina Rowland ist Spezialistin für Design Thinking, unterrichtet und forscht an der FH Burgenland
Welche Methoden wendet Ihr hier an?
Prof. Regina Rowland: Wir verwenden Design thinking und Systems thinking Methoden und lehren Prozesse und Werkzeuge um Innovation hervorzurufen und anzuwenden — denn Innovation ist keine Sache des Zufalls und beruht nicht nur auf der Anwendung neuer Technologien.
Gibt es einen guten Bereich in dem man sich entfalten kann?
Prof. Sebastian Eschenbach: Der Entfaltungsbereich ist derzeit wahrscheinlich nicht der corporate Bereich, denn da ist man mit 60 entweder Aufsichtsrat oder man ist eigentlich am absteigenden Ast. Soziale Dienste hingegen im allerweitersten Sinn, sind ein Bereich, der flexibel ist und auch offener für Quereinsteiger. Daher haben wir uns dafür entschieden, unser Programm auf dieses Gebiet auszurichten. Die teilnehmenden Personen können sich in diesem Bereich ein neues Tätigkeitsfeld selbst gestalten.
Wie läuft die Innovationswerkstatt konkret ab?
Prof. Regina Rowland: Wir starten am 11. Mai. An vier Wochenenden werden die Teilnehmer in die Methodik eingeführt und arbeiten konkret an einem Projekt gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Mörbisch.
Was ist der Projektinhalt?
Prof. Regina Rowland: In Form eines gemeinsamen Workshops haben wir einige Anforderungen herausgearbeitet. Die Gemeinde Mörbisch hätte gerne, dass mehr Verbindung zwischen den Einwohnern des Ortes und der Seebühne Mörbisch entsteht. Einst brachte die Seebühne Tourismus und Umsätze, mittlerweile fahrt das Publikum aufgrund der verbesserten Infrastruktur am abend wieder nach Hause. Früher war die Seebühne eingebunden und ein Teil der Gemeinde, das hat sich geändert. Lösungsansätze für diesen Disconnect zu finden ist ein Teil der Projektaufgabe.
Die Teilnahme an der Innovationswerkstatt wird nach dem FairPay Prinzip verrechnet, was bedeutet das?
Prof. Regina Rowland: Wir haben unsere Kosten aufgelistet um transparent zu sein, aber die Teilnehmer bezahlen eine Summe nach eigenem Ermessen.
https://www.institut-metis.eu
About: FH Professor Dr. Dr. Sebastian Eschenbach ist Managementspezialist und Leiter Department Wirtschaft der FH Burgenland. Er hat an der Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Harvard und Universität Klagenfurt Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie studiert, war in Industrie und Unternehmensberatung tätig. Seit 2000 arbeitet er an der FH Burgenland. Dort entwickelte er eine Reihe von Studiengängen und Forschungsprojekten. Er ist einer der Mitinitiatoren des Europa-Instituts für Erfahrung & Management METIS. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind: Strategisches Management, Innovation durch Erfahrung und neue Formen der Aus- und Weiterbildung. Kontakt: [email protected]
FH Professorin Dr. Regina Rowland ist Spezialistin für Innovation, unterrichtet und forscht an der FH Burgenland. Sie berät Organisationen und unterrichtet an Universitäten in Europa, in Südamerika und den Vereinigten Staaten. Sie promovierte am California Institute of Integral Studies und schloss ein weiteres Studium an der Grenoble Ecole de Management in Management, Technologie und Innovation ab. Zusätzlich absolvierte sie mehrere akademische Lehrgänge zu den Themen Nachhaltigkeitsentwicklung in Unternehmen, Biomimicry, Interkulturelle Kommunikation und Neurolinguistische Programmierung. Zu ihren Kompetenzfeldern zählen Design und Innovationsprozesse, Unternehmensführung und Veränderung sowie systemische Nachhaltigkeit. Ihre Arbeitsweise und Ergebnisse: www.reginarowland.com
0 notes