Text
„JETZT MÜSSEN WIR DRANBLEIBEN!“ – ZUVERSICHT ZUM ABSCHLUSS DES 3. KONGRESSES „ZUKUNFT DEUTSCHER FILM“
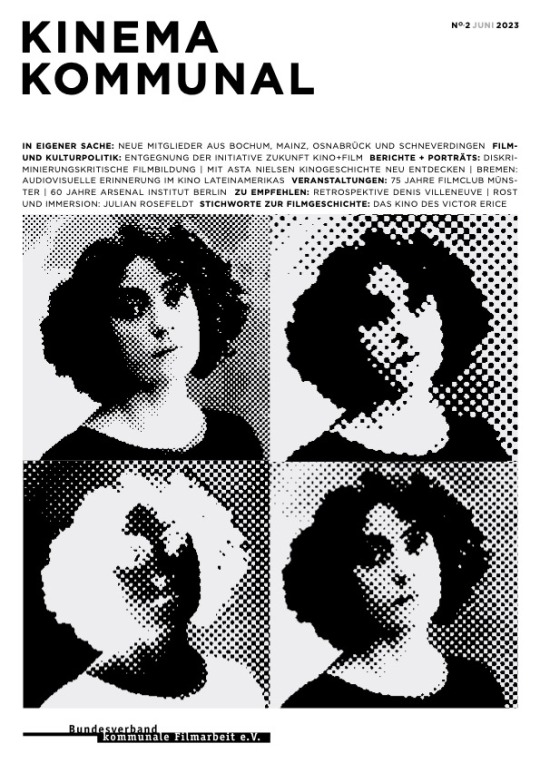
100 Jahre Frankfurter Positionen – dieses Motto des dritten Kongresses „Zukunft Deutscher Film“, der vom 19. bis 21. April in Frankfurt am Main stattfand, mochte irritieren. Vor allem aber machte es im Zusammenspiel mit der vorab erschienenen Publikation Not und Zerstreuung neugierig. Edgar Reitz, Dominik Graf, Irene von Alberti, Saralisa Volm, Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber, Cornelia Grünberg, Anna de Paoli und viele weitere Persönlichkeiten der deutschsprachigen Filmszene reisten in die Mainmetropole, um die Zukunft der hiesigen Filmkultur zu diskutieren.
Mit den Frankfurter Positionen zur Zukunft des deutschen Films, einem Papier, das eine grundlegende Erneuerung des deutschen Filmsystems fordert, erzielte 2018 der erste Kongress „Zukunft Deutscher Film“ bundesweite Aufmerksamkeit. Damals wie heute veranstaltet durch das Lichter Filmfest Frankfurt International. Damals formulierten etwa 100 Expertinnen und Experten Vorschläge, wie der allseits bedauerte Reformstau im deutschen Film überwunden werden kann. Es folgten Debattenrunden bei den Filmfestivals in München, Hof, Saarbrücken und Berlin; zahlreiche Gruppen und Verbände schlossen sich zur Initiative Zukunft Kino + Film (IZK+F) zusammen. Zugleich zeigte sich: Filmpolitik ist zwar Angelegenheit der Nationalstaaten, die Zukunft des Films muss aber auch über die Grenzen hinweg diskutiert werden, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. In vielen Ländern Europas sieht sich der Film und seine Förderung mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert. Dennoch schlagen die einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Wege ein – mit unterschiedlichem Erfolg.
100 JAHRE FRANKFURTER SCHULE
Mit dem diesjährigen Kongress jährte sich zugleich die Gründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung (IfS) zum 100. Mal. Es ist die Geburtsstunde einer Theorieschule, die später unter dem Namen „Frankfurter Schule“ weltweite Bekanntheit erlangte und mit ihrem Denken, Frankfurter Positionen anderer Art, einen Grenzgang zwischen Theorie und Praxis erprobt. Der Kongress nahm das Jubiläum der Frankfurter Schule deshalb zum Anlass, Fragen der Filmkultur auch aus der Perspektive der Kritischen Theorie zu diskutieren – in Kooperation mit dem Institut für Sozialforschung. Bereits im Vorfeld hatte der Kulturtheoretiker Georg Seeßlen einen filmtheoretischen Essay zur Kritischen Theorie bei epd Film veröffentlicht, der auf den Kongress vorbereitete. Dort zeigte sich dann die Relevanz der Frankfurter Schule für die Gegenwart und Zukunft des Films – zur Schärfung des Blicks als auch zur Reflexion von Stoffen und Formen. Gerade durch die Offenheit ihrer Methoden und Gegenstände bietet die Kritische Theorie vielfältige Angebote und unterstreicht die Qualität des Films als eigenständiger Erkenntnisform.
DAS SPRECHEN UND SCHREIBEN ÜBER FILM
Kritische Theorie heißt auch Kritik der Kultur und ihrer Medien. Das Panel „Kracauers Erben“ fragte in diesem Zusammenhang nach der Zukunft der Filmkritik. Vertreterinnen und Vertreter aller Formen und Generationen diskutierten über das, was vom Erbe eines Siegfried Kracauer, der die Filmkritik in Deutschland begründete und sie immer auch politisch dachte, übrig geblieben ist. Und darüber, wozu die Gesellschaft auch heute (Film-)Kritik braucht. Wolfgang M. Schmitt beispielsweise, der mit seinem YouTube-Kanal Die Filmanalyse über 100.000 Follower erreicht, verwies auf Tik-Tok-Videos mit 50 Millionen Views, um daraufhin zu fragen, wer sich nur einen Tag später an all diese Bewegtbilder wirklich noch erinnern kann. Dagegen könne jeder sagen, was er letzte Woche im Kino oder im Fernsehen gesehen hat. Deshalb seien der Film und auch die Serie ganz wichtige popkulturelle Prägungen, und deshalb habe auch die Filmkritik weiterhin eine Relevanz.
EDGAR REITZ ZUR ZUKUNFT DES KINOS
Einer der Höhepunkte des Kongresses war der Vortrag des Regisseurs Edgar Reitz zu den Chancen des Kinos als Ort und zur Zukunft des Filmsehens. Die 90-jährige Autorenfilmlegende, bereits vor fünf Jahren Mitinitiator des Kongresses, beschrieb die Allgegenwart des Streamings von Bewegtbildern: Die moderne Gesellschaft leide unter dem Irrglauben, „dass zuhause alles und draußen nichts mehr zu haben ist.“ Für Reitz eine große Gefahr für die demokratische Öffentlichkeit: Menschen müssten sich auch physisch begegnen und austauschen – und eine lebendige Gegenwart teilen. Dafür brauche es neue Kinoräume, die mit völlig neuen Architekturen Kino wieder zu einem „Live-Ereignis“ machten. Reitz schlug den Bau eines modellhaften Experimental-Kinos vor.
EINE NEUE KINOBEWEGUNG
In den vergangenen Jahren sind in Deutschland verschiedene Konzepte für neue Orte des Bewegtbildes entstanden. In Hamburg etwa wurde im Kontext der dortigen Kinemathek ein „Zentrum Audiovisueller Kulturen“ konzipiert, auf einem Münchner Symposium zur Zukunft der Film- und Kinokultur ein „Filmhaus“ angedacht und in Frankfurt seitens des Lichter Filmfests ein Konzept für ein „Haus der Filmkulturen“ veröffentlicht. In Berlin ist das Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. in der Planung für einen neuen Ort und das bi‘bak-Kollektiv erprobt mit seinem Kino-Experiment Sinema Transtopia schon seit einigen Jahren ein „neues Kino in der transnationalen Gesellschaft“. In Leipzig wird die Cinémathèque wohl bald den lang gesuchten festen Ort beziehen können. Und in Stuttgart schließlich hat man bereits einen europaweiten hochbaulichen Realisierungswettbewerb für ein Haus für Film und Medien durchgeführt, dessen Siegerentwurf inmitten der Innenstadt bis 2027 realisiert werden soll. In Frankfurt kamen Vertreterinnen und Vertreter dieser Projekte erstmals zusammen. Sie tauschten sich über ihre Vorhaben im Hinblick auf Realisierbarkeit und städtebauliche Qualitäten aus und verständigten sich auf eine kontinuierlichere Zusammenarbeit. Vielleicht war es der Beginn einer neuen Kinobewegung für den kulturellen Film.
ANGST ESSEN KINO AUF
„Eure Angst tötet unsere Kreativität, unsere Ideen, unsere Lust am Schaffen.“ So wandten sich über 300 Filmschaffende mit einem Appell zu Beginn des Kongresses an die Öffentlichkeit und zielten insbesondere auf die Finanzierungs- und Denklogik der Branche. Die Jung-Regisseurinnen Pauline Roenneberg und Eileen Byrne stellten, gemeinsam mit anderen Initiatorinnen und Initiatoren der Kampagne, den „Appell des jungen deutschen Films“ unter tosendem Applaus vor. Seither wurde er von über 1000 Personen unterzeichnet. „Daraus erwächst Mut!“, so die beiden Vertreterinnen, die auf eine Reaktion der Kulturpolitiker und Förderer hoffen.
5 JAHRE FRANKFURTER POSITIONEN
Für viele aus der Filmbranche sind die „Frankfurter Positionen“ Impulsgeber für das jüngst von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Berlinale vorgestellten Acht-Punkte-Papier zur Reform der Filmförderung. Der Berliner Regisseur RP Kahl resümierte ironisch zum Kongressabschluss: „Auch wenn die Referenten Roths eine direkte Verbindung zu den Frankfurter Positionen sicherlich verneinen, haben sie sogar einige deren Kommafehler übernommen.“ Gregor Maria Schubert, der neben Johanna Süß das in diesem Jahr bemerkenswert gut besuchte Lichter Filmfest leitet und den Kongress ins Leben gerufen hat, gab die Losung aus: „Jetzt müssen wir dranbleiben!“ Der politische Betrieb ziele durch Absichtsbekundungen oftmals nur auf das Ruhigstellen neuer politischer Impulse. Deshalb müssten die Anstrengungen der vergangenen Jahre, die auf eine grundlegende Erneuerung des bisherigen Filmfördergesetzes drängen, weiter intensiviert werden. Dazu gehöre auch das Finden neuer Formen. Der Kongress solle in Zukunft verstetigt werden, sagte Johanna Süß, um den Austausch während der drei Kongresstage zu intensivieren Es brauche einen Rahmen, um das Potential des Kongresses auszuschöpfen und seine Anregungen nachhaltig zu verfolgen – etwa die Gründung einer Gesellschaft zur Förderung der Filmkultur.
Bericht für das Juni-Heft der KINEMA KOMMUNAL
0 notes
Text
DIE LIEBE IM FILM, DIE LIEBE ZUM KINO

„Ich verabscheue die Vorstellung, dass eine Liebe zwischen zwei Menschen zur Erlösung führen könne. Mein ganzes Leben lang habe ich gegen diese repressive Beziehungsform angekämpft. Vielmehr glaube ich an die Suche nach einer Art Liebe, die auf irgendeine Art und Weise die gesamte Menschheit mit einbezieht.“ – Rainer Werner Fassbinder
Denkt man an die Liebe im Film, denkt man gemeinhin an den Liebesfilm. Sein klassischer Gegenstand ist die Liebe zwischen zwei Menschen. Zumeist erfüllt sich ihre Liebe, es kommt im Film zum sogenannten Happy End. Seltener bleibt ihre Liebe unerfüllt, der Film gerät zum Melodram. Was auffällt: Der klassische Liebesfilm erzählt vom Sich-Verlieben und Verliebt-Sein und endet an der Stelle, an der so etwas wie Liebe überhaupt erst beginnen kann. „Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt“, notierte der Frankfurter Psychoanalytiker Erich Fromm, „sie ist etwas, das man in sich entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt.“ Einer der bekanntesten Regisseure, die ihre Filme erst dort beginnen lassen, wo das Leben fragt: „Kommst Du mit in den Alltag?“, ist Ingmar Bergman. In Filmen wie „Szenen einer Ehe“ (1973) zeigt er, wie sich Liebespaare in Beziehungen um sich bemühen und mit sich abmühen, um sich kämpfen und sich bekämpfen, die Widrigkeiten des Alltags meistern und daran scheitern. Nach seinen experimentellen Anfängen brauchte es jedoch einige Jahrzehnte, bis das Kino für alle sichtbar die Grenzen des klassischen Liebesfilms überschreitet, mit ihnen spielt oder aber sie gänzlich sprengt.
Am Anfang der Filmgeschichte steht William Heises „The Kiss“. Bereits 1896 zeigt dieser in einer einzigen Kameraeinstellung, wie eine Frau und ein Mann sich innig umarmen und dabei küssen. Was damals zum Skandal geriet, gilt heute als der berühmteste US-amerikanische Film des 19. Jahrhunderts. In den folgenden Jahrzehnten produzierte vor allem Hollywoods Studiosystem unzählige Liebesgeschichten für die Kinoleinwände. Dabei ging es zumeist weniger um die Erzählmuster von romantischer oder tragischer Liebe, die als eingeschliffene ohnehin austauschbar waren. Sie dienten vor allem der Überhöhung berühmter Leinwandpaare. Ab den 1960er Jahren wurde im großen Stil immer öfter mit Kitsch und Klischee gebrochen, vor allem im europäischen Kino. Es ging nicht mehr allein um die Beziehung zwischen zwei Menschen, Liebe wurde wie in „Jules et Jim“ (1962) fortan auch als Dreierkonstellation erzählt. Zudem bewegten sich filmisch erzählte Beziehungen nun auch jenseits der heteronormativen Mann-Frau-Konstellation: Nachdem bereits 1958 Romy Schneider in „Mädchen in Uniform“ eine Internatsschülerin verkörperte, die Gefühle für ihre Lehrerin entwickelt, spielt „The Boys in the Band“ (1970) erstmals fast ausschließlich unter Homosexuellen und avancierte zum Kultfilm der amerikanischen Schwulenszene. Ferner wird mit „L‘ultimo tango a Parigi“ (1972) die Sexualität eines Liebespaares explizit auch in ihrer Grenzüberschreitung gezeigt oder in „Harold and Maude“ (1971) die Liebe als generationsübergreifende Verbindung aufgegriffen. Rainer Werner Fassbinder konfrontiert in „Angst essen Seele auf“ (1974) die Liebe einer Frau zu einem sehr viel jüngeren ausländischen Mann schließlich mit den Konflikten, die aufgrund einer latent rassistischen Gesellschaft entstehen.
Wenngleich sich der klassische Liebesfilm in seiner Wiederholung immer gleicher Muster bis heute erhalten hat, es offenkundig ein sozialpsychologisches Bedürfnis nach Kitsch und Komplexitätsreduktion gibt, ist die Filmkunst der Liebe in immer vielschichtigere Zusammenhänge und Formen gefolgt. So skizziert Spike Jonze mit seinem Science-Fiction-Filmdrama „Her“ (2013) die verhängnisvollen Projektionsmechanismen der Liebe in Anbetracht des Fortschritts künstlicher Intelligenz. Filme spüren der Liebe in all ihren Sphären und Abseitigkeiten nach: Als Thriller, der eine toxische Liebe entwickelt, als Science-Fiction-Abenteuer, bei dem die Liebe zwischen Mutter und Tochter die Gefüge der Universen durcheinanderbringt oder als Dokumentarfilm, der von spirituell-erotischer Liebe zu den Bäumen erzählt.
Neben der Liebe im Film darf die leidenschaftliche Liebe zu ihm nicht vergessen werden: die Liebe zum Kino. Das, was als Cinephilie einst eine Lebenswelt um den Kinosaal herum schuf – bei der das Leben zwischen den Kinobesuchen zur reinen Zwischenzeit gerann, die vermisste, ersehnte und das Gesehene schreibend verarbeitete – drang zunehmend in den Projektionsraum selbst vor. Die den Film abgöttisch Liebenden tauschten ihre zuvor gegründeten Filmzeitschriften mit dem Regiestuhl ein, produzierten in den 1960er Jahren fortan ihre eigenen Filme: leidenschaftlich, euphorisch, verrückt. Im Fortgang ergriff die Liebe zum Kino auch die Universitäten. Die Kultur- und Medienwissenschaften nahmen sich dem Film umfassend an, dachten, diskutierten und schrieben über den Film, wie es die Cinephilen ohnehin schon taten: als ernstzunehmende Kunstform. Mit der durch die technischen Umwälzungen einhergehenden Auflösung des Kino-Dispositivs entgleitet der Film dem Kino zunehmend, zerstreut sich in alle digitalen Richtungen und mit ihnen auch die Cinephilie. Manchen ist es möglich, den Film zu lieben, ohne sich dafür mit anderen in einen physischen Raum zu begeben, andere brauchen für ihre Liebe zum Film das Kino.
Auszug aus dem Konzept für das 16. Lichter Filmfest Frankfurt
0 notes
Text
DIE FREIHEIT IM FILM, DIE FREIHEIT DES KINOS

„Der Film ist eine wunderbare und gefährliche Waffe, wenn ein freier Geist ihn handhabt” – Luis Buñuel
Blickt man auf die Liste der Filmklassiker, ist das Motiv der Freiheit allgegenwärtig: In Germaine Dulacs „La souriante Madame Beudet” (1923) als eine Sehnsucht, um dem beengenden Alltagstrott der Ehe zu entkommen, in Charlie Chaplins „Modern Times” (1936) als Pendant zur repressiven Arbeitswelt oder in „Casablanca” (1942) als Grund, vor der Besatzung der deutschen Wehrmacht zu fliehen. Schon im Namen trägt sie Richard Attenboroughs Biopic „Cry Freedom” (1987), mit dem er dem Anti-Apartheids-Aktivisten Steve Biko ein filmisches Denkmal setzte. Die Science-Fiction-Trilogie „The Matrix” (1999-2003) verhandelt den Topos der Freiheit gar in seiner erkenntnistheoretischen Dimension.
DIE DYNAMIKEN DER FREIHEIT SIND ABER AUCH IN DER FILMPRODUKTION SELBST VIRULENT. IMMER WIEDER HABEN VERKRUSTETE STRUKTUREN UND BEENGENDE ERZÄHLFORMEN FREIHEITLICHE PHASEN DES AUFBRUCHS, DES EXPERIMENTS UND DADURCH NEUER PRODUKTIONSFORMEN GERADEZU PROVOZIERT. ZUMEIST HABEN SICH DIESE DANN AUCH INHALTLICH NIEDERGESCHLAGEN UND IN DEN FILMEN EINE AUF DIE GESELLSCHAFT ABZIELENDE KRITIK FORMULIERT. DARÜBER HINAUS IST DER FILM IMMER WIEDER EIN WICHTIGER KATALYSATOR POLITISCHER BEFREIUNGSBEWEGUNGEN GEWESEN.
Einer der großen cineastischen Aufbrüche ist zweifelsohne die französische Nouvelle Vague, die sich anfänglich gegen eine dem Film äußerliche Drehbuchproduktion wandte und forderte, die Filmstoffe aus den Logiken des Films selbst heraus zu entwickeln. Als ihr Begründungsfilm gilt François Truffauts Jugenddrama „Les Quatre Cents Coups” (1959), das mit seinem jugendlichen Helden, der in Widerstreit mit den ihn einschränkenden Instanzen aus Familie, Schule und Erziehungsheim gerät, gewissermaßen das Coming-of-Age-Genre vorwegnimmt und in der Schlussszene das offene Meer als Sinnbild ersehnter Freiheit inszeniert. In der Folgezeit wurden Truffauts Filme zunehmend experimenteller und brachen immer radikaler mit den Erzählkonventionen des Films. Sein Mitstreiter Jean-Luc Godard arbeitete vor allem mit neuen Schnitttechniken, Schrift-Parolen und dem Einsatz von Dokumentarmaterial und Musik gegen die Sehgewohnheiten des Kinopublikums an und überführte den Bruch mit den Konventionen auf eine gesellschaftskritische Ebene. Bereits 1960 bekam er mit seinem Film „Le petit soldat”, der die Brutalität des französischen Algerienkrieges gegen die dortige Unabhängigkeitsbewegung thematisiert, Probleme mit der französischen Zensurbehörde, die den Film erst einmal verbot.
In den USA war es das New-Hollywood-Kino, das dem Film neue Freiheiten brachte und das gesellschaftliche Freiheitsversprechen zugleich hinterfragte. Einen der größten Erfolge feierte New Hollywood mit dem Road-Movie „Easy Rider”. Weil zunächst – wie so oft bei grundlegend neuen Ansätzen – keiner an den Film glaubte, produzierte ihn Regisseur Dennis Hopper unabhängig. Erst nach Fertigstellung wurde er von der Filmindustrie aufgekauft und sodann zum Kultfilm. „Easy Rider” war frei von allem, was das alte Hollywood ausmachte. Er erzählt von Menschen, die sich ein Leben unabhängig von der Gesellschaft aufbauen wollen, die Freiheit in Drogen, Rockmusik und mit selbstgebauten Motorrädern in der Provinz suchen. Doch wenngleich der Film die Freiheit beschwört, die Suche nach ihr zeigt er als eine ausweglose: Auch fernab der US-amerikanischen Metropolen ist die Freiheit des alten Pioniergeistes nicht zu mehr finden. Allen, die sie suchen, schlägt Aggression und Intoleranz entgegen; sie stoßen auf unbegrenzte Unmöglichkeiten.
In Deutschland war es das Oberhausener Manifest, das sich 1962 gegen die künstlerische Einengung des bestehenden Kinos wandte und damit den Neuen Deutschen Film begründete. Darin heißt es: „Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle Partner. Freiheit von der Bevormundung durch Interessengruppen. [...] Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.”
Ebenfalls mit einem Manifest (Dogma 95) begründeten die dänischen Regisseure Thomas Vinterberg und Lars von Trier Mitte der 1990er Jahre die Neuausrichtung des Films und legten damit die Dialektik der Freiheit offen: Sie schränkten die Filmproduktion durch zehn Regeln rigoros ein, um so wiederum neue Freiheiten des Filmschaffens zu erzwingen. Auch im Falle der beiden Manifeste wirkten deren künstlerische Auswirkungen zugleich gesellschaftspolitisch.
Noch radikaler war dies in Südamerika (u.a. Grupo Cine Liberación), in Teilen Afrikas und Asiens mit dem „Tercer Cine“ der Fall, das sich dezidiert politisch verstand und im Kontext verschiedener revolutionärer Befreiungsbewegungen verortete. Dessen Filme dienten allesamt der politischen Aufklärung und Agitation, weshalb sie nur in eigens dafür eingerichtete klandestinen Kinos gezeigt werden konnten. Zur fragen wäre, inwiefern die digitale Revolution mit ihren neuen Vertriebskanälen zumindest in Teilen ebenfalls in dieser Tradition stehen kann.
Lange versuchte der politische Film die Massen zu erreichen. Mittlerweile bewegen die Massen die Filmkameras ihrer Mobiltelefone selbst durch die Welt. Welche künstlerischen wie politischen Impulse der Freiheit können damit einhergehen?
Auszug aus dem Konzept für das 15. Lichter Filmfest Frankfurt
0 notes
Text
Herr Bachmann und seine Klasse

Rezension zu dem Dokumentarfilm “Herr Bachmann und seine Klasse”
Maria Speths Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“ begleitet über ein halbes Jahr den Lehrer Dieter Bachmann und dessen 6b der Georg Büchner Gesamtschule im hessischen Stadtallendorf. Für Bachmann ist es das letzte Schuljahr vor dem Rentenübertritt, seine Schülerinnen und Schüler stehen vor dem einschneidenden Übertritt in das dreigliedrige Schulsystem. So üblich die Vielzahl der Migrationsgeschichten, Sprachen und Kulturen, die Bachmanns Klasse mitbringt, für die Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist, so unüblich ist Bachmanns Person und Methodik für den Schulbetrieb. Er nutzt den Klassenraum als Bandproberaum, trägt AC/DC-Shirt und Wollmütze, relativiert die Bedeutung von Noten, ohne aber den Leistungsdruck zu leugnen, und ermutigt seine Klasse bei der Suche nach der eigenen Persönlichkeit. Um die unorthodoxe wie einfühlsame Pädagogik Bachmanns zu zeigen, erlaubt sich die Regisseurin gute dreieinhalb Stunden Spielzeit, die verblüffend kurzweilig vergehen.
Die Zeit, die sich die Regisseurin Maria Speth für ihren Film nimmt, führt zur großen Qualität ihres Films. Sie ermöglicht, die Schülerinnen und Schüler in ihren Entwicklungssprüngen und Veränderungen nachzuvollziehen, auch die gewachsene Bindung zwischen ihnen und ihrem Klassenlehrer Dieter Bachmann wirklich zu verstehen. Nicht zuletzt weil man nach den gut dreieinhalb Stunden feststellt, wie sehr man sich selbst auf sie emotional eingelassen hat, so dass man am Ende des Films sorgenvoller Hoffnung ist, dass sie ihren Weg finden werden, dass es ihnen gut geht.
Neben dem Portrait dieses besonderen Lehrers und seiner ebenso besonderen Klasse ist Maria Speths Dokumentarfilm auch ein Portrait des von Migration stark geprägten Ortes Stadtallendorf. Er zeigt Straßenjzüge und Luftaufnahmen der Stadt und gibt Einblicke in Elterngespräche und damit Familiengeschichten. Auch die Geschichte des Ortes wird erzählt, indem sie Gegenstand einer Unterrichtseinheit ist, an der man gleichsam teilnimmt. So ist zu erfahren, in welchem Zusammenhang der Zuzug zahlreicher sogenannter Gastarbeiter in den sechziger und siebziger Jahren und der vorherige Bau zweier Sprengstofffabriken stehen, in denen in der Zeit des Nationalsozialismus mehr als fünfzehntausend Zwangsarbeiter arbeiten mussten.
Am Ende ist „Herr Bachmann und seine Klasse“ auch so gelungen, weil er sich dem Thema der Migration hintergründig annähert, ihre Herausforderungen und Chancen facettenreich zeigt. Denn die lange Spielzeit erlaubt es, auch eine junge Kollegin und einen jungen Kollegen Bachmanns kennenzulernen, die beiderseits einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und als in einer Szene Dieter Bachmanns Klasse ihn auf seinen Nachnamen anspricht, erzählt dieser anekdotisch, dass noch seine Eltern einen polnischen Nachnahmen trugen, der dann Anfang der vierziger Jahre behördlich „eingedeutscht“ wurde. Unklar bleibt, ob seine Schülerinnen und Schüler in diesem Moment verstehen, wie nah er ihnen dadurch rückt.
Die Rezension erschien im Rahmen des 14. LICHTER Filmfestivals Frankfurt International
0 notes
Text
Street line

Rezension zu dem Dokumentarfilm “street line”
„Street line“ ist die Fortsetzung des Dokumentarfilms „Kleine Wölfe“, in dem der Mainzer Regisseur Justin Peach den Elfjährigen Sonu porträtierte. Ein elternloses Straßenkind aus Kathmandu, das sich Tag für Tag mit etwa zehn weiteren Kindern durch die Straßen der nepalesischen Hauptstadt schlägt – auf der ständigen Suche nach Nahrung und Drogen, zwischen Gewalt und Kriminalität, manchmal aber auch mit kindlichen Momenten des Glücks. Ein gutes Jahrzehnt später ist Peach gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Filmemacherin Lisa Engelbach, erneut nach Katmandu gereist, um Sonu wiederzufinden und ihn ein weiteres Mal mit der Kamera zu begleiten. Der heute Zweiundzwanzigjährige hat mittlerweile eine dreijährige Tochter, Sona, die mit ihrer besonderen Ausstrahlung nicht nur äußerlich an ihren Vater im Kindesalter erinnert, sondern mit ihm auch das gleiche Lebensschicksal teilt: Auch Sonas Mutter hat sie wenige Monate nach ihrer Geburt verlassen, und auch ihr Vater Sonu kann sich wegen seiner Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit nicht um Sona kümmern, weshalb sie bei Sonus Schwestern gemeinsam mit deren Kindern aufwächst.
Der Film zeigt, wie Sonu mithilfe einer Drogenentzugsklinik versucht, sein altes Leben endlich hinter sich zu lassen, um für seine Tochter da sein zu können und ihr ein besseres Leben, als er es hatte, zu ermöglichen. Zugleich bereitet der Film auf das mögliche Scheitern Sonus vor, denn immer wieder wird auch sein ebenfalls drogensüchtiger und obdachloser Bruder Bikash gezeigt. Mit ihm ist zu verstehen, wie stark die Fänge der Straße, der street line, wirken, wie viel schwieriger es ist, sich den Wunden der eigenen Lebensgeschichte zu stellen, während man sich fortwährend ums Überleben zu kümmern hat, anstatt die Wunden weiterhin zu betäuben.
„Street line“ fasziniert vor allem durch die besondere Konstellation, die sich zwischen Vater und Tochter aus deren so ähnlichem Lebensschicksal ergibt. Immer wieder sieht man in der dreijährigen Sona ihren Vater und andersherum; erkennt man in Sonu, wenn auch vom Leben übel gezeichnet, seine Tochter. Man könnte sogar sagen: Mit Sona sieht man das Wirklichkeit gewordenen innere Kind Sonus, das es zu heilen gilt. Gelungen ist auch Justin Peachs Kameraführung, die sich immer wieder auf die Augenhöhe der Kinder begibt und so Bilder für die widrigen Bedingungen findet, unter denen die Kinder aufwachsen müssen – beispielsweise in einer Szene, in der sich die dreijährige Sona gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mädchen durch das Straßengewirr Kathmandus schlägt, zwischen den kreuz und quer fahrenden Motorrollern und den sie übersehenden Erwachsenen. Neben all den berührenden und schockierenden Szenen und Bildern von „street line“ ist der Dokumentarfilm aber auch ein eindrucksvolles Dokument der ungeheuren Resilienz und des unbedingten Lebenswillens von uns Menschen. Ohne die widrigen Verhältnisse dadurch legitimieren zu wollen: Es grenzt an ein Wunder, dass Menschen wie Sonu, trotz allem, was ihnen während ihrer Kindheit widerfahren ist und weiterhin widerfährt, noch am Leben sind.
Die Rezension erschien im Rahmen des 14. LICHTER Filmfestivals Frankfurt International
0 notes
Text
Should I

Rezension zur Doppel-Single „Should I“ von „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“
„To be, or not to be, that is the answer!“ beschreibt, pointiert gesagt, was „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ auf seiner digitalen Doppel-A-Seite betreibt. Diese ist nach vielen Jahren erfolgreicher Live-Performances und Konzerte die erste reine Audio-Veröffentlichung des Künstlers. Die Doppel-Single bringt Tracks zusammen, die einschlägige Bonmots der Popgeschichte umformulieren und so ins Ohr bringen, dass man wiedererkennt, aber dann auch wieder nicht. Auch verkünden beide Stücke: Vermeintliche Gegensätze dürfen nebeneinander stehen bleiben, ja, sie brauchen sich! Yin und Yang ick hör dir trapsen. Provokant verdichtet sich die einst im Refrain gesungene Frage der Band „The Clash“ nach dem Bleiben oder Gehen im Stück „Should I“: Sie wiederholt sich nahezu durch das gesamte Stück und wird so zur Antwort. Mehr Text dann gibt es im zweiten Stück namens „My body is a weapon“. Der Titel lässt an Peter Gabriels „My body is a cage“ denken. Bei Gabriel ist der Körper jedoch ein Hindernis, das uns vom Tanzen mit denen abhält, die wir lieben. Aus ihm befreien könne uns nur der Verstand. „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ schießt auf diese cartesianische Trennung: Unser Körper ist alles, ist Bluten wie Denken, und damit auch eine Waffe. Er zählt auf, was das leibliche Leben bedeutet, um schließlich die Sprache an ihre logische Grenze zu führen: „I dance until I never become old“. Damit gelingt ihm zugleich die Radikalisierung von Alphaville's „Forever young“ zur Tanzhymne!
Auch musikalisch verhalten sich die beiden Tracks zueinander wie ein sich bedingendes Gegensatzpaar. Die Kontinuität und Klarheit, die „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ seiner Stimme bei „My body is a weapon“ durch den Pitch verwehrt, übernimmt stattdessen der gerade Four-to-the-foor-Beat des Stücks, der sodann in einen ebenso klaren Wechsel aus Bassdrum und Snare übergeht. Bei „Should I“ braucht es hingegen seine Zeit, um in den unruhigen und vorspringenden Rhythmus zu finden, während der Gesang größtenteils unbearbeitet bleibt und dabei – es darf ruhig gesagt werden – in seiner Zartheit und Raffinesse an die klanglichen Qualitäten Thom Yorkes erinnert. Doch um zum Bild von Yin und Yang zurückzugehen: So wie in dem Symbol Weiß und Schwarz nicht nur ineinandergreifen, sondern ein weißer Punkt auch mitten ins Schwarze trifft und andersherum, klingt in „Should I“ das einleitend gepitchte und den Track daraufhin rhythmisierende „should“ mehr nach dem „shoot“ aus der „weapon“. In „My body is a weapon“ wiederum schlägt die rhythmische Verspieltheit seines Gegenparts kurzzeitig durch, indem der Beat aus- und wieder eingefadet wird, wodurch der gepitchte Gesang mitten auf dem Dancefloor plötzlich zur Radiomoderatoren-Stimme mutiert.
An einer geheimen Stelle des Internets findet man auf der Doppel-Single zusätzlich einen Hidden Track, der ganz wie beiläufig als eine weitere versteckte Korrektur der Pop- bzw. Rockgeschichte daherkommt. Hier entwendet „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ den „fünf Noten, die die Welt erschütterten“ („Newsweek“) und auf die Mick Jagger einst „I can't get no satisfaction“ sang, ihre „toxische Männlichkeit“, um sie in ihrer fragilen und widersprüchlichen Verzweiflung hörbar werden zu lassen. Und diesmal – ich muss es einmal mehr sagen – klingt es sogar so, als sänge Thom Yorke selbst.
0 notes
Text
Timm Ulrichs: Ich, Gott & die Welt. 100 Tage – 100 Werke – 100 Autoren

Text zu „Past – Present – Future (Die drei Lebensaltersstufen)”
Die Konsequenz inhaltsreicher Titel: Man sieht das Betitelte vor lauter Titel nicht. Kaum anders verhält es sich im Fall von Ulrichs’ Sequenz aus drei Schwarzweiß-Fotografien mit dem Titel „Past – Present – Future (Die drei Lebensaltersstufen)“, die ihn dabei zeigen, wie er mit geradezu absurd-pathetischer Ernsthaftigkeit auf einem Stuhl sitzend stufenweise ins Erdreich schreitet, sich gleichsam sein Grab „ersitzt”. Im Rückgriff auf die Titel-Trias wäre auf Ulrichs’ zum Zeitpunkt der Ablichtung gegenwärtiges Lebensalter von 37 Jahren zu verweisen, um daraufhin über den Zeitpunkt der Lebensmitte und deren Eigenarten zu sinnieren. Während man sich am Lebensanfang noch unbeschwert ganz an der Erdoberfläche befindet, von der eigenen Endlichkeit nichts ahnend, ist das Lebensende vom Tod bestimmt und man damit größtenteils im Erdboden versunken. Das Bewusstein der Lebensmitte befindet sich nun genau zwischen den vorgenannten Polen. Weil aber Ulrichs auf allen drei Abbildungen gleichen Alters ist, könnte man interpretieren, dass dem Lebenden alle drei Zeitformen gleich zugänglich sind. Frei nach Augustinus: Es gibt drei Zeiten, nämlich die Gegenwart vergangener Unbeschwertheit, die Gegenwart zukünftiger Schwere und die gegenwärtige Gegenwart als ein Sitzen im Spannungsfeld von Heiterkeit und Depression. Ebenso kann die Arbeit mit der im Titel eingeklammerten Ergänzung als Persiflage gängiger Stufenmodelle des Lebens gedeutet werden. Stellen diese das Leben doch weitgehend als aufsteigende Sinnanhäufung dar. Ulrichs hingegen dreht die Logik des Stufenmodells um und gibt sie damit der Ironie preis. Aus dem Blick gerät dabei allerdings die formale Ausgestaltung der Arbeit, ja ihre affizierende Sinnlichkeit diesseits des deutbaren Inhalts. Timm Ulrichs ist ein Ästhet, seine sogenannte Konzeptkunst komponiert und formverliebt. Warum also nicht die der Arbeit beigestellten Angaben für den Titel der Arbeit eintauschen und noch einmal auf die drei Fotografien schauen? “Past – Present – Future (Die drei Lebensaltersstufen)” hieße dann “3 dunkelbraun gestrichene Sperrholz-Stühle, 100 x 50 x 50 cm, und 2 Erdgruben, 50 bzw. 100 x 50 x 100 cm; im Gesamtmaßstab: 200 x 50 x 400 cm.”
Veröffentlicht im Rahmen der Timm Ulrichs-Ausstellung: Ich, Gott & die Welt. 100 Tage – 100 Werke – 100 Autoren. Erschienen im Katalog zur Ausstellung
0 notes
Text
Srach|er|neu|er|ung!

Einige Gedanken, Beobachtungen und Fragen zur Ausstellung in der ACC Galerie Weimar (22. August - 8. November 2019)
Während das Lesen mit den Augen die Illusion ermöglicht, über einen Text verfügen zu können, indem der Blick ihn abtasten, rückverfolgen und räumlich neu zusammenfügen kann, gibt ein vorgelesener Text Geschwindigkeit, Rhythmus und Modulation vor und fordert eine zurückgenommene „Lektüre” in zeitlicher Kontinuität.
Unter dem Titel „Spracherneurerung!” wurde die ACC Galerie Weimar zum hundertjährigen Bauhaus-Jubiläum von August bis November 2019 zu einer „Galerie der Sprache”. Ausgestellt wurden Manifeste, Zeitungsaufsätze und Texte aus den 1920er Jahren – jedoch nicht als Schau- oder Leseerlebnisse: In den Räumen der Galerie entstand vielmehr ein großes Hörspiel. Die Besucher*innen gingen nicht wie üblich an Bildern oder Objekten entlang. Von Raum zu Raum wanderten sie durch eine „akustische Rauminstallation” – so auch der Untertitel der Ausstellung.
Jedem der ausgewählten Texte war ein Raum zugeteilt, die verwinkelte Raumfolge der Galerie war durch halbdurchsichtige Stoffvorhänge in einzelne Klangräume unterteilt. Dabei erschienen die Vorhänge wie Zellschichten, sie trennten und blieben durchlässig, Kommunikation und Austausch zwischen Außen und Innen anregend. Das Motiv von Durchlässigkeit und Trennung bezog sich auf den Text „Der Raum als Membran” von Siegfried Ebeling, selbst Teil der Installation und vielleicht dessen Mitte. 1926 veröffentlicht, entwirft der Autor ein für die Zeit ganz ungewöhnliches Verständnis von Architektur: Er spricht von atmenden Wänden, Temperaturen, vom Wachsen ins Licht und in Begriffen aus dem Kreislauf der Natur und Kosmologie, in einer Sprache, die an Beschreibungen biologischer und ökologischer Prozesse erinnert. Mehr jedenfalls als an Begriffe wie „Technik”, „Mechanik” und „Rationalität”, die wir heute mit dem Bauhaus verbinden.
Vielleicht war damit auch das zentrale Motiv der Ausstellung benannt. Hier war eine Sprache zu entdecken, die zu der aus dem Bauhaus bekannten Sprache von Technisierung und Rationalisierung nicht recht passen wollte. Sie suchte sich stattdessen ihre Vokabeln, ihre Sprachbilder, ihre Metaphern und sprachlichen Vergleiche im Feld der Biologie, der Ökologie und des organischen Wachstums.
„Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau” – hatte Walter Gropius im Manifest zur Bauhausgründung 1919 geschrieben. Nicht von Ungefähr also behandelten die ausgestellten Texte mögliche neue Wege zum Bauen und zur Architektur. Vor allem aber behandelten sie auch die Bereiche, die das Nachdenken über Architektur umgeben – wie Bildung und Gestaltung und das in den 1920er Jahren neu entstehende Selbstverständnis der modernen Menschen. Die Installation „Spracherneuerung!” zeigte sich wie ein riesiger „Bauplatz der Sprache”, auf dem – eben sprachlich – Stein für Stein, Sprachbaustein für Sprachbaustein das moderne Leben, der moderne und utopische Bau errichtet wird.
Weitere Autoren der Installation waren Ernst Fuhrmann, Begründer der Biosophie als einer organisch-ökologischen Grundwissenschaft, der Architekturkritiker und frühe Gropius-Vertraute Adolf Behne und der Schriftsteller und Journalist Frank Matzke mit seinen Gedanken zur „Sachlichkeit” aus dem Manifest „Jugend bekennt: So sind wir!”. Sie alle waren aus der Perspektive der Ausstellung Architekten, Ingenieure, Gestalter einer Sprache, die nach neuer Orientierung und nach neuen Begriffen suchte.
Immer neue Worte, Sätze, Wendungen und Sprachbilder ertönten, die komplexe Absichten und Impulse in die Welt zu tragen hatten und bisweilen überforderten. Vielleicht formte der Künstler Matthew Lloyd auch deshalb in mehreren Räumen der Galerie hell leuchtende Neonröhren zu runden, eckigen und geschweiften Klammerzeichen, die sich öffneten und schlossen, ohne etwas zu enthalten. Die Texte fanden in ihnen keinen Platz, so dass man ihre Worte, wenn man denn wollte, zur Form entkleiden, d.h. zu Musik werden lassen konnte – für mich ein Vergnügen Dank der sonoren Lesestimme von Olaf Helbing.
Worte atmen
„Ein Sprachbeispiel” von Ernst Fuhrmann leitet die Ausstellung ein. Ernst Fuhrmann verfolgt anhand des Wortes „Atem” die Sprache zurück zum Anfang und erklärt ihre Geschichte zur Naturgeschichte. Worte wie Nebel, Rauch, Dampf, Dunst, selbst Wolke – Phänomene, die mit der Luft in Zusammenhang stehen – verweisen auf den Ursprung des Sprechens als ein Ein- und Ausatmen (eine Art Stoffwechsel von Innen und Außen) – ein faszinierender Gedanke. Fuhrmann mutmaßt: Die Sprache hat ihren Ursprung in der Nachbildung der Luftphänomene.
Fuhrmanns Argumenten zu folgen, gleicht einer heiteren Meditation. Schöpft Sprache nur, was bereits in der Welt ist? War Sprache gar nicht Beginn einer „Weltspaltung”, sondern brachte den Menschen mit dem „Außen” zusammen? „Atmen heißt Sprechen” – stellt Fuhrmann fest. Anders formuliert: Wer nicht atmen kann, keinen Atem hat, kann nicht sprechen.
Von gebauter und gepflanzter Architektur
Ein sinnhaftes Leben kann, so Siegfried Ebeling, erst dann wieder gelingen, wenn der Mensch in seinem Körper fundiert wird. Dafür braucht es eine „Umwertung” hin zu einer „biologischen Architektur”, die nicht mehr repräsentativ oder monumental ist. Die Wände dieser Architektur konzipiert Ebeling als Membranen. Mit ihnen wird die Architektur zum Medium zwischen Mensch und Umwelt. Sie ermöglicht eine Korrespondenz zwischen „latent gegeben, aber noch nicht biostrukturell erfaßten Feinkräften der Sphären” und „unserem Körper als plasmatisch labiler Substanz.” Die Gebäude richten sich dann ganz nach dem Licht, filtern dessen Energien, werden zu ihrer eigenen Energiezufuhr, erwachsen aus den Landschaften, in denen sie stehen, und dem Klima, das sie umgibt. „Im Gedankenkreis der biologischen Architektur wird dem Begriff ,Bau’ der Fundamentalcharakter einer transparent-negativen Funktion entwunden und dafür […] eine psychisch indifferente, unsymbolische, pathoslose Funktion intentional untergeschoben.”
Ebelings Strategie der Bedeutungsverschiebung erinnert mich an Wittgensteins Leiter: Oben angekommen, müssen wir die Leiter wegstoßen, weil uns das zurückliegende Verständnis – hier von Architektur – plötzlich unverständlich erscheint. Warum Architektur weiterhin noch bauen, wenn man sie mit allem technischen Knowhow pflanzen kann?! Das Abwegige wird zur Notwendigkeit. „Das neue Ursymbol der Architektur wird die lebende Pflanze sein”, prophezeit Siegfried Ebeling.
Das Innere der Sprache
Adolf Behne ruft zur „naturorganischen” Besinnung auf. „Diese Besinnung auf die Wurzel ist gerade für uns wichtig”, bekennt er 1921 in „Die Zukunft unserer Architektur”: „Unser Schaffen muss aus einer Urzelle naturorganisch wachsen. Wir werden unsicher im Schaffen, wenn wir, statt zu lauschen und zu pflegen, zwingen wollen.”
„Lauschen” verstehe ich als eine besondere Qualität von Hören, als ein bewusstes Anstrengen des Hörsinns. Zur Spracherneuerung gehört wohl auch die Hörerneuerung. Behne meint hier, dass man das „Moderne” erst „hören” muss und plädiert für eine gewisse „Ruhe”, Beobachtung, Vorsicht gegen falsche und vorschnelle Schlussfolgerungen, eben für eine Art des „biologischen” Wachsens, das man kaum abkürzen, verschnellern, durch Technik überspringen kann. Die Dinge werden wieder ineinandergreifen, wenn wir Komplexität beschränken und uns gleich mit – so Behnes Utopie. Interessant finde ich, dass Behne den Jugendstil als eine „optimistisch am Grundproblem vorbei empfindende Zeit” beschreibt. Weshalb das ästhetische Gefühl, wie er formuliert, eine Revolution durchgemacht hat, warum das Zweckhafte plötzlich schön und der Dekor verpönt war, vermag er nicht zu erklären. Man könnte ihn so verstehen: Der Jugendstil verwirft die geschichtlich überlieferten Formen, richtet seinen Dekor jenseits der Geschichte an der Natur aus, an Pflanzen und Insekten – er empfindet damit „optimistisch”. Doch bleibt das florale Ornament Dekor, wirkt sich nicht auf die technische Baustruktur aus und berührt damit nicht das „Grundproblem” der Architektur. Erst mit dem Neuen Bauen wandert das Biologische in das Gebäude selbst. Erst jetzt entsteht eine „biologische Architektur” (wie Ebeling sie in der Schrift „Der Raum als Membran” ausformuliert.) Könnte man es ähnlich vielleicht auch für die Spracherneuerung formulieren? Es geht ihr um das „Innere” der Sprache, ihre Struktur, nicht um deren Dekor?
Natur als Denkmedium
Erzwingt ein verändertes Denken und Wahrnehmen ein neues Sprechen? Ernst Fuhrmann sieht seine Zeit vor die Aufgabe gestellt, das gesellschaftliche Leben grundlegend zu erneuern. Dafür muss die Struktur der Zelle zur Struktur des Denkens werden. Seine Argumentationen sind bereits ein Sprechen in Biologie. Fuhrmann vollzieht, was er beabsichtigt. Auch in der Vergangenheit habe es immer wieder revolutionäre Absichten gegeben, so Fuhrmann, doch mussten diese stets scheitern, weil sie unmittelbar auf Veränderung zielten, „statt der Natur die Vermehrung des Wesentlichen zu überlassen”. Es fehlte ihnen das biologische Wissen. Mit ihm ist zu verstehen: Jeder Mensch ist eine soziologisch fixierte Zelle in Verbindungen mit anderen. Finden sie sich nach einen Umbruch allzu schnell wieder zusammen, fallen sie notwendig in alte, ihnen noch innewohnende Staatsgebilde zurück. Es braucht einen abseitigen Neuanfang, keine Intervention: „Ein neuer Kern kann nicht immer gleich eine ganze Struktur durchdringen.” Jenseits jedes etablierten Organismus’ muss also gesprochen werden, auf dass daraus langfristig ein von Altem befreites, neues System erwächst.
Wichtig: Fuhrmann appeliert an eine Ursprünglichkeit, die allerdings nicht nur zurück zur Natur, sondern hin zur Natur will. Die Einfachheit („auf einer kleinen Landfläche eine ,neue, freigesetzte Zelle’ sein”) ist für Fuhrmann nicht das Ziel, sondern die Voraussetzung, um ein neues gesellschaftliches Zusammenleben zu ermöglichen. Die Natur ist kein Zielort, sondern Medium, in das wir ins sprachlich einfinden müssen.
Sprachliche Bedeutungsverengung
Franz Matzkes Manifest „Jugend bekennt: So sind wir.” stellt am Ende der Ausstellung alle Überlegungen der Vorherigen auf den Kopf. Matzke will Seismograph seiner Generation sein und deren Haltungen dokumentieren. „Dann kamen wir und mit uns der Umschlag!”, heißt es in seinem Manifest. Matzke moniert: Das Denken und Fühlen der Menschen habe sich in der Vergangenheit verselbstständigt und sich in ausufernder Selbstreferenzialität verloren. Die Dinge und Sachen seien in den Hintergrund getreten.
Matzke dokumentiert eine Spracherneuerung, die nicht mehr das organische Wachstum, sondern den starren Zustand beschwört. Die Sinnkrise der von Ornamenten und Geschichte übervollen Welt, die es zu entstucken und zu entkleiden galt, soll durch eine „Verdinglichung” überwunden werden. Natur ist zur unbelebten Sache geworden. Tote Natur?
Die Erde als Metapher
„Wir müssen die Erde öffnen, um unsere Bauten in sie zu säen”, schreibt Adolf Behne, um daran anzuschließen: „aber wir wollen nicht vergessen, daß die Erde auch wir selbst sind.”
Wie die betonierte Bodenplatten unserer Häuser die Erde und damit uns von dem unter ihnen liegenden Erdreich trennen, so ist auch unsere Sprache als sogenannte zweite Natur von der ersteren abgetrennt. Behne scheint diese Trennung durchbrechen und uns unserer Natur radikal öffnen zu wollen. Die Zukunft kann nicht länger der Rückgriff auf die zurückliegende Kulturgeschichte sein, sondern ein Neuanfang in „planetarischer Gesinnung”. Wir sollen nicht mehr bestimmen, führen, herrschen, sondern zur Voraussetzung dafür werden, dass sich neue Ideen eigendynamisch entfalten können.
Daran schließt Behne seine Bildungstheorie an: Die „unwissende” Masse soll nicht durch eine Avantgarde aufgeklärt werden. Er propagiert dagegen eine „Gemeinschaft der Schaffenden”: „Und daher haben wir nicht dem Volk Kunst und Wissenschaft zu bringen, daß es sie konsumiere; sondern wir haben zu verlangen (und die Voraussetzungen zu schaffen), daß es sie produzieren.”
Erschienen im Journal "Sprach|er|neu|er|ung + Wort|bild|kunst" der ACC Galerie Weimar
0 notes
Text
Die Blitze kommen zwar, aber sie sind gut vorbereitet

Timm Ulrichs im Gespräch über das Wetter als Kunst, das Bauhaus als Kälte und das Verschwinden von sich selbst beim Aufräumen der Dinge
„Der Schauerromantik draußen korrespondiert unser wetterleuchtend bewegtes Innere“, schreibt Timm Ulrichs in einem Essay über den Blitz. Seit Anfang der 1960er Jahre hat Ulrichs die Phänomene der Atmosphäre behandelt und erforscht. Dabei hat er Tendenzen verdichtet und Extreme ausbalanciert – ohne zu glauben, die Kälte der Unendlichkeit mache vor der Wohnungstür halt. Im Gegenteil: Er hat, wie auch das Bauhaus, das Wetter zu einer Seite des Gestaltungsprinzips erklärt, um den Menschen andererseits durch das Medium der Kunst in Kontakt mit seinen inneren Wetterkapriolen zu bringen. Timm Ulrichs lebt heute in Hannover, ich in Frankfurt. Ende Mai treffe ich ihn zu einem Interview im Offenbacher Wetterpark.
Als wir losziehen, beginnt es zu regnen.

Anfang der 1960er haben Sie den Wetterdienst in Offenbach kontaktiert und Isothermenkarten erfragt, die sie daraufhin als Readymades publizierten. Was hat Sie daran so interessiert?
Ich war damals ein manischer Leser, bin es zum Teil noch heute, und so habe ich mich 1962 als Student der technischen Hochschule Hannover auch durch die VDI-Nachrichten geblättert. Dabei bin ich auf eine Wetterkarte gestoßen oder besser: auf einen Ausschnitt, der mir von seinem Erscheinungsbild sehr imponierte – als Bild, aber auch als eine Art Zahlengedicht. Daraufhin habe ich dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach geschrieben und weitere Karten angefragt. Ich muss gestehen, dass ich die Karten technisch gar nicht ganz verstanden habe. Ich fand sie mit ihren Höhenlinien einfach ungeheuer ästhetisch. Etwas Besseres hätte ich nicht zeichnen können. Noch immer finde ich es faszinierend, wie man solch großräumige Luftdruckverhältnisse in derlei Karten niederlegen kann, also wie sich das Unsichtbare auf Papier materialisiert.
„Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ titelte der SDS 1968 unter den Konterfeis von Marx, Engels und Lenin als Replik auf eine Werbung der Bundesbahn. Sie hingegen kontaktierten den Wetterdienst. Was war das für eine Atmosphäre, die von der Atmosphäre nichts wissen wollte, und inwieweit waren Sie dem Zeitgeist entkoppelt?
Die Studiogalerie der Frankfurter Universität, in der ich manchmal ausstellte, musste beispielsweise 1968 schließen, weil das, was in den Ausstellungsräumen verhandelt wurde, plötzlich als irrelevant, ja als reaktionär gedeutet wurde, da es von der Revolution abhalte. Natürlich galt das Wetter als Synonym für alles Belanglose. Meine Haltung wiederum war und ist es noch immer, dass es nichts Belangloses gibt, weil unter bestimmten Aspekten alles Interesse verdient. Man muss den damaligen Zeitgeist jedoch differenziert betrachten. Generell hatte ich Sympathien für die linke Szene. Lassen Sie es mich am Beispiel der Frankfurter Studentenzeitschrift Diskus erklären, deren Abonnent ich jahrelang war. Mich interessierte vor allem das Feuilleton, das damals überaus avanciert war. Es beherbergte experimentelle Autoren wie Franz Mon, Helmut Heißenbüttel, Ludwig Harig oder die Stuttgarter Schule um Max Bense. Auch ich habe mich beteiligt mit dem Manifest Was ist Kunst, mit Kanaldeckeln, die über eine ganze Seite abgebildet wurden, oder in Zusammenarbeit mit Konrad Balder Schäuffelen mit „Seriellen Formationen“ als Zeichnungen. Diese experimentellen Räume gab es zuvor so nicht, und sie wären ohne jenen politischen Zusammenhang wohl nicht entstanden.
Als ich zum Beispiel 1965 anlässlich der „Juryfreien Kunstausstellung Berlin“ mich selbst ausstellen wollte, wurde die Aktion kurzerhand verboten. Die Gründe dafür waren allesamt fadenscheinig, so dass das Verbot offenkundig seiner Begründung voranging. Es wurde argumentiert, ich hätte keinen Einlieferzettel auf dem Rücken gehabt. Zudem hatte ich einen Spiegel zur Ausstellung des Publikums angemeldet, was als „Eingriff in das Recht des eigenen Bildes“ beanstandet wurde. Der Stern machte daraus dann eine Story und schickte dafür eigens einen Fotografen, der mich im Depot, wo der Glaskasten für meine Selbstausstellung lagerte, heimlich ablichtete. Das Foto ging um die Welt und machte die Sache publik. Erst daraufhin wurde mir die Selbstausstellung als erstes „lebendes Kunstwerk“ im Folgejahr in der Frankfurter Galerie Patio ermöglicht.
Vorher studierten Sie an der Technischen Hochschule Hannover Architektur. Warum Architektur?
Ich hätte meinen Eltern nicht sagen können: Ich möchte Kunst studieren und konstruktivistische Bilder malen! Das Studium der Architektur hat zwar einerseits mit Kunst zu tun, andererseits ist es durch Vernunft ein wenig gegängelt oder sagen wir gezügelt. Es war also ein Kompromiss. Meine Eltern haben es gebilligt – der bürgerlichen Perspektive wegen.
In einem Interview haben Sie einmal das Bauhaus als künstlerisches Vorbild genannt. Heute wollen wir es genauer wissen: Was bedeutet Timm Ulrichs die Lehre des Bauhaus, und welche Rolle nimmt Ihr Architekturstudium dabei ein?
Zweifellos, gäbe es zwei Seelen in meiner Brust, die eine würde für den Dadaismus und den Surrealismus, die andere für das Bauhaus und den Konstruktivismus schlagen. Wobei: Mittlerweile habe ich ohnehin einen Herzschrittmacher, aber gehen wir einfach einmal davon aus, dass dieser für beide Pole verantwortlich sei. Dem Mythos Bauhaus bin ich regelrecht aufgesessen, ja verfallen. Neue Technologien, rationale Fertigungsprozesse, der Gedanke der Vernunft, das hat mir alles sofort sehr eingeleuchtet und imponiert. William Morris, Walter Gropius, der Architekturhistoriker Nikolaus Pevsner oder der Kunstkritiker Wend Fischer mit Bau, Raum, Gerät – all diese Personen habe ich während des Studiums mit Hingabe gelesen. Als Architekten fand ich Erich Mendelsohn besonders beeindruckend. Zu seinem Columbus-Haus am Potsdamer Platz in Berlin, das ich als Ruine noch aus eigener Anschauung kannte, habe ich mich prüfen lassen. Letztlich war die Grundlehre des Architekturstudiums in Hannover stark vom frühen Bauhaus beeinflusst und diese Grundlehre habe ich dann für mich ausgebaut. So bin ich zu meinen frühen Zeichnungen gekommen, zu „Seriellen Formationen“, „Visuellen Konstruktionen“, „Interferenzen“, Moiré-Effekten und anderen Dingen, die ich auch heute noch nicht leugnen muss. Selbst meine konkrete Poesie ist gewissermaßen als deren analoge Methode innerhalb der Sprache zu verstehen, mit ihrer Tendenz statt Stein auf Stein Wort an Wort zu setzen.
Könnte man das Bauhaus mit einem Thermometer messen, welche Temperatur würde es anzeigen?
Ich meine, es ergäbe eine gewisse Varianz an Gradzahlen. Wenn man die frühen Manifeste und Holzschnitte betrachtet, mit denen Gropius um die ersten Studenten und Künstler geworben hat, dann hat das noch sehr expressionistische, ja, hitzige Anmutungen. Nach und nach wurde es dann stetig rationalistischer – bis hin zum Architekten Hannes Meyer, der sicherlich schon eine sehr tiefe, kalte Temperatur erreicht. Freilich ist das Bauhaus insgesamt ein Projekt der Kühle, doch unterliegt es Temperaturschwankungen – je nach zeitlichem Entwicklungsstand.
Ist dieses Hitze-Kälte-Modell auch auf Ihre Arbeitsweise übertragbar?
Das Gefühlsintensive, das Expressionistische hat es bei mir nie gegeben. Ich bin nicht gefühllos, aber ehe ich etwas auf andere loslasse, wird es gefiltert. Nie sind meine Dinge aus einem spontanen Impuls heraus gemacht. Der Einfall kann ja ganz plötzlich kommen, mitten auf der Straßenkreuzung, so dass ich aufpassen muss, nicht überfahren zu werden. Schnell schreibe ich ihn mir dann stichwortartig auf die Hand, die Jahrhundertidee könnte ja auch unmittelbar wieder aus dem Kopf verschwinden. Georg Christian Lichtenberg sprach hierbei von „Pfennigs-Weisheiten“. In ruhigen Stunden lasse ich mir meine Ideen dann durch den Kopf gehen und sehe, ob sie sich halten. Manchmal schaue ich mir die Sachen nach einer Woche, manchmal erst nach Jahren wieder an. Dann überlege ich, ob die Menschheit das braucht, wie viel Geld es zur Realisierung benötigt und inwieweit sich der Aufwand insgesamt lohnt. Das alles sind mühsame Schritte. Wenn die Arbeit fertig ist, muss es so sein, dass sie die Überraschung des Moments hat, dass jemand tatsächlich glaubt, sie sei ein Geistesblitz, der aus heiterem Himmel gekommen sei, was aber eben nicht so ist. Diese Blitze kommen zwar, aber sie sind gut vorbereitet. Auch die Entladung eines wirklichen Blitzes kommt ja nicht aus heiterem Himmel, sondern auch da hat sich schon vorher etwas zusammengebraut. Meine Werke sollen bis zum Witz zugespitzt sein, aber das heißt nicht, dass die Pointe ihr eigentlicher Sinn ist. Sie ist nur die Zusammenfassung, die Synopsis, die in Blitzform aufscheint.
Diese Form des Witzes ist bisweilen, was man Ihnen an Ihrer Arbeit vorwirft. Nun wird das Bauhaus auch als pädagogische Unternehmung verstanden, den Menschen an die Kälte zu gewöhnen, die aus dem Universum auf uns niedergeht, anders als die großen Erzählungen des 20. Jahrhunderts, die ihn in einer Gemeinschaft erneut zu erheben versuchten. Soll auch Ihr Witz abseits der großen Erzählung erziehen?
Mein Problem war immer nur die Unmöglichkeit beziehungsweise unsere Unfähigkeit, die Unendlichkeit zu fassen. Mich macht fast krank, dass wir unser Leben auf dieser kleinen Erde eingestellt haben und es nicht danach aussieht, als könnten wir unser Denkvermögen und unseren Gefühlshaushalt auf andere Dimensionen im All beziehen. Meine Arbeit in aller Bescheidenheit versucht sich in Begrenzungen zu organisieren; der Witz, so verstanden, ist die pointierte Versöhnung mit dem beschränkten Leben. Schauen Sie, entgegen der Unendlichkeit beginne ich mit meinen frühen Arbeiten bei mir, bei meinem Körper, den ich befrage, vermesse, ausstelle. Von dort ziehe ich weiter und widme mich meiner unmittelbaren Umgebung, den Dingen, die mich umgeben wie etwa den Möbeln, auf denen ich sitze.
Ihr sitzender Stuhl! Ein schlichtes Sitzmöbel, dessen hintere Beine mit Scharnieren versehen sind, so dass sie zu den vorderen Stuhlbeinen hin sich kippen und den Stuhl sich setzen lassen. Eine Ent-funktionalisierung, die man auch als Kritik des Funktionalismus deuten könnte.
Klar. Eigentlich sind alle Möbel Extensionen des menschlichen Körpers, ihre Maße sind unseren Körpern angeglichen: Die Unterschenkellänge entspricht der Länge des Stuhlbeins, die Sitzfläche entspricht der Hinterngröße, die Rückenlehne nimmt den Rücken auf; manchmal gibt es auch noch Arm- lehnen. Wir haben es also mit abstrahierten Körperformen des Menschen zu tun. Das gilt natürlich auch für das Bett, den Tisch und so weiter. Mein „Sitzender Stuhl“ nun hat nicht zufällig die schlichte Form eines Bauhaus-Stuhls. Er ist weiß gestrichen und aus Vierkantholz gefertigt, ist durchweg funktional. Von eben dieser seiner dienenden Funktion will er sich nun emanzipieren, will nicht länger Knecht sein. Fortan ist er ein Gegenstand, der Individualität beansprucht, der dem Betrachter gegenübersteht, anstatt dass man ihm einfach den Rücken zuwenden kann, um auf ihm zu sitzen. Man muss ihm fortan aufrecht begegnen, ihm dabei seine Ruhe gönnen.
Wäre das Kunst oder Design?
Man könnte sagen, es ist Kunst, die Design in seiner Funktion begreiflich macht. Aber sehen Sie, meine Arbeit erschöpft sich nicht in einem einfachen Witz, es geht mir, wenngleich pointiert, um die Seinsbedingungen eines Phänomens.
Mir kommt an dieser Stelle Albert Camus’ populäre Mythos-Deutung des Sisyphos in den Sinn, mit der er seine Philosophie des Absurden entwickelt. Auch Sie fordern scheinbar ein, sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorzustellen, nur dass er bei Ihnen nicht den schweren Stein hinaufzurollen hat, sondern es genügt, wenn er in unserer Vorstellung mit leichten Bällen jongliert.
Ich mochte Camus’ Buch sehr, in den 1950ern war es ein wichtiger Text für mich. Aber diese Kärrnerarbeit, dieses Sich-Abschleppen bei gleichzeitiger Illusionslosigkeit braucht es meiner Ansicht nach tatsächlich nicht, es sei denn als Bild. Mir fällt hierzu eine Arbeit von mir ein: „Der Findling“. Zehn Stunden habe ich in einem ausgehöhlten Stein gelegen und den Stein gewissermaßen verlebendigt, während der Stein mich sozusagen hat versteinern lassen, weil ich absolut unfähig war mich zu bewegen. Manche Mythen scheinen da noch auf, aber ich habe sie bewusst nicht benannt, das Bild ist kräftig genug. Ich habe die Arbeit „Der Findling“ genannt, weil der Findling eben nicht nur der solitär liegende Stein ist, der mit der Eiszeit aus dem Norden angeschwemmt wurde und dadurch so abgeschliffen ist, sondern „Findling“ meint ja auch das Findelkind, das alleingelassene Kind, was verloren in der Welt sich finden und zurechtfinden muss, und in diesem Fall in eine steinerne Geborgenheit zurückkriecht. Mir geht es dabei, wohlgemerkt, primär nicht um eine existentielle Sinngebung, sondern um den künstlerischen Akt selbst.
Wie war das Gefühl, diese Stunden im geschlossenen Stein zu verbringen? Gab es ein Gefühl der Geborgenheit?
Wenn man das oft publizierte Foto sieht, kann man aufgrund meiner embryonalen Stellung dieses Gefühl durchaus assoziieren. Von der körperlichen Lage wäre es aber eigentlich besser gewesen, wenn ich mich mehr zusammengezogen und die Beine zusammengehalten hätte. Aber dann hätte ich einen Klumpen abgegeben und die Form des ausgehöhlten Steins wäre mitnichten so interessant gewesen, wie man sie jetzt noch immer – einer Unfallskizze gleich – im Nordhorn sehen kann, wo der geöffnete Stein mit seinen beiden Hälften liegt. Es war schon verdammt eng im geschlossenen Stein. Hinterher hatte ich Blutergüsse in den Schultern, weil die Aushöhlung nicht exakt genug war. Wir hatten jedoch zuvor keine Möglichkeit zu proben, weil ich für die Aktion extra einen Kran anmieten musste, mit dem der Deckstein dann senkrecht sehr vorsichtig heruntergelassen und später wieder hochgehoben wurde. Zu allem Übel hat ein Fernsehteam den Stein um Mitternacht der besseren Kamerabilder wegen noch mit Wasser abgespritzt. Dabei hat man voll in die Fuge des Steins hineingespritzt, so dass ich in einer Pfütze lag. Es war also alles in allem nicht sehr gemütlich. Aber das Ganze war insofern entschärft, als ich ja wollte und wusste, was ich da mache. Kaum auszudenken, wie es den Bergleuten in Lengede ergangen sein muss, die in einigen hundert Metern Tiefe verschüttet wurden. Die im Dunkeln Eingeschlossenen konnten nicht wissen, ob sie lebend wieder herauskommen würden, ob man annehmen würde, dass sie das Grubenunglück überlebt hätten und man versuchen würde, sie zu bergen. Sich in einem solchen Zweifel zu befinden, muss entsetzlich sein.
In München haben Sie einmal 20 Gehäuse, deren Sinn und Zweck es ist, Skulpturen während des Winters vor Kälte und Niederschlag zu schützen, zu einem kleine Hüttendorf formiert. Wo ist das Künstlerische dieser Hüttenarchitektur?
Es handelt sich um eine merkwürdige Hybridform anonymer Architektur, die man anders oder besser gesagt gar nicht erfinden kann. Diese Gehäuse formen das darunter Verborgene ja nur im Groben nach. Dadurch haben sie immer etwas Kubistisches an sich. Auch hängt dieser verbretterten Welt etwas Theaterhaftes an. Ihr Wert ergibt sich zudem aus der Konfrontation mit dem, was sie schützen. Oft sind die Gehäuse um Längen spannender und interessanter, als die unter ihnen liegenden altmodischen Skulpturen, so dass man eigentlich auch wieder eine Ummantelung für die Ummantelung finden müsste. Es herrscht ein absurdes Verhältnis zwischen dem zu schützenden Gut und der Schutzform.
Manche dieser Hütten haben ein Satteldach, andere ein Flachdach. Ist die Dachform einzig das Ergebnis einer funktionalen Notwendigkeit oder zeigt sich an ihr auch die Person des Gehäusebauers?
Das ist die Frage. Sie ist nicht aufzulösen. Selbst wenn der uns unbekannte Handwerker der Meinung ist, rein funktional gebaut zu haben, kann ihm sein Schönheitsempfinden dennoch ganz erheblich „hineingepfuscht“ haben. Gerade weil er kein Designer, sondern erst einmal Handwerker ist, und sich die Frage nach der ästhetischen Form nicht explizit stellt, ist sie umso stärker implizit anwesend.
Ich habe als Künstler, als Totalkünstler, nie so eindimensional gedacht, dass partout das Flachdach oder der rechte Winkel herrschen müsse. Was in meinem Kopf stets herrschen sollte, war eine gewisse Rationalität und Vernunft – das Chaos kam ohnehin ungerufen hinzu. Ein religiöses Gefühl habe ich in mir nie gefunden, es scheint mir so überflüssig wie der Blinddarm, den ich schon lange nicht mehr besitze; und weil ich mich nicht einmal anstrengen musste, irgendetwas Transzendentes zu verlieren, blieb nicht einmal eine innere Narbe, wie ich sie seit der Blinddarm-Operation äußerlich habe. Ich bin auch nie bilderstürmerisch gewesen oder kämpferisch in nur eine Fußstapfe getreten – weder in die konstruktivistische noch die dadaistische. Ich habe mir immer alles vorurteilsfrei angeguckt. Natürlich hat mich das Neue Bauen sehr interessiert. Aber dass sich die künstlerische Moderne doch auch über die Arts-and-Craft-Bewegung und den Jugendstil entwickelte, Art Déco und noch weitere Tendenzen sie begleiteten und sie schließlich zum Internationalen Stil führten, kann für mich nur bedeuten, dass man ein Nebeneinander der Stile zulässt. Es gab für mich nie das Entweder-Oder, sondern immer das Sowohl-als-Auch. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Als Schüler bin ich gerne am Niederwalddenkmal oder am Hermannsdenkmal gewesen, weil an diesen Orten ganz fremde Mentalitäts-Geschichten zutage treten, die ich emotional und gedanklich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auch diese merkwürdigen Auswüchse der Fantasie und der Gefühlswelten, denen ich selber nie angehört habe, üben eine Faszination auf mich aus.
Welche Faszination war es, die Sie dazu brachte, mit einem umgeschnallten Blitzableiter über ein offenes Feld zu laufen. Ging es dabei um eine Grenzerfahrung?
Das habe ich, salopp gesagt, allein des Fotos wegen gemacht. Schauen Sie, ich war nackt, dem Blitz ist das indes herzlich egal; er schlägt ein, wenn er einschlagen will, egal ob man bekleidet ist oder nicht. Ein bildkompositorischer Trick ohne Wirkung: Ich zeige mich entblößt, als isolierter Mensch, allein auf der Welt und unbehaust. Ich habe ja gewusst, wie selten Blitze einschlagen; die Statistik vermeldet so gut wie keine Blitz- toten. Nehmen wir an, jetzt wäre ein Gewitter, dann wäre es egal, ob wir hier so sitzen, wie wir hier gerade sitzen, oder mit einem an uns befestigten Blitzableiter. Selbst wenn ein Blitz einschlagen würde, träfe er stets die nahegelegenen sehr viel höheren Bäume. Der Wahrscheinlichkeit nach ist die Gefahr des eigenen Blitztodes so gering, dass man ihn vernachlässigen kann. Dessen ungeachtet ging ich zum Schlosser und ließ einen richtigen Blitzableiter aus Edelstahl und Kupferstange bauen.
Diese Aussagen bringen ein gängiges Narrativ über Ihre künstlerische Arbeit ins Wanken. Es heißt, sie haben den Tod herausgefordert, ihn aufgesucht. Weiterhin gibt es noch Ihre Tätowierung „The End“ auf ihrem Augenlid oder Ihr bereits existierendes Grab in der Künstler- Nekropole in Kassel. Ist Ihre Kunst zumindest auch ein Sterben-Lernen?
Das schon, an der ars moriendi bin ich schon lange dran. Bereits 1969, mit 29 Jahren, habe ich mir ja meinen Grabstein anfertigen lassen – mit dem Epitaph „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!“. Doch hatte ich nie Angst vor dem Ende. Ebenso bin ich absolut sicher, dass nach unserem Ableben nichts mehr „kommt“. Mich interessiert ausschließlich der Akt, das Sterben-Können, nicht die Vorbereitung auf ein „Danach“. In meinem bisherigen Leben ist mir der Tod nicht fremd geblieben; durch den vergleichsweise frühen Tod meiner Eltern oder den meines jüngeren Bruders. Ich selbst hatte 1952 einen Autounfall, bei dem ich mir einen schweren Leberriss zuzog; ich war fast verblutet, konnte mich nicht mehr bewegen. Das, was mich bedrückt, ist nicht mein Tod, sondern dass ich vor seinem Eintreten noch Ordnung schaffen muss. Ich habe noch so viel Zeugs, das kein Mensch außer mir in seiner Herkunft und Bedeutung ermessen kann; Manuskripte oder Briefe von Autoren, von denen die Erben nicht mal die Unterschrift entziffern könnten. Auch will ich nicht, dass meine arme Frau jahrelang meinen ganzen Müll sortieren muss. Das kann ich ihr nicht antun. Also hoffe ich, noch zehn Jahre durchzuhalten, um sie dem Aufräumen widmen zu können. Ich will mein Leben „besenrein“ verlassen.
Schauen wir uns doch einmal um. Wir sitzen die ganze Zeit über mit dem Rücken zu einer Wettermessstation. Gibt es das objektive Wetter?
Natürlich versuchen wir ein überindividuelles Verhältnis zum Wetter zu entwickeln, so dass nicht Sie oder ich sagen, wie das Wetter ist, sondern dass ein allgemeines, statistisches Mittel gefunden wird, das dann in diesen Apparaten gewissermaßen sich objektiviert. Es ist doch erstaunlich, wie unabhängig wir uns von den Messungen dann wiederum machen, wenn wir uns dem Wetter direkt aussetzen, wie sehr der Mensch doch von den Wetterverhältnissen in seinem Verhalten und in seiner Laune konditioniert ist, wie extrem abhängig unsere Stimmungen vom Wetter sind. Deshalb auch suchen wir ja diese wohl temperierten Räume, die moderaten Temperaturen unserer Zimmer auf, weil wir da weniger zu Gemütsausbrüchen neigen und uns gegenseitig anfallen. In unseren Zimmern bei Zentralheizung und mehr oder minder konstanter Temperatur können wir uns beständig und „zivilisiert“ verhalten. Das war schon ein großer zivilisatorischer Akt, dass sich der Mensch von den tageszeitlich, jahreszeitlich und sonst wie wechselnden Wetterbedingungen unabhängig machen konnte. Dank des elektrischen Lichts sind wir nichteinmal mehr an Tag und Nacht gebunden, wenngleich wir den Rhythmus über Jahrtausende noch in unserem Körper verankert haben.
Vor uns stehen 20 rote Windfahnen. Zur Verwunderung der Parkbesucher signalisieren sie manchmal voneinander abweichende Windrichtungen. Ein Schild klärt auf, dass es in der bodennahen Luftschicht oft zu Verwirbelungen kommt, weshalb an der automatischen Station der Wind in zehn Metern Höhe gemessen wird. Von Ihnen gibt es ebenfalls eine Arbeit, bei der der Wind zweier Ventilatoren zu einem unerwarteten wie verblüffenden Verhalten führt.
Sie spielen auf meine Wippe „Segnung: Mit Wind und Wellen“ mit zwei oszillierenden Ventilatoren an. Ich hatte sie für eine Jahresausstellung des Deutschen Künstlerbundes angemeldet. Allerdings war sie noch gar nicht gebaut, als die Jury sie annahm. Als wir meinen Plan dann realisierten, eine Wippe zu bauen, an deren Enden Ventilatoren befestigt sind, deren Köpfe sich in horizontaler Richtung drehen, passierte bei der ersten Inbetriebnahme zu meiner Enttäuschung zunächst gar nichts. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir verstanden, den Waagbalken so in die starre Achse zu hängen, dass sich der Drehpunkt oberhalb des Schwerpunktes befindet. Nur so bleibt die Wippe erst einmal in der Waage und kippt nicht gleich zu einer Seite. Dann haben wir zusätzlich noch mit Gewichten gearbeitet, um eine gute Austarierung zu erzielen. Auch bauten wir ein Kugellager ein, um die Widerstände zu reduzieren. Wie von Zauberhand begann sich die Wippe nach erneutem Anschalten der Ventilatoren langsam auf und ab zu bewegen; die Horizontalbewegung der Ventilatoren wird transformiert in eine Vertikalbewegung des Balkens. Manchmal lässt die Bewegung zwar kurzfristig nach, doch bleibt die Wippe in fortwährender Bewegung. Die Ventilatoren bewegen sich ja unabhängig voneinander, wie zwei Uhren ja auch nie hundertprozentig gleich gehen. Irgendwie trifft sich die Luft, neutralisiert sich oder bildet einen Rückstoß. Nehmen Sie eine Jacke und halten sie dazwischen, kommt die Wippe prompt zum Stehen. Wie sich das strömungstechnisch genau verhält, weiß ich wohlgemerkt bis heute nicht. Mir wurde immer wieder unterstellt, ich hätte im Balken heimlich einen Motor eingebaut, was aber nicht stimmt. Zwar führt ein Kabel hinein, aber nur zu dem Zweck, die Ventilatoren mit Strom zu versorgen. Ansonsten ist nichts da. Das Werk funktioniert, ich weiß nicht wie – aber wunderbar.
Kann man das Wetter ausstellen?
In einem gewissen Sinne vielleicht: In Krefeld habe ich einmal einen weißen Thermohygrografen allein zur Ausstellung gebracht. Das ist ein Gerät, wie es in den Museen meistens ein wenig versteckt in jedem der Ausstellungsräume steht und die Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit misst und zur gleichen Zeit aufzeichnet. Solch ein Messgerät stellte ich in die Mitte eines ansonsten leeren Raums, dessen Fenster geöffnet blieben. Die Ausstellung und damit die Aufzeichnung lief über sechs Wochen. Mir ging es zuerst darum, das, was den Ausstellungsbesucher eigentlich nicht kümmert, in den Mittelpunkt einer Ausstellung zu rücken. Denn das, was zum weitläufigen Inventar eines Museums gehört, hat mich wiederum oft mehr interessiert, als die eigentlichen Exponate – wie zehnmal gesehene Bilder von Gerhard Richter, die man so ähnlich wiederum schon hundertmal gesehen hat, und an denen man dann einmal mehr respektvoll vorbeilaufen muss. Letztlich habe ich aber nicht nur den Thermohygrografen zum Ausstellungsobjekt mit eigener Ausstellungsnummer gemacht. Durch das offene Fenster wurde indirekt auch das Wetter selbst fortwährender Ausstellungsgegenstand. Und da man in solch einen Thermohygrografen jeden Tag ein neues Blatt zur Aufzeichnung einlegen muss, entstanden letztlich 42 Seiten, die ich nach Ende der Ausstellung eigens zu einem Klima-Tagebuch in weißes Leinen einbinden ließ.
Könnte es sein, dass viele Ihrer Arbeiten aus jener Zeit trotz ihrer prägenden Impulse erst noch wiederentdeckt werden müssen?
Vieles aus den 1960er Jahren – und das betrifft keineswegs nur meine Arbeiten – ist dem heutigen Publikum gewiss nicht mehr gegenwärtig. Ich habe manchmal gar das Gefühl, als würde ich aus der Steinzeit berichten. Nicht, dass alles gleichermaßen vergessen wäre: Jüngere Kuratoren und Kunsthistoriker kolportieren, was einige wenige zentrale Figuren jener Zeit erzählen, so dass nach und nach eine immer verzerrtere Rückschau entsteht. Es schleifen sich so gewisse geschichtliche Entwicklungslinien ein, wie bei einer Schallplatte ein Kratzer den Tonabnehmer auf ewig in dieselbe falsche Rille überspringen lässt. Dagegen ist leider wenig zu machen. „When the legend becomes fact, print the legend“ heißt es in John Fords Spätwestern „The Man Who Shot Liberty Valance“.
Ein weiteres, moderneres Messgerät der Thermografie ist die Wärmebildkamera. Sie ermöglicht, die für das menschliche Auge unsichtbare Wärme- bzw. Infrarotstrahlung von Objekten sichtbar zu machen. Dieses bildgebende Verfahren haben Sie sich bei Ihrer „Thermografischen Wandmalerei“ künstlerisch angeeignet.
Ich kannte diesen Teil der Thermografie bereits durch das Architekturstudium. Weil ich immer unorthodoxe Selbstportraits von mir wollte, habe ich die Thermografie auch dazu genutzt, eine Wärmebildaufnahme meines Gesichtes anzufertigen. Andere Selbstbilder sind etwa ein Messerwurf-Portrait oder die Tatortzeichnung meines Körpers. Bei meiner „Thermografischen Wandmalerei“ also habe ich die Wände einer Kölner Galerie mit einer Infrarot-Kamera aufnehmen lassen, um die entstandenen Wärmebilder im nächsten Schritt als Diapositive wieder auf die Wände zu werfen. Anschließend pinselte ich tausende von Pixeln mit den ihnen eigenen Farben aus, was nebenbei bemerkt eine wahnsinnige Arbeit war. So wurden die Temperaturbedingungen der Galerie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag zu ihrem eigenen Bild gemacht. Man hat also nichts anderes gesehen als Farben, die ihrerseits mithilfe einer Farbskala in ihren jeweiligen Bedeutungen erläutert wurden.
Ob Kandinsky oder Itten: Das Bauhaus steht auch für den Versuch, die Aura der Farben zu ermitteln. Gibt es eine objektive Bedeutung solcher Farbskalen?
Ich meine, Farbbedeutungen sind stets Konventionen, die allerdings oft auch einleuchten. Dass Gelb beispielsweise komisch ist, zackig sein darf oder dreieckig, kann ich nachvollziehen. Es war Van Gogh, der in seinem knallgelben Zimmer den Wahnsinn fand. Dass Krankenzimmer grünlich sein sollen, hat mir andererseits nie eingeleuchtet. Ich finde das Grünliche eher abstoßend und für mich als Kranken inakzeptabel. Vielleicht hat es ja die heimliche Aufgabe, sedierend zu wirken. Bei der thermografischen Farbskala sind es an den Enden die Farben Rot und Blau. Auch da gibt es eine gewisse Anschaulichkeit durch das Rötliche des Feuers oder das den Himmel spiegelnde Wasser. Dennoch bleibt immer ein Rest, der nicht aufgeht, weshalb alles letztlich auch anders sein könnte.
Erschienen im Ausstellungskatalog “Ein Archiv von Hitze und Kälte” zur gleichnamigen, dreiteiligen Ausstellung im Rahmen des Kunstfests Weimar 2018
1 note
·
View note
Text
Die Anwesenheit des Wetters

Im Moment, in dem ein Gebäudeentwurf anstatt von der Fassade wesentlich von seiner Funktionalität her gedacht wird, wird er zum augenscheinlich moderierten Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen und der Witterung. Ob Regenrinne oder Dachform, Balkonausrichtung oder Fensterzahl, Rollläden oder Zentralheizung – wohltemperiert und lichtdurchflutet reduziert der Wohnapparat die äußeren Wetterextreme und verhilft zugleich zu ihrem Pläsier. Jedoch geht die Atmosphäre darin nicht auf, wie auch die Meteorologie nur eine spezifische Anverwandlungsweise des Wetters bleibt. „Denn der Schauerromantik draußen korrespondiert unser wetterleuchtend bewegtes Innere“, schreibt Timm Ulrichs in einem Essay über den Blitz. Seit Anfang der 60er Jahre behandelt und erforscht der Künstler die Phänomene der Atmosphäre. Dabei hat er Tendenzen verdichtet und Extreme ausbalanciert - ohne dem Irrglaube aufgesessen zu sein, die Kälte der Unendlichkeit mache vor der Wohnungstür halt. Im Gegenteil: Er hat wie auch das Bauhaus, das Wetter zu einer Seite des Gestaltungsprinzips erklärt, um den Menschen andererseits durch das Medium der Kunst in Kontakt mit seinen inneren Wetterkapriolen zu bringen.
Ende Mai treffe ich Timm Ulrichs zu einem Interview in Frankfurt. Wir sind für zwölf Uhr an einem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs verabredet. Von dort wollen wir gemeinsam den Wetterpark im nahegelegenen Offenbach aufsuchen. Geplant ist ein Spaziergang entlang der einzelnen Parkstationen, die den vielgestaltigen Phänomenen des Wetters gewidmet sind. Neben allgemeinen Fragen zum Bauhaus, zu dessen „Kälteschachteln” im Besonderen und Ulrichs Haltung dem Wetter und den Göttern gegenüber, sollen die einzelnen Stationen als Impulsgeber dienen, um so manche künstlerische Arbeit Ulrichs der letzten 50 Jahre assoziieren und kartografieren zu können. Dass diese sich von Beginn an bemerkenswert zahlreich mit den Dingen der Atmosphäre beschäftigen, stellt Ulrichs im Laufe unseres Gesprächs selbst scheinbar erstaunt fest.
Doch kommt es bekanntlich erstens anders und zweitens als man denkt: Den ersten Teil unseres Gesprächs verbringen wir mit dem Rücken zu einer Wetterstation auf einer Bank noch vor dem eigentlichen Beginn des Wetterparks, die zweite Hälfte über sitzen wir weitestgehend vor dem Eingangspavillon, wohin wir alleine aufbrechen, um einen Kaffee zu trinken. Dass wir zuvor in der glühenden Sonne saßen, bemerken wir erst im Schatten des Pavillons. Während sich Timm Ulrichs ansonsten nicht wirklich um die Witterung schert, schiele ich mehr und mehr gen Himmel, nachdem ich mir schon am Vorabend Sorgen machte, ob das geplante Gespräch im Freien überhaupt stattfinden könne. Ein heftiges Gewitter entlud sich über dem Rhein-Main-Gebiet und meine Wetter-App kündigte für den Folgetag Regen an. Zwar hatten sich die prophezeiten Regenwolken schon im Laufe des Morgens wieder verzogen, so dass ich erleichtert auf Ulrichs treffen konnte, doch braut sich im Laufe unseres Gesprächs ein neues Gewitter zusammen. Es windet zunehmend, blitzt daraufhin entfernt und beginnt schließlich zu regnen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits drei Stunden gesprochen, sind jedoch keinen einzigen Schritt unseres geplanten Spaziergangs gegangen. Ulrichs scheint nicht nur von allem wenig bis nichts mitzubekommen, sondern stört sich auch nicht an der wachsende Anzahl Regentropfen auf seinem schwarzen Sakko. Bevor ich vorschlagen kann, ins Innere des Pavillons zu wechseln, um von dort ein Taxi für den Rückweg nach Frankfurt zu ordern, erinnert mich Ulrichs daran, dass wir doch noch die Stationen des Wetterparks zu besichtigen haben. Und so ziehen wir bei Regen los – allein um festzustellen, dass wir wie von Geisterhand den Park im Gespräch in ähnlicher Chronologie bereits durchschritten haben. Hinfällig war der Ortsbesuch gleichwohl nicht. Weniger seine einzelnen Phänomene als vielmehr das Wetter selbst ist es, das mir mit der Wahl des Ortes schon Stunden vor, während und nach dem Interview ins Bewusstsein rückt. Mit Ulrichs Anwesenheit ist zudem zu verstehen: Wetter zu fühlen und zu begreifen, heißt nicht zuletzt, nicht ständig vor ihm davonlaufen zu müssen.
0 notes
Text
Zwischen Hashtags und Erzeugerschemata

Philipp Simon in der Galerie “Schiefe Zähne”
Das Denken hat bei denjenigen, die von Berufs wegen denken, bekanntlich nicht den besten Ruf. Kunstproduktionen vergangener Jahrzehnte flankieren die intellektuelle Kritik an der menschlichen Ratio, die sich die Welt und ihre Phänomene durch Klassifikationssysteme und Ordnungsprinzipien gewaltsam Untertan macht. Wie das Denken seine Gegenstände überschreitet, so überschreitet die künstlerische Revolte der Unvernunft fortan das Denken. Viel zu oft blieb jedoch nicht viel mehr als billige Polemik jenseits jeder ästhetischen Erfahrung.
Philipp Simon ordnet auf wenigen Metern mit seiner Ausstellung “Die dritte Person”, die derzeit in der Berliner Galerie “Schiefe Zähne” zu sehen ist, die künstlerische Kritik an den Ordnungsprinzipien selbstkritisch. An den zwei längeren und sich damit gegenüberliegenden Wänden des Ausstellungsraums hängen insgesamt vierzehn Bleistiftzeichnungen. Notabene nicht in blöder Symmetrie: eine Wand zählt sechs, die andere acht seiner Zeichnungen. Eine jede zitiert dabei einen anderen Stil und damit ein anderes, bereits bestehendes Erzeugerschema. Das zur Ausstellung ausliegende Papier, auf dem jeder Zeichnung eine Aufzählung zugeteilt ist, reflektiert diesen Sachverhalt: Wenngleich nicht konsequent, so tauchen bei einigen Aufzählungen Stilrichtungen und Künstlernamen auf. Die Aufzählungen selbst folgen keiner festen Logik. Zwar beginnen sie allesamt mit der Trias „image, natural, drama“, daraufhin jedoch fügen sich Adjektive ohne erkennbares System an Städtenamen und Währungseinheiten, Geschlechterzuschreibungen an Tageszeiten und Zeitformen. Anders als zu vermuten eröffnen die Aneinanderreihungen neue Ebenen und erweitern die Wahrnehmung anstatt sie zu verengen. Nur an einer Stelle wird der offene Charakter der Enumeration gleichsam ironisch gestört. Das aufgezählte „daskindwillnichtzumimpfengehen“ verknappt die Wahrnehmung der Zeichnung nachhaltig und erinnert uns dadurch an den Rubrizierungscharakter millionenfacher Hashtags unserer digitalen Gegenwart. Bilder und Fotos vollkommen zu verstehen bedeutet ihr Ende. Eben dies bringt Simon zur Einsicht, indem er nicht die Kategorien an sich verneint, sondern deren Gebrauch differenziert.

Nicht nur durch die ihnen gemeinsamen Listen korrespondieren die Zeichnungen miteinander. Statt einzeln werden sie durch eingeschnittene Wellpappen gerahmt, die ihrerseits aneinanderhängen. Durch die kleinen Fugen, die sich zwischen den großflächigen Pappen ergeben, entsteht ein Raster – und damit ein visuelles Äquivalent zur Klassifizierungsleistung des Denkens. Doch taugt das Raster nicht zum Ordnungsprinzip der Ausstellung, da sich die einzelnen Zeichnungen ihrerseits ordnen, indem sie in gleichem Abstand zueinander gehängt sind und dadurch an manchen Stellen die Fugen der Pappen überschreiten. So ergibt sich ein formaler Widerstreit der verschiedenen Ebenen. Die Grenzen des Rasters sind durchlässig.
Mitten durch den Ausstellungsraum – parallel zu den beiden Wänden mit den Zeichnungen – hat Simon ein horizontales Gitter aus Spanplatten eingezogen, das das Durchschreiten seiner Ausstellung kontrolliert. Es zwingt zur fixen Chronologie. Man muss zuerst eine der Wände ablaufen, um zur gegenüberliegenden Wand zu gelangen. Bei letzterer angekommen, entdeckt man hinter der Gitterwand, deren Ende vollständig verkleidet ist, jeweils zwei rechtwinklig ineinander gesteckte Pappen, auf die Simon Gesicht bzw. Hinterkopf und Profil zweier Menschen gezeichnet hat. Während die Bleistiftzeichnungen an den Wänden allesamt den Charakter von Vorstudien noch zu realisierender Bilder haben, sind die beiden Köpfe Abstraktionen. Bewegen sich die Zeichnungen hin zu etwas, bewegen die Pappgestelle der Köpfe sich von ihrem Bezugspunkt weg. Gleichzeitig erinnern die beiden abstrahierten Köpfe an die Erkenntnis der Wahrnehmungstheorie, dass man stets nur einen Teil einer Sache sehen kann. Schaute man aus allen möglichen Perspektiven gleichzeitig auf den Kopf, fiele er in sich zusammen. So wären auch die Zeichnungen selbst dann noch vorläufig, wenn sie zu Bildern würden. Es gibt kein Ankommen, keine Endpunkte, kein An-sich, wie auch jede Aufzählung genuin unvollständig, stets weiterführbar ist.
In seiner Vorläufigkeit ist auch das Denken zu retten, als behutsame Hypothese behält es sein Recht. Dass über Philipp Simons Zeichnungen an dieser Stelle nicht mehr geschrieben steht, bedeutet die Einsicht in die Grenzen der Theorie. Deshalb lohnt ein Besuch der Ausstellung umso mehr.
Erschienen in der einunddreißigsten Ausgabe des Kunstmagazins ‘vonhundert’
0 notes
Text
Sie sind jetzt!

Vier mögliche Wege in Richtung Bauhaus-Jubiläum
Mit dem Bild des Konzerts beschreibt Stephan Dorgerloh, Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, die zahlreichen Veranstaltungen, die das im Jahr 2019 anstehende hundertste Gründungsjubiläum des Bauhauses begleiten. Das Verbundprojekt „Große Pläne!“ im vergangenen Jahr sei der Auftakt, schreibt er im Vorwort für den Ausstellungskatalog der zentralen Verbund-Ausstellung „Moderne Typen, Fantasten und Erfinder“, die im Bauhaus Dessau gezeigt wurde. Ein Auftakt, der – um im musikalischen Bilde zu bleiben – willentlich allerlei Dissonanzen erzeugt, die so einfach nicht mehr aufzulösen sein werden. Denn die Verbundausstellung macht durch ihre räumliche Zerstreutheit deutlich, was sie zugleich auch inhaltlich allerorten aufzeigt: Die Zeit des Bauhauses war mehr als dieses, ja sie bleibt bei all ihren Synergien zwischen den Akteuren in ihrer Vielschichtigkeit und Dezentralität unverstanden, solange man sie auf das Bauhaus reduziert. Letztlich ist der „Mythos Bauhaus“ für das Land Sachsen-Anhalt Fluch und Segen. Zweifellos exponiert er durch seine nicht nur kunstgeschichtliche Prominenz den Standort Dessau als Marke. Zugleich aber verstellt er den Blick auf das weitmaschige Geflecht zwischen zahlreichen Orten und Akteuren, mit dem erst zu verstehen ist, welch bedeutende Rolle die Region Sachsen-Anhalt als „Land der Moderne“ geschichtlich einnimmt. Es ist für die Kulturpolitik des Landes im Hinblick auf das anstehende Jubiläum also ein schmaler Grad, im Versuch, die Strahlkraft des Bauhauses auf weitere Städte, Institutionen und Einzelpersonen auszuweiten, jenes dabei schlussendlich nicht zu schwächen.
Die einleitend beschriebenen Dissonanzen ergeben sich nicht nur aus dem Widerspruch zur bisher beengten Wahrnehmung der klassischen Moderne. Auch untereinander fügen sich die einzelnen Ausstellungskonzepte keineswegs harmonisch ineinander. Vielmehr ermöglicht ihr Kontrast, Möglichkeiten und Grenzen des Ausstellens auszuloten. Vor allem interessiert hierbei die zentrale Verbundausstellung „Moderne Typen, Fantasten und Erfinder“, die gegen den Strich des Musealen rettet, was sie ausstellt, indem sie es dem Schleier der Vergangenheit entreißt. Was das vielfältige Angebot des Verbundprojekts „Große Pläne!“ anbetrifft, erhebt der Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit: teils zufällig, mehr dem eigenen Interesse und Kalender geschuldet, besuchte der Autor dieses Artikels Anfang Dezember vier Ausstellungen. Neben der vorgenannten im Bauhaus Dessau waren dies zwei Ausstellungen in Magdeburg – zum einen zur Baukunst von Carl Krayl mit dem Titel „Bunte Stadt – Neues Bauen“ , zum anderen zu Magdeburg als Reklame und Ausstellungsstadt der Moderne unter dem Namen ‚Maramm’ – und eine Ausstellung in Merseburg über die hundertjährige Geschichte der Leuna-Werke.
Formal in einem engeren Zusammenhang stehen die Ausstellungen zu Carl Krayl und den Leuna-Werken. Erzählt letztere die Geschichte einer Institution, schildert die Ausstellung über Krayl die Biographie eines Architekten. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Chroniken: Krayls Schaffen ist begrenzt durch seine Lebenszeit, zudem durch die politischen Umstände, die ihn in seiner Arbeit mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten schlagartig beschneiden, während die Leuna-Werke je nach politischer Ideologie wirtschaftlich und propagandistisch genutzt werden und als Medium der Systeme diese stets überdauern. D.h. während Carl Krayl im Jahr 1890 geboren wird und 1947 stirb, wovon die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen für ihn als Akteur des Neuen Bauens die entscheidenden sind und zugleich den Mittelpunkt der Ausstellung bilden, dauert die Geschichte der während des ersten Weltkriegs gegründeten Leuna-Werke bis in die Gegenwart an und reflektiert damit ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Bei beiden Ausstellungen wird der Raum genutzt, um die Geschichte Schritt für Schritt und damit chronologisch zu erzählen. Doch unter verkehrten Vorzeichen: Krayl wird mit seiner Biographie eingeführt und erst daraufhin je nach dokumentierter Schaffensperiode zeitgeschichtlich eingeordnet, indem man seine Verbindungen zur jeweiligen Kulturströmung herausstellt. Bei den Leuna-Werken hingegen wird in einem Vorraum kein umfassender Überblick geboten, sondern lediglich die zeitgeschichtlichen Umstände der Werksgründung dokumentiert. Es sind zwei mögliche Antworten auf die immer gleiche Frage nach dem Verhältnis zwischen Allgemeinem und Einzelnem. Paradoxerweise nähert sich die Merseburger Ausstellung über die Leuna-Werke ihrem eng mit der Schwere und Tragik des 20. Jahrhunderts verbundenen Gegenstand zumeist anekdotisch, während in der Ausstellung zu Krayl die künstlerische Produktivität einer Einzelperson, die zwischen den Gräuel der Kriege erblüht, nüchtern und sachlich geschildert wird.
100 Jahre Leuna Werke: Ungleichzeitigkeiten zwischen Alltag und Politik
Im Vorraum der Merseburger Ausstellung finden sich Plakate, die vor den alliierten Fliegerangriffen in Ludwigshafen warnen, ein Brief an die Werksleitung, in dem sich ein Landpfarrer über die seine Äpfel stehlenden Wanderarbeiter beschwert und ein Foto, auf dem Ingenieure vor einem Ammoniak-Zug posieren, der mit Tannenzweigen geschmückt ist und auf den man mit Kreide „Glückauf! Franzosentod!“ geschrieben hat. Es sind teils abwegige, teils verstörende Dokumente, die da in Konstellation gebracht werden, um den Zeitgeist zur Gründung der Leuna-Werke zu erfassen. Der skizzenhafte Charakter im Vorraum der Ausstellung bereitet in seiner formalen Verdichtung aber auch auf den Ausstellungscharakter selbst vor: Die Geschichte der Leuna-Werke – und damit verbunden die Wirren der Weimarer Republik, der Wahn des Nationalsozialismus’, die Gräuel des zweiten Weltkriegs, schließlich der Hochmut des Realsozialismus’ – zersplittert zu unzähligen Geschichten aus Alltagsfetzen, Eigensinn, Produkten, Paraden, Nebensächlichkeiten, naturwissenschaftlichem Know-How und Pointen. Eine Zapfsäule, Illustrationen der IG-Farben, die für die Autarkie des 3. Reichs werben, Dederon-Kittel, Grillanzünder, Werbetafeln für Kopfschmerzmittel, ein Caprolactam-Sack, Werbe-Postkarten für Düngemittel, amerikanische Luftaufnahmen der Leuna-Werke während ihrer Bombardierung und eine Granate der März-Kämpfe folgen auf Modelle des Zollinger-Daches oder einer Raffinerie. Bei manchen verdichteten Zeitdokumenten gerät man ins Stocken, ob ein Foto eines grinsenden Göring vor einer Abbildung der Leunawerke oder eines, das drei Zwangsarbeiter zeigt, oder ein Brief, der „Fremdarbeitern“ das Baden untersagt, eingedenk der allumfassenden Katastrophe nicht pietätlos ist. Es ist ein schmaler Grad, den der Kurator Niklas Hoffmann-Walbeck beschreitet, da seine sehr speziellen Zeitdokumente gegenüber dem gesellschaftlichen Ganzen inadäquat erscheinen. Doch indem er die Leuna-Werke in launige, absurde und sperrige Reminiszenzen ausfranzen lässt, umgeht er gleichsam das vermeintliche Potential, anhand eines spezifischen Ortes das kollektiv verankerte Gedächtnis durchzuspielen. So bewahrt er seinen Gegenstand davor, einzig zum affirmativen Instrument des je eigenen Geschichtswissens zu degradieren. In den Diskrepanzen zwischen Ort und Zeitenwenden werden die Ungleichzeitigkeiten zwischen Alltag und Politik bemerkbar. Nur so sind die Leuna-Werke in ihren Lebenswirklichkeiten und Eigenheiten zu erfassen.
Carl Krayl: Mit Taut aus dem Schatten von Taut
Ein durch Jahreszahlen und in kurze Absätze gegliederter Werdegang eröffnet die Ausstellung zu Carl Krayl. Immer wieder fällt der Name Bruno Taut, der Krayl 1921 schließlich an das Hochbauamt der Stadt Magdeburg als Leiter des neugeschaffenen Entwurfsbüros berufen sollte. Auch Walter Gropius, die Gebrüder Luckhardt, Hans Scharoun oder Max Taut finden Erwähnung, mit denen Krayl sich in der von Bruno Taut initiierten Künstlergruppe „Gläserne Kette“ organisiert. Zudem taucht der Name des für die Entwicklung des Neuen Bauens in Deutschland einflussreichen Architekten und Rotterdamer Stadtbaumeisters J. J. P. Oud auf. An der Mailänder Triennale „Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna“, die eine Übersicht über die europäische Architekturmoderne lieferte, nahm Krayl noch im Jahr 1933 teil. Zahlreiche wegweisende Gebäude in Magdeburg aus der Feder von Krayl werden genannt. Es sind Referenzen, die zu verstehen geben, was der in die Ausstellung einführende Text wie folgt formuliert: „So steht es immer noch aus, Carl Krayl als einen für ganz Deutschland bedeutenden Architekten der Zwischenkriegsmoderne wiederzuentdecken und als einen der wichtigsten Akteure der Magdeburger Moderne der 20er Jahre anzuerkennen. Erst dann wird Carl Krayl endgültig aus dem Schatten von Bruno Taut herausgetreten sein.“ Doch wie Krayl zu Lebzeiten erst durch Taut zur eigenen Karriere kam, braucht es diesen zu Beginn der Ausstellung einmal mehr als Referenz, um Krayl zur notwendigen Aufmerksamkeit zu verhelfen – mit dem Ziel ihn schließlich emanzipieren und zu einer eigenständigen Wahrnehmung verhelfen zu können. Nicht weniger als ein Wahrheitsstreben kennzeichnet dieses kuratorische Motiv, aus einem Erkenntnisinteresse heraus über die Geschichte wahrhaftig aufzuklären. Dieses Streben ist eng verbunden mit einer Moral, die vor den Toten nicht halt macht, sondern auch ihnen Gerechtigkeit wiederfahren lassen möchte. Über das Prinzip der Ausstellung klärt diese indirekt selbst auf. Sie zeigt gegen Ende Aufnahmen des 1936 fertiggestellten Oli-Kinos („Olvenstedter Lichtspiel“) – das letzte Projekt, das Carl Krayl in Magdeburg zur Ausführung bringen konnte. Man erfährt, dass das Gebäude ursprünglich eine sehr viel modernere Fassadensprache aufwies, zudem ein flaches Pultdach erhalten sollte. Doch war Krayl durch die mittlerweile nationalsozialistische Baupolitik zu einer Überarbeitung mit vielen Konzessionen gezwungen. Beispielsweise wurde das flachgedeckte Dachgeschoss zu einem Vollgeschoss mit aufgesetztem Walmdach erweitert. Nach der teilweise erfolgten Zerstörung im zweiten Weltkrieg erlebte es zu DDR-Zeiten weitere Modifikationen. 1997 wurde das Kino schließlich geschlossen. Ein Filmenthusiast nahm sich dem Gebäude daraufhin an, ließ es sanieren und die Schauseite dabei so umgestalten, wie es Krayls ursprünglicher Entwurf vorsah. So konnte das Kino im Jahr 2002 erstmals im Antlitz des neuen Bauens wieder in Betrieb gehen. Wie Krayls Kino-Bau wurde auch sein Wirken durch die politischen Systeme korrumpiert und später schlichtweg übergangen. Die Ausstellung möchte es gleich jenem Filmenthusiasten in seiner einstmaligen Bedeutung freilegen. Aus dieser Motivlage heraus ist ihre Konzeption verständlich, ja strukturell nahezu notwendig, auf dass Krayl so hoffentlich zu verdienter Würdigung findet, damit zukünftig weitere, experimentellere Ausstellung folgen können.
Moderne Typen, Phantasten und Erfinder: Die Melancholie verlorener Wirklichkeiten
Experimentell, ja geradezu subversiv war zweifellos die zentrale Verbundausstellung „Moderne Typen, Phantasten und Erfinder“. Ihr eigentlicher Gegenstand waren dabei weder Protagonisten noch Institutionen der Zwischenkriegsmoderne, sondern letztlich der dieser eignende Geist des Aufbruchs. Ein Geist, der alle Lebensbereiche umfasste und in seiner radikalen „Jetzt-Zeitlichkeit“ Zukünfte entdeckte. Aus Robert Musils Mann ohne Eigenschaften kennen wir die anthropologische Unterscheidung zwischen einem Wirklichkeits- und einem Möglichkeitssinn. Während jener einzig wirkliche Möglichkeiten sieht, eröffnen sich diesem mögliche Wirklichkeiten. Verkürzt gesagt unterscheidet Musil zwischen einem sogenannten realistischen Denken, das immer ausgeht von dem was ist, und einem utopischen Denken, für das die Welt auch anders sein könnte. Zwischen den Weltkriegen ergab sich nun scheinbar eine ganz besondere geistige Konstellation: Beide von Musil diagnostizierten Sinnesweisen fanden in dieser kurzen Phase zusammen, so dass die möglichen Wirklichkeiten selbst zur wirklichen Möglichkeit wurden. Utopische Planungen, Vorstellungen, Entwürfe und Träume ergaben sich im Spannungsfeld zwischen Industrie und Arbeit, zwischen Maschinenzeitalter und junger Demokratie, aus dem heraus sich alles damit in Beziehung stehende entwickelte – Architektur, Design, materielle Strukturen ebenso wie Lebenswandel, Attitüde und Sentiment. Oder anders formuliert: Die technischen Möglichkeiten und Innovationen standen kurzzeitig in keinem Gegensatz zum objektiv Vernünftigen. Dass Janek Müller und Torsten Blume mit ihrer Ausstellung „Moderne Typen, Fantasten und Erfinder“ diesen Geist der Moderne begreiflich machen – in einer disparaten Zeit ohne eigene Gegenwart, in der mancher sich hinter die verstuckten Fassaden der Gründerzeit sehnt, um dort sodann die Tapeten von den Wänden zu reißen – ist ihnen nicht hoch genug anzurechnen. Dies gelingt ihnen wie einleitend beschrieben, indem sie gegen den Strich der Geschichte ausstellen. Nach gebauten Bauten, hergestellten Produkten und gewesenen Ereignissen sucht man vergebens. Die Ausstellung verzichtet auf die heutigen Denkmäler, Designklassiker und Ergebnisbeweise der klassischen Moderne. Stattdessen zeigt sie Entwürfe, Skizzen, Planungen und träumerische Vorstellungen, und insinuiert so das „vergangene Neue“ einmal mehr zum Denkraum des Zukünftigen.
Gleich zu Beginn sind es die allen Exponaten vorgestellten Rohstoffe Braunkohle, Galenit und Kupferschiefer, die als Metaphern des Industriezeitalters zugleich auf ihre Gegenwart verweisen, weil sie als „ungeformte“ frei davon sind, historisiert zu werden. Sie sind mögliche Wirklichkeiten – sind hier und jetzt. Auch die auf sie folgenden Exponate werden durchweg dem Schleier der Geschichte entrissen. Grund dafür sind die sie umgebenden Gegenstände: orangefarbene Abwasserschächte, Schraubzwingen, Holzstreben, schwarze Zurrgurte und mitteldichte Faserplatten arrangieren zusammen mit seriell angeordneten prominenten HL 99-Pendelleuchten die vielzähligen Pläne, Skizzen, Modelle und Entwürfe. Diese provisorische Ausstellungskulisse, die uns in ihrer heutigen Ästhetik erinnert, dass die Anfang des vergangenen Jahrhunderts um sich greifende Produktionsweise fortbesteht, tritt nicht in Differenz zu den Exponaten, sondern provoziert den kaum erträglichen Gedanken: sie waren genauso gegenwärtig wie wir es sind, ja sie entstammen der gleichen beständig fortwährenden Gegenwart. Blochs Einsicht, jeder Verwirklichung eines Traums folge eine Melancholie der Erfüllung, wird auf die Gegenwart des Ausstellungsbesuchs selbst übertragen. Das gewesene Neue, das in Modernität und ästhetischem Neuerungswert das Jetzige weit hinter sich lässt, weil es auf eine andere, eine neue Wirklichkeit abzielte, führt zu der ernüchternden Erkenntnis, dass etwas verloren ging, weil gegenwärtig unmöglich ist, was doch möglich wäre.
Melancholie dort, Materialfülle hier: Erkenntnisdialoge zwischen den Orten
Bereits durch manche von Müller und Blume ausgestellten Objekte – wie ein rekonstruiertes mechanisches Schaufenster zur Produktplatzierung nach Plänen von Franz Ehrlich – wird deutlich, dass die ästhetischen Formbildungen der zwanziger Jahre zwar auf ein gesellschaftliches Ganzes zielten und das auf der Höhe ihrer Zeit, ohne dabei aber in eine Frontstellung gegen die entwickelten Produktivkräfte zu geraten. In ihrer politischen Pluralität sind sie keineswegs auf die abstrakte Negation der kapitalistischen Wirklichkeit verpflichtet. Deutlicher noch wird diese Erkenntnis beim Besuch der Ausstellung zu Magdeburg als Reklame- und Ausstellungsstadt der Moderne. Ob Bruno Tauts Aufruf zur farbigen Stadt oder die Reproduktion seines Kiosk-Häuschens, Fotos der weltweit beachteten Deutschen Theater-Ausstellung im Jahr 1927, Firmenzeichen Wilhelm Deffkes oder die Reklamesäulen und Plakate Walter Dexels – in überbordender Fülle wird die Verflechtung zwischen entstandener Konsumkultur und künstlerischer Avantgarde dokumentiert. Werbung war über den Kaufanreiz hinaus auch immer ein mögliches Erziehungsmittel in der Kommunikation mit dem modernen Menschen.
Zur vorgenannten Einsicht in die ideologisch nicht zu vereinnahmende Utopie jener Zeit verhilft die zentrale Verbundausstellung aus Dessau im Hintersinn. Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Erkenntnisdialoge zwischen den einzelnen Verbundausstellungen, die in ihrer örtlichen Versprengtheit nicht nur die geographische Ausdehnung der Moderne im heutigen Sachsen-Anhalt nachvollziehbar werden lassen, sondern auch genügend Zeit zur Besinnung geben. Abschließend bleibt aber festzuhalten, dass einzig die zentrale Verbundausstellung „Moderne Typen, Fantasten und Erfinder“ das Verständnis jener vergangenen möglichen Wirklichkeiten ermöglicht – auch im Dissens zu allen anderen Verbundausstellungen. Weil sie die Zeugnisse der klassischen Moderne nicht als historische Zeugnisse ausstellt. In ihrer Bedeutung sind sie bloß zu verstehen, wenn man die Menschen mit der kaum zu begreifenden Wahrheit konfrontiert: sie sind jetzt!
Auftragsarbeit für die Stiftung Bauhaus Dessau
0 notes
Text
Unterirdische Unendlichkeiten:

Der Frankfurter U-Bahnhof Bockenheimer Warte
Denkt man an Frankfurt, kommen einem gemeinhin die Wolkenkratzer der Mainmetropole in den Sinn. So sind die zusammenhängenden Hochhauspulks der amerikanischsten aller deutschen Städte etwas Besonderes – für die Bundesrepublik, aber auch für den gesamten europäischen Kontinent. Wenngleich nicht weithin sichtbar und ohne Breitenwirkung ist aber auch die unterirdische Stadtarchitektur Frankfurts vielerorts bemerkenswert. Gerade weil U-Bahn-Stationen ein Städtebild sehr viel weniger prägen und zumeist nur hastig durchschritten werden, ist es umso beachtlicher und damit ebenfalls eine Frankfurter Besonderheit, dass viele ihrer Stationen von hohem architektonischen Wert sind. Vor allem die Haltestellen der Linien U4 und U6 beziehungsweise U7 sind hierbei zu erwähnen. Ob Messe, Willy-Brandt-Platz, Dom/Römer oder Ostbahnhof, Zoo, Alte Oper und Westend: alle Stationen bezeugen architektonische Raffinesse und setzen die oberirdischen Lebenswelten der Stadt vielgestaltig fort. Ihre Gestaltung ist dabei weder so prunkvoll wie die altehrwürdigen Hallen der Moskauer U-Bahn, noch so effekthascherisch wie die als ‚Kunst’ sich geradezu aufdrängenden Metrostationen Neapels. Aber allein, dass sie in hoher Dichte einen sensiblen Gestaltungswillen aufweisen, unterscheidet sie von den meisten U-Bahnhöfen anderer deutscher Großstädte.

Die wohl herausragendste aller Frankfurter Stationen, die als Umsteigestation vorgenannte Linien zusammenführt, ist der U-Bahnhof Bockenheimer Warte unweit des alten Campus’ der Goethe Universität. Bereits einer ihrer Eingänge weiß zu beeindrucken. Ähnlich den surrealistischen Bildern René Magrittes steht man bei diesem vor einer bildgewordenen Erzählung, deren Interpretationen allesamt ins Leere laufen. Ein Straßenbahnwagon des späten 19. Jahrhunderts hat aus dem Untergrund kommend den Gehweg schräg nach oben hin aufgebrochen und scheint nur so allererst zum Stillstand gekommen. Etwa die Hälfte des Wagons liegt frei und geleitet in die Tiefen der Station, drumherum Geröll und durchbrochenes Straßenpflaster. Doch was hatte eine Straßenbahn um Himmelswillen untertags verloren, fragt sich der Deutende. Und warum sehen wir einen Wagon und nicht den immer vorneweg fahrenden Triebwagen? So wirklich zusammen passt das nicht. Marx notierte einmal, Revolutionen seien die Lokomotiven der Geschichte. Vielleicht sieht so ja das Ergebnis der gescheiterten 68er-Revolte aus, die neben Westberlin bekanntlich in Frankfurt ihr Zentrum hatte. Mancher könnte sich in seinem Vorwurf bestätigt sehen, dass man versuchte, der Gegenwart mit veralteten Begriffen von Imperialismus und Klassenkampf Herr zu werden – so unpassend wie ein alter Straßenbahnwagon auf U-Bahngleisen – andere erkennen in der fehlenden Lok vielleicht die den Studierenden damals fehlende Massenbasis.

Dass etwas zum Stillstand gekommen ist, vergangene Impulse verloren gegangen sind, macht einem das Innere der Umsteigestation verständlich. Die Bahnsteige der hier auf gleichen Gleisen verkehrenden Linien U6 und U7 sind mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Fotografin Barbara Klemm gesäumt, die den universitären Alltag der Goethe-Universität Mitte der 80er Jahre zeigen – zu einer Zeit als noch keiner wissen konnte, dass dreißig Jahre später die meisten Institute den an die Station angrenzenden Campus längst geräumt haben werden, um fortan auf dem IG-Farben-Gelände im Westend zu residieren. Ein gut besuchter Lesesaal ist zu sehen oder ein kniender Student vor einem vollgehängten Anzeigenbrett. Eine andere Aufnahme zeigt den mittlerweile verstorbenen Adorno-Schüler Alfred Schmidt bei einem seiner Seminare – mit Aktenkoffer und verbissenem Blick. Weitere Motive sind ein überfüllter Hörsaal während einer studentischen Vollversammlung, die sich bloß modisch von denen der späten 60er unterscheidet, eine vor ihren Staffeleien sich selbst überlassene Malklasse im Fachbereich Kunsterziehung, die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf bei ihrer Poetik-Gastvorlesung, oder aber ein neugeborenes Kind im Kreis forschungswütiger Akademiker.

Ihnen allen gemeinsam ist ihre uns heute merkwürdig erwachsen erscheinende Physiognomie. Es fällt auf, dass keiner hinter die Architektur des Raums zurücktritt, dass keines ihrer Lächeln für die Institution wirbt, die sie beherbergt, und damit instrumentell entmündigt wäre. Ja, sie alle stehen bemerkenswert souverän im eigenen Leben. Der Kniff der Station ist, dass sie uns mit dieser Wahrnehmung nicht unbedarft in den gleich einfahrenden Zug steigen lässt – denn plötzlich erblicken wir uns selbst. Links und rechts jeder Aufnahme sind Spiegelstreifen angebracht, in denen wir uns beim Betrachten der Fotografien mit einem Mal selbst zu Gesicht bekommen. Gleichsam werden auch wir im Spiegel zur Momentaufnahme und damit wird nicht weniger als die gängige Illusion zerstört, Aufnahmen einer anderen Zeit seien gewissermaßen auch Aufnahmen aus einer anderen Welt und damit weit weg von uns. Augenblicklich gehen uns die fotografierten Menschen ganz unmittelbar etwas an, weil wir uns vor uns selbst abgebildet sehen und damit zu begreifen gezwungen sind: Diese Situationen waren genauso gegenwärtig wie wir jetzt es sind. So verstörend der Gedanke ist: es gibt nur diese eine beständig fortwährende Gegenwart. Die Menschen, die da waren und so nicht mehr sind, fehlen, weil sie hier und jetzt waren.

Die Einsicht, dass jeder gegenwärtige Moment unwiederholbar vergeht, obzwar das Leben in seiner physischen und damit fotografierbaren Realität einzig aus diesem besteht, lässt das Denken kurzerhand ins Leere laufen, in die leere Unendlichkeit. Bereits in der Verteilerhalle konfrontiert Architekt Udo Nieper die Passanten seiner Station mit der räumlichen Unendlichkeit, indem er sie durch einen scheinbar nicht enden wollenden Säulenwald laufen lässt. Rund 65 Säulen und Halbsäulen sind zu zählen, die keinerlei tragende Funktion haben. Als raumbildende Elemente aber schaffen sie die Illusion des nicht enden wollenden Raums, die zusätzlich noch von den großen Spiegelflächen an den Wänden der weitläufigen Verteilerhalle gestützt wird. Wie jeder Sinn aus der ins Unendliche aufgesprengten Zeit zerrinnt, so geht auch jede räumliche Ordnung ohne Begrenzung verloren. Um diesen Gefahren von Raum und Zeit zu entkommen, erfand der Mensch laut Nietzsche einst die Schrift. Das ureigenste Medium von Religion und Wissenschaft, die beiderseits einen jenseitigen Halt versprechen.

Ob Zufall oder nicht: Ein integraler Bestandteil der Station ist die angrenzende Universitätsbibliothek. So gab es lange Zeit einen direkten, unterirdischen Zugang zu dieser, gar eine Bücherausleihe auf der Verteilerebene. Die mittlerweile leeren Glasvitrinen dienten zur Präsentation neuer Publikationen. Architektonisch bestimmender noch war die Einbeziehung der Bibliothek bei der Gestaltung der Bahnsteighalle der U4, deren Bau im Jahr 2001 abgeschlossen wurde. Ursprünglich zum Ausbau für ein späteres Buchlager gedacht, zog man eine für U-Bahn-Stationen ungewöhnlich hohe Decke ein. Doch weil auch die Universitätsbibliothek eines Tages auf dem neuen Westend-Campus unterkommen wird, verzichtete man schließlich auf die noch fehlende Zwischendecke. Und so ist zumindest an dieser Stelle das Verschwinden der Bibliothek aus dem Stationsleben zu begrüßen. Wenngleich nicht intendiert, ist die weitläufige Bahnhalle der U4 zu einem weiteren, imposanten Gestaltungselement geworden. Vor allem bei der Fahrt hinunter mit dem gläsernen Lift, entfaltet die neuere der beiden Hallen eine fast sakrale Wirkung. Direkt an den Bahnsteigen sind zudem weitere, jüngere Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotojournalisten Mirko Krizanovic angebracht. Abgebildet ist erneut das studentische Leben der Goethe-Universität, beispielsweise die Umrisse einer Frau, die abseits allen Trubels aus einem der obersten Stockwerke des mittlerweile gesprengten AfE-Turms schaut – entrückt und doch mittendrin im Himmelreich der Bankentürme. Der Großteil der Fotografien beider Bahnsteige jedoch ist farbig und zeigt Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt. Hintergrund sind das sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindende Naturkundemuseum Senckenberg und der nahegelegene Palmengarten.

Zu klären bleibt, wie der Unendlichkeit zu entkommen ist, wenn die unterirdische Pforte zur Bibliothek fortan geschlossen bleibt. Die mögliche Antwort liefert eine wuchtige Säule mit einem zweieinhalb mal zweieinhalb Meter großen und 550 Kilo schweren, aus Bronze gegossenen Kissen. Sie ist der optische Mittelpunkt der Verteilerebene, den wir bisher verschwiegen haben. Die von dem Bildhauer Richard Heß geschaffene Säule steht auf der Lichtung in dem von Nieper geschaffenen Säulenwald. Auf sie geht die Beleuchtung zu. Radial angeordnete Führungsgitter betonen in strenger Geometrie ihren zentralen Charakter. Ein architektonischer Witz: Anstelle eines Kapitells mit seinen Voluten und floraler Ornamentik, erscheint die Nachbildung eines Sofakissens, das an seinen Seiten große Außenwulste aufweist, so als quetsche die Last der Decke die Polsterung zu Seite. Damit wird nicht weniger als der Glaube vorgeführt, es gäbe eine natürliche, ja ursprüngliche Architektursprache, aus der man sich auf alle Zeit zu bedienen habe. Für diese steht das Kapitell prototypisch. Einst als formale Lösung zur Überleitung vom Rund der Säule zur quadratischen Deckplatte gestaltet, geriet es in seinen klassischen Ausformungen schließlich zur zweiten Natur. Kein Wunder, dass die „großen Erzählungen“ vergangener Jahrhunderte sich baulich derart schmückten, meinten sie doch auf ewig zu bestehen. Aus vermeintlicher Geschichtlichkeit wurde so leere Unendlichkeit. Das gequetschte Kissen aus Bronze anstelle des Kapitells entlarvt die großen Erzählungen ohne selbst eine zu sein. Als Witz begnügt es sich mit der Gegenwart. Die Säule ist gleichwohl dekonstruktiv wie aufklärerisch. Sie gibt Auskunft über ihre tragende Funktion und weil sie spezifisch gestaltet ist, uns zu verstehen: Alles ist profan, weil von Menschen gemacht und nicht natürlich gewachsen. Das Leben ist veränderlich, die Gegenwart qualitativ verschieden; nicht zuletzt weil der Witz in seiner Wiederholung schal wird.
Doch bleibt Niepers Station keineswegs bei der bloßen Ironisierung stehen. Der Einsicht in die Konstruiertheit jeder Erzählung stellt er ein Korrektiv zur Seite. An mehreren Ein- beziehungsweise Ausgängen der Station hängen historische Stadtaufnahmen. Sie zeigen die Architektur des Vor- und Nachkriegs-Frankfurt. Die drastischen Veränderungen sind als Wunden, aber auch als Lehren der Zeit zu lesen. Sie dokumentieren, dass die Geschichte eine Ethik verlangt, die nicht schreiben kann, wer sich auf Dauer mit dem Witz begnügt. Der Architekt Ferdinand Kramer, der vor den Nazis geflohen war und auf Betreiben des zuvor ebenfalls emigrierten und 1951 zum Hochschulrektor gewählten Max Horkheimer zurück nach Frankfurt kam, um schließlich 23 Universitätsbauten zu entwerfen, schrieb an dieser Ethik auf seine Weise mit. Das neobarocke Portal des vom Krieg weitestgehend unversehrten Hauptgebäudes der Goethe-Universität mit seinen Säulen und allegorischen Figuren ließ Kramer abschlagen und durch einen großen, gläsernen Eingangsbereich ersetzen, der im Inneren auf das ins Erdgeschoss verlegte Rektorat ausgerichtet war. So machte er baulich bereits Ernst mit dem, was von Hamburger Studierenden später mit dem berühmt gewordenen Transparent „Unter den Talaren – der Muff von 1000 Jahren“ angeprangert werden sollte. Seine Gebäude und Möbel sind von der Absicht durchdrungen, keine Arbeitsatmosphäre schaffen zu wollen, sondern eine Atmosphäre, um zu arbeiten, in der der Einzelne sich nicht im Angesicht mächtiger Geschichte klein zu fühlen hat, sondern demokratisch an Geschichte mitwirken kann. Vielleicht erklärt diese Haltung auch das Zustandekommen der weiter oben im Text beschriebenen Souveränität, die Barbara Klemm mit ihren Fotografien vor und in Kramers Bauten vielfach eingefangen hat – eine Souveränität, die die Station Bockenheimer Warte über Umwege auch von ihren Besuchern einfordert, schon allein um die nächste U-Bahn nicht zu verpassen.
Erschienen in ‘NARANGO. Jahrbuch für die urbane Debatte’
– Das verwendete Bildmaterial sind Videostills aus der Kurzfilm-Dokumentation “Unterirdische Unendlichkeiten” von Nea Gumprecht
0 notes
Text
‚Main ins Dunkle bringen‘

Oder: Mehr Licht für Frankfurts Untergrund
Wer in Frankfurt kennt ihn nicht, den Eingang der U-Bahn-Station ‚Bockenheimer Warte‘? Ein Straßenbahnwagon des späten neunzehnten Jahrhunderts ist schräg in den Erdboden eingelassen und ebnet den Weg in die Tiefen des Untergrunds. Abseits aller weitläufigen Deutungen ist er auch ein Sinnbild für das teilweise Verschwinden des öffentlichen Nahverkehrs aus dem oberirdischen Großstadtbild, seitdem man mit dem aufwendigen Bau von U-Bahn-Tunneln begann. Die verkehrspolitischen Vorteile dieser Entwicklung liegen auf der Hand. Doch brachte sie für die Passagiere einen entscheidenden Nachteil mit sich: Den Verlust aller Sinneseindrücke, die man während einer Fahrt mit der Straßenbahn oder dem Bus vom Städteleben gewinnen kann. In Frankfurt hat man früh versucht, durch eine abwechslungsreiche Architektur der U-Bahnhöfe, diesem Verlust entgegenzuwirken. Zumeist orientiert sich die Gestaltung hierbei an den oberirdisch liegenden Quartieren oder Institutionen und ermöglicht so zugleich eine Orientierung im Stadtraum. Weil U-Bahn-Fahrten aber vornehmlich aus der Durchfahrt dunkler Tunnel bestehen, bleiben ihre Fahrgäste weiterhin arm an Sinneseindrücken und von der oberirdischen Stadt größtenteils abgetrennt.
Das Projekt „Main ins Dunkle bringen“ setzt genau an dieser Stelle an. Es will den Frankfurter Weg einer vielgestaltigen U-Bahnhofs-Architektur an einer für die Stadt ganz entscheidenden Stelle auch auf das Tunnelgewölbe übertragen. Zwischen den Stationen Willy-Brandt-Platz und Schweizer Platz, dort wo die Züge der Linien U1, U2, U3 und U8 den Main unterqueren, sieht es eine Lichtinstallation vor. Entlang der 154 Meter, die direkt unter dem Flussbett des Mains liegen, sollen an den Wänden des Doppeltunnels LED-Module angebracht werden, die mithilfe einer Lichtschranke durch die passierenden Züge angeschaltet werden. In einem gewissen Abstand zueinander gehängt und mit weitstrahlenden Blautönen ausgestattet, ergeben sie ein zusammenhängendes Lichterspiel, das die Monotonie der Tunnelfahrt unterbricht. Ähnlich der U-Bahnstation des Essener Hauptbahnhofs wird der Tunnelabschnitt mit einem Mal zu einer Art Unterwasserwelt. Nach erstmaligem Rätselraten um deren Sinn, das möglicherweise auch zum Austausch zwischen den Fahrgästen einlädt, schafft die Lichtinstallation in gleich zweifacher Hinsicht Bewusstsein. Sie ermöglicht, sich stets aufs Neue in der oberirdischen Stadt zu verorten, und verdeutlicht eindrücklich, was es eigentlich heißt, U-Bahn zu fahren. Ganz einfach, weil das plötzliche Wissen, sich gerade unter einem Fluss zu befinden, verlangt, das ‚U’ von U-Bahn in seiner ganzen Dimension auszubuchstabieren.
Was einst prominent mit dem Begriff der Entfremdung für die immer komplexer werdenden Produktionsabläufe der industrialisierten Welt beschrieben wurde, nämlich das Auseinanderfallen der Arbeit in eng begrenzte Tätigkeitsfelder, die blind füreinander sind, keinen Blick mehr für ihren gesellschaftlichen Zusammenhang zulassen, ist auch auf die Stadt der Moderne übertragbar. Um ihre auswuchernden Flächen in einer überschaubaren Fahrzeit weiterhin zusammenzuhalten, forcierten die schnellwachsenden Städte den unterirdischen Transit. Gleichzeitig fielen die Stadtteile in unzusammenhängende Bereiche auseinander, auch weil sie durch die unterirdischen Wegeverbindungen fortan punktuell beschritten werden konnten. Die moderne Stadt geriet zum fragmentierten Gebilde und die Stadt als Ganze für ihre Bewohner zum leeren Begriff, ja zur privilegierten Disziplin weniger Bildungsbürger. Selbstredend ist der U-Bahn-Bau mehr Metapher als alleiniger Grund dieser Entwicklung. Anstatt die Erfindung der U-Bahn anzufeinden, gälte es, sie als Chance zu begreifen. Durch eine vielseitige Gestaltung ihrer Bahnhöfe kann sie neue, alogische Verknüpfungen schaffen, lebensweltliche Eigenarten der Oberwelt verdichten und über die Stadttopographie aufklären. Nicht ohne Grund spricht man beim Streckennetz der U-Bahn auch vom Unbewussten einer Stadt, das zu erhellen, einen differenzierten Blick auf das Wesen der oberirdischen Stadt allererst freilegt.
Die Lichtinstallation im Maintunnel geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie klärt über das U-Bahn-Fahren selbst auf. Nicht nur ermöglicht es ihr Verweis auf den oberirdischen Fluss, sich einen Begriff von der Tiefe der Fahrt zu verschaffen, ihre Beleuchtung setzt auch die für die U-Bahn entscheidende Architektur in Szene: den Tunnelbau. Für gewöhnlich ist dieser gar nicht wahrnehmbar und damit ebenso wenig die eigene Fortbewegung. Ohne als sich verändernder Raum wahrgenommen zu sein, spuckt der Tunnel den Fahrgast in aller Unvermitteltheit an einem anderen Ort aus. Durch den Lichteinfall der Installation wird mit dieser gängigen Raumwahrnehmung der U-Bahn-Fahrt gebrochen. Plötzlich wird der Innenraum der Wagons durchlässig und damit der Blick nach außen möglich - und mit ihm Erfahrungen von Raum und Geschwindigkeit.
Mit der Vorbereitung und Realisierung des Projekts „Main ins Dunkle bringen“ bietet sich zudem die Möglichkeit, das kollektive Gedächtnis an den Bau des 26 Meter unter der Erde liegenden Tunnels und seine Fertigstellung vor gut 30 Jahren zu erinnern. Damals kamen zur Eröffnung des 327 Millionen teuren Neubaus sage und schreibe eine Viertelmillion Menschen zusammen, um den mittlerweile selbstverständlich gewordenen Streckenabschnitt zu feiern, der baulich durchaus ein Wagnis war. Der Fluss selbst hingegen war für das Leben der Stadt zu jener Zeit nur eine Randnotiz. Man hätte ihn am liebsten zubetoniert, wäre da nicht der Schiffsverkehr gewesen, so der Autor und Theatermacher Michael Herl. Anders als damals, ist der Main dank Uferpromenade und Museumsufer mittlerweile zur zentralen Lebensader Frankfurts und damit zu einer Institution geworden. Es ist also an der Zeit, dem Main neben der Alten Oper oder dem Schauspielhaus, dem Zoo oder dem Palmengarten unterirdisch ebenfalls zu einer Repräsentation zu verhelfen!
Erschienen in ‘NARANGO. Jahrbuch für die urbane Debatte’
0 notes
Text
Drei Versuche zur Identität

Aufatmen. Erster Versuch
Im plötzlichen Bewusstsein der eigenen Biographie kann es nicht darum gehen, sich gänzlich mit ihrem Hergang zu identifizieren. Vielmehr besteht die Aufgabe darin, die Gegenwart als deren Resultat ernst zu nehmen, indem man sich in ihr organisiert. Dazu gehört auch das erleichterte Aufatmen darüber, dass manches nicht mehr so ist, wie es einmal war.
Kindheit und Identität. Zweiter Versuch
Wenn die Kindheit als «Kindheit» auffällt und damit entrückt, schließt sich ein Kreis und mit ihm die Möglichkeit, anzugeben, welcher Zeitpunkt ihr Ende markiert. Eben weil ein Kreis keinen Anfang und kein Ende hat, sprechen wir überhaupt von Kindheit. Wir meinen damit etwas Fernes, etwas, das eigenartig für sich steht, anderen Logiken und Gesetzmäßigkeiten folgt. Unvorstellbar, dass binnen eines Jahres Schuhe nicht mehr passten, man als Schüler, noch halb Analphabet, plötzlich um seine Fehler zu fürchten lernte. Trotz radikaler Zeitlichkeit aber verzichtet die kindliche Logik auf Kausalität und Zeit. Kein «in einem Jahr werde ich», kein «und deshalb entschied ich mich damals für…», kein Sich-aus-den-Augen-Verlieren. Werden wir erwachsen, entwachsen wir notwendigerweise unserer Kindheit. Sie scheint in unseren Erinnerungen nicht von dieser Welt. Dass wir sie hinter uns lassen, trotzdem wir zeitlebens in ihrem Schatten stehen, eröffnet das Spannungsfeld unserer melancholischen Identität.
Es gibt einen Aphorismus von Nietzsche, in dem er über die Erfahrung des Erwachsenen schreibt, der in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt. Das Gartenhaus, die Kirche mit den Gräbern, der Teich und der Wald – das alles sehen wir immer als Leidende wieder, schreibt er. Denn während die Umgebung unserer Kindheit nahezu unverändert ist, selbst das Verhalten der Menschen, ja diese selbst es sind, wissen wir um unsere Veränderungen. Es erschüttert uns, eine scheinbar ewig fortbestehende Welt zu sehen, die verschweigt, was wir zigmal erfahren haben: Das Leben ist ein Taubenschlag. Soll heißen: Die Musiken und Menschen, die wir mochten, die Wohnungen, in denen wir lebten, die Freundschaften, die wir einmal schlossen und die sich später teils verliefen oder aus Zwist auseinandergingen, die Zeiten, in denen wir litten oder das Verliebtsein, das mehr als einmal war und dann plötzlich nicht mehr ist – all das gibt uns zu verstehen, dass wir mit jedem Augenblick ein klein wenig sterben, zumindest der, der wir waren. So sind Kindheit und Erwachsensein nicht nur zwei Welten, sondern zwischen dem, der wir waren, der wir sind und dem, der wir werden liegen gleichsam tausend Welten. Jenes Spannungsfeld besteht also auch in unserer Gegenwart selbst: Wir ändern uns stetig und bleiben doch der stets Gleiche, weil wir fortwährend das Kind waren, das so hieß, wie wir heißen.
Bei Nietzsche ist die Erschütterung des Ins-verlassene-Dorf-Zurückkehrenden — er beschreibt sie auch als Selbstmitleid — unweigerlich bloß demjenigen vorbehalten, der einst in die Welt aufbrach. Denn wäre er geblieben, wäre eine Erschütterung ob der scheinbaren Beständigkeit in Allem nur schwerlich vorstellbar. Denn im Dorf zu bleiben hieße, tagtäglich mit dem identifiziert zu werden, der man vortags war, so dass in der fortwährenden Abgleichung aller durch alle etwaige Brüche nahezu ausgeschlossen sind. Was für Nietzsche einzig Unglück bedeutet, wenngleich er es als Teil der «höheren Cultur» versteht, nämlich die Trauer um die Vergänglichkeit in Allem und die erfahrene Relativität der jeweiligen Gegenwart, scheint mir die Möglichkeit einer gelingenden Identität zu bergen. Das anfänglich beschriebene Spannungsfeld zwischen Kindheit und Erwachsensein, dem wiederum ein weiteres zwischen den verschiedenen Zeiten des Erwachsenseins selbst folgt, provoziert die Einsicht in besagte Relativität aller Gegenwart und damit verbunden in die Relativität der eigenen Identität. Das muss aber keineswegs den poststrukturalistischen Abgesang auf die Identität als solche zur Folge haben. Vielmehr birgt es das Konzept einer offenen Identität, bei der die Äußerung «Ich bin Friedrich Nietzsche» mit einer beständig zu aktualisierenden Hypothese verbunden ist, wer ich denn nun bin. So sind Widersprüche gewährleistet, ohne dass man das Kind verschweigt, das man einmal war, und das bei allem Wandel auf ewig das gleiche bleibt, weil es ohne Anfang und Ende einer Welt entstammt, in der man die Zeit noch nicht kannte.
Es gibt keine richtige Identität im Falschen. Dritter Versuch
Selten erinnere ich Stunden nach dem Erwachen eine Traumsequenz so präzise und eindeutig in ihrem Hergang, wie die aus vergangener Nacht. Überhaupt bleiben mir nur wenige Erinnerungen an meine Träume, seitdem ich wieder angefangen habe, zum Schlafengehen den Wecker zu stellen, der alles kaputt macht, weil er, statt der Verschränkung von Erwachen und Dösen, die strikte Dualität von Schlaf und Wach erwirkt. Erst auf dem Weg zur Universität, die ich in den letzten Wochen mied wie der Teufel das Weihwasser, sprang es mir in den Sinn: Unterwegs in einem Autobus bangte ich um meine knallrote Kreditkarte, die auffallend aus meiner Jackentasche strahlte. Sie zu verdecken, hatte ich nur mäßig Kraft. Nach einer ruckartigen Bewegung des neben mir stehenden Jungen war sie plötzlich verschwunden. Blitzschnell griff ich nach seinem Arm und entriss ihm daraufhin aus seiner Hand, was eben noch Objekt meiner Besorgnis war. Der halb verschüchterte, halb entrüstete Junge und ich waren kaum zur Besinnung gekommen, da schaltete sich eine ältere Frau ein. Sie verdrängte zuerst den Jungen, um daraufhin mit aller Kraft meinen rechten Arm zu ergreifen, in dessen Hand ich meine zurückeroberte Kreditkarte hielt. «Ihren Ausweis, los, weisen Sie sich aus, sofort!», schrie sie und hatte mit ihrer Forderung, so schien es, sogleich auch alle anderen Fahrgäste hinter sich. Ich kam nicht umhin, nach meinem Pass zu suchen, um der aufgebrachten Horde zu beweisen, dass ich ich bin und mir damit meine Karte gehört. Nachdem der Name auf meinem Ausweis dem der Kreditkarte entsprach, ließ die Frau von mir ab, verlor sich auch die Aufmerksamkeit der Anderen wieder, war der Junge verschwunden. Mir ging es schließlich noch mäßiger als zuvor. Trotz oder gerade wegen des verteidigten Zugriffsrechts auf meine kontingenten Euro.
Jene Traumbegebenheit vollzieht sehr plastisch, was mir seit Jahren ein Problem und dieser Tage ein Verderben ist.
Vorgestern besuchte ich eine Ausstellung zu Aleksandr Michajlovič Rodčenko, der eine Ausstellung zu sozialistischen Realismen unter dem Titel Grande pittura sovietica 1920–1970 beigestellt war. Prompt stand ich vor Isaak Brodskis Gemälde zur Eröffnung der Dritten Internationale. Wenngleich Brodskij manches ideologisch verzerrt haben mag und zudem Lenin, nicht Trotzki spricht, wird etwas in Erinnerung gerufen, das mir unbegreiflich weit entfernt scheint. Fast unvorstellbar ist uns ein Gedanke, der vor über hundert Jahren mit der ersten Internationale und eigentlich bereits mit dem Bund der Kommunisten ab 1847 Realität besaß: Der Gedanke des Internationalismus, der ohne Internet und Telefon weite Teile der revolutionären Massen verzahnte und der faschistischen Hatz des verdinglichten Menschenverstands opponierte. In der Einsicht, das Gewaltmonopol des Staates gehöre zerschlagen, weil dieser bloß Instrument kriegstreibender Irrationalität sei, in seiner formierten Legitimationsgrundlage nationaler Subjektivität nur im Krieg seinen Frieden kriege, erschien jenseits des republikanischen Topos bloßer Repräsentation die Möglichkeit einer Assoziation freier Individuen in Europa und der Welt.
Gegenwärtig ist Europa bei dem angekommen, was einmal die Metapher vom Platz an der Sonne verlangte: Der deutsche Staat hat endgültig die europäische Vormachtstellung eingenommen und ist in der Welt mächtiger als wohl je zuvor. Und während Europa einzig das institutionalisierte Geplänkel unzähliger Staaten ist, die von Eurobonds reden und möglicher Fiskalunion, und keine Assoziation, titelt BILD: «Alle wollen an unser Geld». Derweil hetzt der deutsche Mob gegen «faule Griechen» und bald wohl auch gegen andere «Parasiten» und sieht sich zudem bedroht von Kopftuch und Islamismus, den er ohne laizistisches Bewusstsein mit dunklerer Haut identifiziert.
Letzte Woche, zu Besuch bei einem Freund in Mailand, wurde ich Zeuge von dem, was hier in Rom wohl noch verdeckt ist, weil wir schon halb nicht mehr zu Europa gehören. In den Köpfen geistert der unsägliche Satz «Das Boot ist voll», den betonend die deutsche Mehrheitsgesellschaft im Rekurs auf den sog. demographischen Wandel gar schamlos ergänzt mit der Forderung nach familienfreundlicherer Politik zur Erhöhung der Geburtenrate. Mailand, das offenkundig sehr viele migrantische Einwohner zählt, ist voll von Konflikt und Hass, die zum ersten Mal, so der italienischer Freund, Italien vereinen — eben durch den gemeinsamen Hass auf Migranten, derentwegen man sich nachts nicht mehr auf die Straße traue, ganze Metro-Linien meide und sich nicht mehr zuhause fühle. In Rom wiederum ist es «La Merkel», die das Bild des hässlichen Deutschen derart anempfiehlt, das auch ich mich auf Anfragen in Bars nicht zu sagen getraue: Vengo dalla Germania. Weil ich als imperialer Staat gedacht werde, wie die Migranten als Ratten.
Und weil alle aufgehetzt sind und die Internationale längst begraben, ist mir zwischen Rassismus und nationalen Identitäten ein Gedanke gekommen, den ich im Widerspruch zum Vorgenannten zu schreiben habe: Gut, dass es das staatliche Gewaltmonopol gibt! Wenn das nicht so wäre, würden alle über alle herfallen. Wie der Staat zwar erst die Spielregeln garantiert, die in der psychischen Verarbeitung zu dem führen, was er wiederum — zumindest offen — verhindert, so produziert er den Mangel und verteilt die Güter, derentwegen kriminell ist, wer sich aneignet, was ihm nicht gehört. Doch bewahrt er davor, dass alle nichts haben, weil Mord und Totschlag droht, weil mit «falschem Bewusstsein» ihn abzuschaffen, alles noch schlimmer würde. Damit bin ich exakt in der Rolle desjenigen, der seine Kreditkarte zu verteidigen hat, und sich mit seinem Pass ausweist. Weder habe ich mir meinen Namen selbst gegeben, noch das verdient, was mir der Bundesadler beschwört. Und auch wenn der Pass Staatseigentum ist, mache ich ihn mir zu Nutzen, berufe ich mich auf ihn, um Ich zu sein und zufälligen Besitz und Identität zu verteidigen. Kein Polizist ist dabei anwesend, aber der Staat in allen Köpfen.
Wir werden zusammengehalten und sogleich unterschieden, von etwas, das uns weder zusammenbringt, noch besonders macht, ja im emphatischen Sinn eigen, und das doch die Ahnung schützt, dass Max Mustermann ein liebenswerter Mensch sein könnte, wären die Dinge um seinetwillen da.
Erschienen in der fünften Ausgabe des Kulturmagazins 'Quottom'
0 notes
Text
Wem einmal die dünne Schicht zerriss, die uns Leben heißt

Oder: Fortschritt und Chaos sind das Gleiche
Wenn der Mensch aus dem Horizont seiner Biografie fällt, er vergangenheitslos zugleich keine sinnhafte Zukunft mehr vor sich hat, spricht die Psychoanalyse gemeinhin von Depersonalisierung. Zumeist bringen ihn narzisstische Kränkungen dahin. So auch in Peter Greenaways Film «The Belly of an Architect». Der Film schildert Aufstieg und Fall des amerikanischen Architekten Stourley Kracklite, der mit seiner Frau nach Rom kommt, um dort eine Ausstellung über Étienne-Louis Boullée auszuarbeiten. Nach ersten Wochen voller Glamour und Zuversicht leidet Kracklite zunehmend an unerklärlichen Bauchschmerzen, seine bereits von ihm schwangere Frau beginnt ein Verhältnis mit einem anderen Mann, er verzweifelt späterhin an dieser Affäre, verliert so die Kontrolle über sein Ausstellungsprojekt und stürzt sich schlussendlich in den Tod. Die Eigenheit seiner Verzweiflung ist in einer Szene des Films wunderbar ins Bild gesetzt. Kracklite betritt das Atelierzimmer einer Fotografin, die ihn und seine Frau über Monate unbemerkt abgelichtet hat. Eine der weißen Wände, die er nach und nach abschreitet, hängt voll mit Momentaufnahmen der vergangenen Monate und zeigt ihre fortschreitende Entfremdung voneinander. Sein Leiden steht ihm mit jedem Schritt deutlicher ins Gesicht geschrieben. Am anderen Ende der Wand angekommen, ringt er um Luft und sackt in sich zusammen. Die Gegenwart selbst ist ihm problematisch geworden.
Eine aktuelle Videoarbeit des Hamburger Kollektivs Rutschberg greift eben diese Szene auf und überführt sie in einen weniger biografisch als vielmehr geschichtlichen Zusammenhang. In Auseinandersetzung mit dieser Arbeit möchte ich das Begriffspaar Chaos und Fortschritt konstellieren. Konkret handelt es sich um ein Musikvideo, das in Rom im Sommer 2012 zu dem zehnminütigen Stück «2 Seconds» der ebenfalls aus Hamburg stammenden Band Jenana gedreht wurde. So untypisch die Dauer für einen «verfilmten» Rocksong, so untypisch ist auch das Musikvideo selbst: An keiner Stelle taucht die Band auf, nirgendwo sind sublimierte Ejakulationen zu sehen, soll heißen: kein blödes Gitarrengepose, keine rockistischen Gebärden. Alleinige Protagonistin ist eine junge Frau, mit Brecht gesprochen: eine Städtebewohnerin. Zu Beginn steht sie auf einem Dach, mit dem Rücken zur Kamera. Für den Betrachter ist sie gesichtslos, so wie die Stadt noch unbestimmt ist, auf die sie schaut. Erst mit den folgenden Bildern bekommt die Heldin ein Gesicht, und es wird klar: ihr Blick gilt Rom, der Stadt der Städte, der ewigen, der exemplarischen Stadt.
Glauben wir Rolf Dieter Brinkmann, bedeutet Stadt einzig eine unüberschaubare Ansammlung von Mauern; sortiert nach Straßennamen und versehen mit Hausnummern. Stadt meint aber immer auch und zuallererst die Anhäufung von Menschen und damit die Vertausendfachung menschlicher Kraft. Als umbauter Raum ist jede Stadt eine Kulisse menschlichen Alltags und zugleich Zeugnis sozialer Verhältnisse. Doch wird zu Stein stets nur die herrschende Klasse, nicht die Vielheit jenes Alltags. Ob Gebäude oder Parks, urbane Architektur ist immer Monument politischer Macht.
Die Eigenheit von Rom besteht nun darin, dass sie als ewige auch immer geschichtete Stadt ist, Stadt auf Stadt. An das, was sie war, erinnern uns Ruinen. So gerinnt Geschichte zur Müllhalde, so wird die Stadt zur Ausgrabungsstätte. Die Ruinen jedoch zwingen danach zu fragen, welche unabgegoltenen Wünsche es in jedem einzelnen Haus und jeder Straße gab. Die Stadt rückt das in den Mittelpunkt, was ihre Architektur eigentlich verschweigt: Was bedeutet das jetzige Leben mit dem Wissen um die Vergänglichkeit in allem? Was bedeuten all diese vergangenen Zeiten, wenn sie doch genauso Gegenwart waren? Was bedeutet das Leben in der Kontinuität von Stadt?
Wir folgen der jungen Heldin durch Rom. Sie scheint der Stadt merkwürdig entrückt – zu Fuß oder während einer Busfahrt. Ihr Blick ist Eingedenken. Hin und wieder wird der Streifzug von einer düsteren Nahaufnahme unterbrochen. Bei dieser sehen wir sie an einem Tisch sitzend und staunen nicht schlecht: sie sitzt sich selbst gegenüber. Man fühlt sich an Thomas Braschs Film «Domino» erinnert. Auch dort sitzt die Filmheldin vis-à-vis von sich selbst. Hier wie dort schwenkt eine Deckenlampe unaufhörlich hin und her und beleuchtet abwechselnd die beiden Frauen, die doch die gleiche sind. Diese Szene, die immer wieder eingeblendet wird, ist sogleich die einzige direkte Verbindung zur Musik: Die Stimme des Sängers singt sich durch unsere Heldin hindurch. Mit dem Fortgang des Videos begegnet sich die einsame Städtebewohnerin auch in der Handlung selbst. Nachdem sie in einen Palazzo eingetreten und mit dem Lift hinauf gefahren ist (sie steht dabei mit dem Rücken zum eigenen Spiegelbild), hastet sie auf einen Balkon und schaut hinab. Hierbei erblickt sie sich selbst – bei ihrem vorigen Streifzug durch die Stadt. Die Umherstreifende bleibt stehen und schaut hinauf – ebenfalls zu sich selbst. Ihre beiden Körper erstarren. Es folgt die Anlehnung an die einleitend genannte Szene aus «The Belly of an Architect» und es ist anzunehmen, dass diese der störrischen Flucht auf den Balkon chronologisch vorangeht. Unsere Heldin betritt einen kargen Raum, um wie bei Greenaway eine weiße Wand mit unzähligen Schwarzweißfotografien zu entdecken. Nach und nach schreitet sie diese Aufnahmen ab. Am anderen Ende der Wand angekommen, verzweifelt sie ebenso wie Greenaways Architekt. Doch ist auf keiner der Aufnahmen sie selbst abgebildet, keine stammt aus ihrer eigenen Biografie. Was sie sieht und wir mit ihrem Blick zu Gesicht bekommen, sind vornehmlich Aufnahmen der italienischen Frauenbewegung aus den 70er Jahren: Frauen auf Demonstrationszügen durch Rom mit Fahnen und gereckten Fäusten, Frauen in Redaktionsräumen und Cafés oder auf Kongressen, auch Porträts einzelner Feministinnen.

Brach der Verlassene über den Fotos einer gemeinsamen Vergangenheit zusammen, so verzweifelt unsere Heldin an den fremden Zeugnissen vergangenen Lebens. Sie sieht Menschen sich an Orten sammeln, an denen auch sie unlängst vorbeikam. Und wie das einstige Bekenntnis zweier Liebenden wahr war, hatte auch der Kampf für ein anderes Leben sein Recht auf Wirklichkeit. Doch was bleibt? Wie weitermachen, wenn von dem, was war, scheinbar nichts bleibt? Wie sich selbst noch sinnvoll in seiner Gegenwart einrichten, wenn allem letztlich das gleiche Verschwinden droht? War doch jener fotografisch dokumentierte Sit-In vor dem Kolosseum genauso Gegenwart wie der soeben beendete Streifzug, bei dem man den gleichen Ort passierte, ja war er genauso jetzt wie jetzt jetzt ist. In der Kontinuität der Stadt ist die Kontinuität der Zeiterfahrung brüchig geworden. Fortschritt gerinnt zum leeren Fortschreiten, zum Diktat der Zeit, immerzu weitermachen zu müssen. Der Glaube, in geschichtlichen Verbindungslinien zu stehen, die zum Guten hin sich wenden, ist verloren gegangen. Und aus dem entlarvten Fortschritt als bloßem Fort-schritt folgt notwendig das Chaos, der Verlust der sinnhaften Ordnung, ja ist der Fort-schritt das Chaos selbst.
Wie der Liebende nichts mehr als die Zeit zu fürchten hat, weil sie stets ein mögliches Ende mit sich führt, wird die Zeit für den erinnernden Menschen zum kalten Gegenspieler. Wenn die Zukunft einzig die Gegenwart spiegelt, alle Verbindung zur Vergangenheit abreißt, weil sich ihre Impulse nicht in die Gegenwart retten, fällt letztere in sich zusammen und wird zum bloßen Punkt. Nicht zufällig gibt es eine Szene im Video, in der die Heldin versucht, sich einem steinernen Monument einzuverleiben, um der Zeit zu entkommen. Siegfried Kracauer, seines Zeichens nicht nur Filmtheoretiker und Sozialphilosoph, sondern studierter Architekt, schreibt in seiner Erzählung «Der Gast» von «jenem Abgrund des Schweigens, des Vergessenwerdens, der Untreue, der das Lebendige frisst. Wem einmal nur die dünne Schicht zerriss, die uns Leben heißt, er allein kann ermessen, was die Hoffnung auf ein Jenseits bedeutet.»
Ist das Leben auf einen bloßen Punkt geschrumpft, zerfällt aller Sinn, verfällt der Mensch dem Chaos, gerade weil er weiterhin am Leben ist und sinnlos weitermachen muss. Es kommt zum Verlust der eigenen Identität und notwendig zur Frage: Warum ist Jetzt jetzt, und was soll das überhaupt? Dann wird Gestern auch zu Heute, aber nicht als Kontinuität, sondern, weil alle Zeiten plötzlich austauschbar, also beliebig geworden sind. Eben diese psychologische Reaktionsweise ist im Video von «2 Seconds» formal gestaltet, wenn verschiedene Lebenszeiten der Heldin zu gleicher Gegenwart werden. Alle Augenblicke auf der Zeitlinie werden äquivalent und damit allesamt bedeutungslos – die Crux von Entropie. Deshalb erstarrten beide Körper. Dann fängt der Himmel scheinbar zu weinen an: es regnet weiße Luftballons.
Der Lift befördert die Heldin nicht nur von der Straße in die Wohnung, sondern auch auf das Dach des Hauses, wo wir sie zu Beginn des Videos bereits sahen. Wieder gleitet ihr Blick über die Stadt. Doch ist sie sich ein zweites Mal auf das Dach gefolgt und geht hinterrücks auf sich zu. Kurz bevor es zum Aufeinandertreffen kommt, bricht die Szene ab.
Derweil setzt sie ihren Streifzug durch Rom fort. Abseits des centro storico sieht man sie inmitten der gläsernen Paläste unserer Gegenwart; inmitten von Einkaufszentren und Bürogebäuden auf dem Gelände von Cinecittà, der römischen Traumfabrik. Es folgt die wohl einschneidendste Szene. Eine Fensterfassade passierend sieht sie sich in dieser gespiegelt und bleibt ruckartig stehen. Ihr Spiegelbild hat sich verselbständigt, hat aufgehört sie zu spiegeln. Es ist das verstörende Bild jener vorgenannten Identitätskrise. Langsamen Schrittes bewegt sie sich auf ihr Spiegelbild zu, das beginnt, ihren weiblichen Körper mit den Händen anzudeuten. So, als wolle es sie an „das andere Geschlecht“ erinnern. Schließlich reichen sich beide die Hand.
Es wird Nacht, die Stadt liegt im Dunkeln. Überall Monumente und versehrte Büsten, totes Leben. Eine weitere Allegorie auf den Verlust aller Bedeutsamkeit: Die steinernen Gesichter werden von Ameisen bevölkert, denen die menschliche Physiognomie nichts weiter ist als Steinwüste.
Mit dem erneuten Anbruch des Tages folgt schließlich der Befreiungsschlag, schlägt der bisherige Hergang um. Als ob sie ihre innere Unordnung zur äußeren werden lassen wolle, dreht sich die Heldin im Kreis. Die Stadt gerät dabei ins Taumeln, und sodann stehen erste Gebäude in Flammen: Rom brennt. Es ist der Kampf gegen eine Städtearchitektur, die alles vergangene Leben der Erniedrigten, Beleidigten und Geächteten verschweigt. Wir sehen die Heldin, wie sie sich ein letztes Mal folgt, die Treppenstufen vor dem sogenannten quadratischen Kolosseum hinabsteigend – ein bauliches Synonym für die Transformation des Immergleichen. Ihr zu Füßen liegt die brennende Stadt. Und wie Rom exemplarische Stadt ist, so ist das Aufbegehren unserer Heldin gleichsam ein Kampf gegen alle Städte, ist es ein exemplarischer Kampf.
Hat sie sich aus ihrer Ohnmacht gelöst, löst sich zugleich auch die Spannung der Handlung. Mit einem Mal sitzt sie allein am Tisch, wo sie zuvor noch gegen sich angesungen hatte. Vor der spiegelnden Fassade wiederum sehen wir sie ebenfalls nicht mehr. Übrig bleibt ihr Spiegelbild. Sie scheint durch den Spiegel hindurchgegangen. Möglich sind mindestens zwei Weisen der Interpretation. Entweder sie ist aus aller Geschichte ausgestiegen, hat sich aus der Logik der Zeit befreit oder aber sie hat jenseits der alten Identitätslogik zu sich zurückgefunden und damit zurück in die Gegenwart. Das Video legt letztere Lesart nahe: Weiterhin an die aus dem Himmel regnenden Luftballons zu glauben, erlaubt es kaum, sehen wir diese doch als vorbereitete Requisite auf dem Dach. Ein Sinnbild für die Ernüchterung, die mit jedem Zurück-ins-Leben-Finden einhergeht. Über den Ballons trocknet die auf die Leine gehängte Wäsche des Alltags.
Die letzte Einstellung zeigt verschwommen einen Schrei in die Welt – zwischen Munch und Pavarotti, zwischen Angst und Heiterkeit. Was bleibt, ist das geheime Wissen um das Chaos, das fortschreitend weitertobt.
Erschienen in der dritten Ausgabe des Kulturmagazins 'Quottom'
0 notes
Text
Soliloquies

Liner note zum Album ‘One Word: Words’
Mehrere Monate waren nötig, bis wir uns schließlich sicher waren, wie die Rückschau auf unser kleines Band-Oeuvre am klügsten kompiliert ist. Bei all den Telefonkonferenzen, die wir zu diesem Zweck führten, war eines unserer Stücke jedoch jedem Zweifel erhaben: Soliloquies sollte den Anfang machen. Nicht nur hatten wir in Berlin am zwölften Juni 2010 unseren vorerst letzten Auftritt mit Soliloquies begonnen, sondern bereits unser allererstes Konzert im Januar 2006 mit eben diesem eingeleitet. Wohlgemerkt in Hannover und nicht in Hamburg. Dort gaben wir erst einige Wochen später in der sagenumwobenen Schilleroper unseren Einstand, um – mit einer Generalprobe im Hintersinn – dem armverschränkten und in Skepsis getränkten Pop-Publikum der Hansestadt nicht völlig ausgeliefert zu sein. Wir verstanden Soliloquies immer ähnlich einem Vorwort. Durch seinen von Wiederholungen und zunehmender Verdichtung geprägten Aufbau leitet es wunderbar ein und fasst textlich bündig zusammen, was uns wichtig war: Das authentische Ich ist eine Farce, einzig bei den Anderen sind wir auffindbar! Oder knapper: Wir sind nicht mehr als ein Taubenschlag! "Soliloquies about you, I about me. How wants to please himself: I or me. For hours and hours: forms of expression, for hours and hours: speech aspect. Understanding comprehension means thinking in terms of him who knew nothing. For hours and hours: who is what? Obviously the case is different than you think." Was das zu bedeuten hat, machte dieses Stück nicht zuletzt uns selbst verständlich. Weder mit sturer Logik noch mit herrischer Kontrolle war ihm beizukommen. Ja, es machte mehr mit uns als wir mit ihm. Die Klänge und Rückkopplungen, die sich bei seinem Spiel auftürmten, waren weder den einzelnen Instrumenten klar zuzuordnen, noch als gleiches Klangereignis wiederholbar. Und so ist 'Soliloquies' von all unseren Kompositionen am wenigsten Lied und am meisten Stück. Gewissermaßen ein Leib ohne Skelett. Denn wenn man einmal versucht, es allein mit Gitarre und Gesang zu mimen, bleibt schlechterdings nichts übrig. Soliloquies war eines unserer frühesten Stücke und wenn ich mich recht erinnere, das Erste, das wir gemeinsam und nahezu rauschhaft bei einer einzigen Probe geschrieben haben. Anders als zuvor brachte ich keine ausgearbeitete Skizze mit in den Übungsraum, der sich zu dieser Zeit in einem alten Bunker im wohlbehüteten Hamburger Stadtteil Winterhude befand, sondern das erste Album der Band Kante: Zwischen den Orten. Ich wusste, dass wir es alle sehr mochten und so hörten wir gemeinsam die uns bereits vertrauten Klänge, um dann, mit Lust zur Imitation, munter drauflos zu spielen. Vor allem reizte uns dessen ähnlich Legobausteinen zusammengesetzte Struktur und rhythmische Gestaltung. Dass einige Wochen später jene Band nur wenige Räume weiter Nummern für ein neues Album einstudierte, schien einzig mich in Begeisterungswut zu versetzen. Noch kein Jahr in der Stadt, waren eben diese Begebenheiten das, was Hamburg als Projektionsfläche jahrelang versprach und die anderen wiederum nur noch müde lächelnd als Alltäglichkeit aufmerkten. Nach Hamburg gezogen waren wir wohl alle irgendwie auch wegen der Musikszene, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ebendort entstand. Gleichwohl verfassten wir unsere Texte schließlich auf Englisch und suchten die musikalischen Referenzen eher bei amerikanischem Post- und Indie-Rock. Ich glaube, in dieser Entscheidung reflektierte sich verdeckt ein Unbehagen gegenüber den Begebenheiten der Zeit. Hochglanzmagazine hießen auf einmal "Deutsch", CD-Veröffentlichungen stellten stolz unter dem Titel "Neue Heimat" Musik "deutscher Bands" zusammen und im Fernsehen liefen Kampagnen für ein neues deutsches Selbstbewusstsein. Und auch wenn die Künstler jener Szene sich zum Großteil gegen die Vereinnahmungen zu wehren versuchten und Sprache per se nicht revanchistisch ist, sang unsere Generation plötzlich mehrheitlich mit geschichtsvergessener Stimme auf Deutsch und vermeinte "frische Spuren im weißen Sand" – gar stolz auf den eigenen Staat als "Friedensmacht". Zudem verschob sich die Hamburger Szene stark: Statt androgynem Slackertum dominierte zunehmend Kumpelei und Schulterklopfen, Männerschweiß und Authentizität. Festzuhalten ist, dass der Klassenunterschied, der uns von 'Kante' trennte, nicht nur ein musikalischer war. Während der Probepausen suchten wir stets einen nahegelegenen Supermarkt auf, diese saßen unweit des Bunkers auf der Terrasse eines Altherrencafés.
0 notes