#das laokoon-paradigma
Text

Cano
1.
Jedem Anfang wohnt ein Kippen inne. Vergil lässt Aeneas zwei mal anfangen. Das erste Buch fängt die Geschichte an, das zweite Buch fängt ebenfalls die Geschichte an. Das erste Buch setzt in der ersten Person an, cano. Das erzählt einer, von dem ein Name nicht gesagt ist. Das zweite Buch stellt einen Erzähler vor, der zurückblickt und damit als Zeuge eine Geschichte anfangen lässt, er beginnt von Laokoons Kippsal (s.o.) zu erzählen. Sein Name wird gleich mitgeteilt: pater Aeneas.
Sein Zeugnis geht mit einer Taufe einher, weil ab dem zweiten Buch nicht nur über Leute erzählt wird, die Namen tragen. Der Erzähler erhält selbst einen Namen; der einen Namen trägt tritt als Erzähler in Aktion, das Erzählen wird Aktion, die Aktion Erzählung. Die zwei Anfänge fangen beide an, sie springen vom Anonymen ins Namhafte und tauschen den Namen Vergils gegen den von Aeneas aus. Da findet eine Trennung statt und ein Austauschmanöver. Da wird etwas gekreuzt und ‘versäumt’ (Rheinberger/ Augsberg), so, dass man man dabei zuschauen, mitlesen kann.
2.
Man kann so eine Doppelung der Anfänge selbst zur Technik des Anfangens zählen. In einem Text zur Macht des Anfangs schreibt Vismann, das gelungene Anfänge immer zwei mal vorkämen. Wenn das stimmt, dann ist der Anfang von Vergils Aeneas wieder mal gelungen und damit wieder mal der Anfang Roms gelungen.
Vismann bezieht ihre These vom gelungenen Anfang auf die Institutionen, die einmal als Gaius’ Insitutionen und dann als erster Teil der Justinian'schen Rechtssammlungen, wieder als Institutionen, den Anfang dessen markieren sollen, was als römisches Recht vorgestellt wird. Das Doppeln und Spalten oder Spalten und Doppeln, das Scheiden, soll eine Technik sein, anzufangen. Man soll mit dem Scheiden anfangen. Sagt man so. Im Detail sind die Vorstellungen darüber, was das heißt, sehr unterschiedlich.
3.
Kommende Woche startet die Summer Acadamy am MPI, ich werde dort mit den Kolleginnen Ragini Surana und Anna Clara Lehmann Martins sowie dem Kollegen Haochen Ku ein Round-Table-Gespräch zu der Frage When does law begin? und zu Traditions und Perspectives führen. Nelson Goodman hatte einmal vorgeschlagen, die Frage, was Kunst sei, durch die Frage, wann sie sei zu ersetzen. Das Gespräch könnte in diese Richtung laufen.
Aus der Perspektive der Forschung, die ich betreibe, wird ’anfangen’ selbst als juridische Kulturtechnik verstanden, das heißt, dass ich erforsche, wie Anfänge markiert und eingerichtet werden und wie Juristen dabei beteiligt sind. In einer Studie zum juristischen Bilderstreit habe ich so eine Untersuchung das erste mal für die Markierung des Anfangs des modernen Bildrechts in Deutschland gemacht. Der Bismarckfall ist ein künstlicher Anfang in einer künstlichen Welt, die für künstliche Intelligenz, künstliche Klugheit, künstliche (Juris-)Prudenz wahrnehmbar und denkbar gemacht ist. Dass der Fall nicht wirklich mit einem modernen Bildrecht anfängt, das kann man natürlich sagen, ist als Kritik aber etwas phantasielos, auch wenn es stimmt und richtig ist. Es gibt ein Bildrecht vor dem Bildrecht und Modernität vor der Moderne, beides kommt durchaus auch am und im Begriff des ius imaginum vor (etwa in Lessings Texten zum ius imaginum, die zwar philologisch pedantisch und korrekt sind, aber doch modern an antiken Texten hängen). Insofern fängt mit dem Bismarckfall nicht wirklich ein modernes Bildrecht an. Aber der Fall richtet das moderne Bildrecht doch auch modern ein: Der Fall fängt da an, wo ein majestätisches Subjekt in seinen Bestand vom Tod wie vom unbeherrschten Bild bedroht sein soll. Das ist sicher auch alles andere als phantasiereich, weil fast alle Vorstellungen um den Bismarckfall bürgerliche Gesellschaft in ein Adelsphantasykostüm stecken wollen, das nicht weit gedacht ist und schon die Inszenierungen des Todes nicht fassen kann. Aber immerhin tun die Richter so, als ob sie modern wären und lassen ihrer Musterung freien Lauf. Sie geben sich zu erkennen. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das moderne Recht durch Selbstreflexion auszeichnet. Dass es Leute gibt, die das behaupten, bestreite ich nicht.
4.
In einer Studie zu Geschichte und Theorie des Kinorechts habe ich das Anfangen für die Anfänge des sogenannten Kinorechts am Beispiel der Kampagnen von Albert Hellwig um die Idee der Suggestivkraft untersucht (man kann bei Hellwig einen Wechsel von dialektischen und rhetorischen Verfahren zu kasuistischen Verfahren beobachten) und in einem Text zur Geschichte und Theorie juridischer Kulturtechniken habe ich das am Beispiel von Fritz Schulz und der Art und Weise, wie er das römische Recht anfangen lässt, getan.
Mich interessiert zwar auch die Historizität, das historische Ereignen oder Passieren, das man Anfang nennt, aber nicht ohne die Technizität, die dabei mitläuft, um den Anfang zu fassen, zu begreifen, wahrnehmbar, vorstellbar, reproduzierbar und im Prinzip 'ausübbar’ zu machen. Anzufangen kann als juridische Technik verstanden werden, mit der auch Zeit in Perspektive übersetzt wird. Nur weil etwas künstlich, technisch , fingiert, symbolisch, imaginär oder artifiziell ist, heißt das nicht, dass es nicht echt ist oder in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Es gibt sie noch, eine Angst vor der Konstruktion, mit der sich sogar moderne Juristen an Gegebene, Natürliche, Echte und an eine rohe Wirklichkeit klammern, vielleicht nur, um für die Übersetzung von Zeit in Perspektive keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Muss man aber nicht tun, muss man nicht haben. Die Rechtswissenschaft ist eine alte Wissenschaft künstlicher Welten, und alles was sie mitmacht (und sie macht scheinbar alles mit) passiert ja doch, auch wenn es was kostet.
Für Hannes Seidl und Daniel Kötter Musiktheaterstück Land habe ich Land.Libretto geschrieben, das ist ein Text, in dem es unter anderem um zwei unterschiedliche Modi des Anfangens geht. Ab urbe condita: Die Gründung Roms kann man auf das Verb condere, aber auch auf condire beziehen. Damit sind unterschiedliche Modi der Gründung und des Anfangens verbunden. Grob gesagt hängt das eine eher an einer Bewältigung von Zeiträumen, also auch daran, Zeit wie einen Raum zu behandeln. Man übersetzt das am besten mit bergen, stiften. Das andere hängt daran, Zeit durchgehen zu lassen, man übersetzt das am besten mit zubereiten, fermentieren oder reifen. Die Anfänge des Rechts können insofern ebenfalls als Moment verstanden werden, in denen Recht gestiftet oder geborgen wurde. Oder sie können als Moment verstanden werden, in den Recht zubereitet oder fermentiert wird oder in dem es reift.
5.
Eine anderen Vorstellung verbindet den Anfang des Rechts mit bestimmten, raffinierten Handlungsformen, zum Beispiel mit dem Vertrag oder der Gesetzgebung, mit der Formulierung von Sätzen, die der Qualität eines Satzes des Prätors, also einem Interdikt entsprechen. Mit Vismann und Suresh geht ich davon aus, dass bereits (choreo-)graphische Akte, Formeln und Protokolle juridische Kulturtechniken sind, die Recht anfangen lassen. Zugespitzt ausgedrückt: Immer, wenn etwas anfängt, egal was es ist, fängt auch das Recht mit an, weil Juristen schon so lange darin involviert sind, zu preparieren, was ein Anfang ist, dass sich das archäologische Sediment nicht trennen lässt, ohne etwas am Anfang zu verkehren. Wenn der Urknall ein Anfang ist, dann auch für das Recht. Wenn Leben und Tod wider Erwartens nicht gleichursprünglich sein sollten und das Leben doch erst lange nach dem Tod anfing, dann fing damit auch das Recht an.
Will man einen Moment identifizieren, an dem nur das Recht und nichts als das Recht anfing, ist das ein Versuch, aus der Konkurrenz und der Rivalität, letzlich aus der Doppelgängerei und Spalterei selbst auszusteigen, mit Luhmann gesprochen: Es ist der Versuch, das Paradox des Anfangs zu invisibilisieren. Mit anderen gesprochen: Es ist der Versuch, durch inwendige Selbstbehauptungen Chancen zu kanalisieren, Möglichkeiten zu limitieren oder aber, anders gesagt, sich zu verschanzen.
6.
1929 lässt Warburg seine Bild- und Rechtswissenschaft sowie seine Polarforschung übrigens im Zuge einer biographischen Legendenbildungbei der Lektüre von Lessings Laokoon anfangen. Das schreibt er so in dem amtlichen Schreiben Vor dem Kuratorium. Why not? So geht es auch.
5 notes
·
View notes
Text

Schreiben
1.
Die Sprache akustisch fließend artikuliert, die Schrift starr fixiert: Mit dieser Unterscheidung (die das Laokoon-Paradigma mit Wendungen aufgreift, die auch Lessing schon instituiert hat, obschon Lessing an ihnen das Bild und die Literatur unterscheidet) setzt Vestings Medientheorie des Rechts ein.
Vesting greift damit die Vorstellung auf, dass die Schrift fixiert und in der Form beständig sei, das Sprechen aber flüssig sei und akustisch zerfallen würde. Wie Lessing die Literatur und das Bild unterscheidet, nämlich als gegensätzliche Möglichkeiten, mit Starren und mit Regen/Regung umzugehen, so setzt Vesting Schrift und Sprache zu Beginn gegensätzlich ein, markiert an dem mitlaufenden Gegensatz zwischen Zerfall und Erhaltung allerdings den Ursprung des Begriffs und des Begreifens (eines Begreifens, das nicht sofort wieder zerfallen, sondern sich erhalten soll).
Diese Unterscheidung widerlege ich nicht (wie überhaupt die Kulturtechnikforschung diese Form westlicher Medientheorie nicht widerlegt), ich verstehe sie als als einen Zug, der symbolisch ist und, wie eine Tür, sich auf das Imaginäre und das Reale hin öffen oder schließen kann.Man kann damit zurecht kommen und vor die Wand laufen. Sprich: Als Bild ist diese Definition effektiv, wirkmächtig seit langem, nur sind die Folgen immer andere. Vestings These ist in einem Punkt ohnehin unwiderlegbar: Er verwechselt da etwas, verwechselt Form und Material, um Tinte und Papier für Form und als Form halten zu können. Vismann hat dem in einem Text über Versäumnisurteile ein Denkmal gestellt. Vesting versäumt dort etwas, wie man mit Rheinberger sagen kann. Ob er die Schrift begreift, dass wissen wir gar nicht (er verwechselt und versäumt doch etwas). Wir wissen nur, dass er Schrift sichtet und (an-)greifbar macht, dass er sie, wie Vismann sagt, händelt, in dem er seine Schreibaufgaben bestreitet. Kein Ursprung des Greifens ohne Ursprung des Sichtens: aus so einer diplomatischen Situation entwickelt Warburg die Choreographie seiner Staatstafeln mit einer Polarität, die das Greifen (Tasten) und Sichten involviert.
2.
Ein vom Sprechen unterschiedener Gegenstand der Sprache wird auch Kindern ersichtlich, die noch nicht Schreiben können und nicht wissen, was Schrift ist. Sie können nämlich schon lügen und dabei weiterhin ans Sprechen glauben. Nicht alles, was gesagt werden kann, verschwindet im Vollzug seiner Artikulation wieder. Eigentlich verschwindet nichts von dem, was gesagt wurde. Das Sprechen folgt nämlich in Mustern, die, wie der Mond und die Sternenbilder, nicht verschwunden sind, wenn sie nicht wahrnehmbar sind. Die Sprache ist nicht verschwunden und weg, wenn nicht mehr gesprochen wird, sie ist entfernt, aber das ist sie auch, wenn und solange gesprochen wird. Die Leute hören, wenn sie jemand verspricht und wenn jemand verspricht, in Zukunft besser zu Sprechen. Sie hören Dialekte, die ihnen fremd vorkommen und solche, die ihnen vertraut vorkommen. Das Schreiben ist und wird gemustert, das Sprechen auch, beide Kulturtechniken mustern auch, nehmen etwas wahr: Das Sprechen ist mimetisch, färbt sich und färbt ab, wie das Schreiben findet es in Situationen oder auf Unterlagen statt, in Umgebungen.
Luhmann hat die Form der Schrift als Einheit der Differenz aus Schriftlichkeit und Mündlichkeit bezeichnet, die Form der Schrift dient teilweise noch dazu, auf Form zu pochen um Form zu wahren und an Form zu pochen, um Formlosigkeit zu vermissen, etwa um Gerechtigkeit gehen Recht auszuspielen (wie bei Ciceros antijüdischen Formel summum ius summa iniuriae) . Die Form der Schrift setzt die Unterscheidung zwischen Starrheit und Flexibilität nicht das erste mal in Gang. Sie setzt sie wieder in Gang, um diese Unterscheidung verkehrsfähig und verkehrbar zu halten. Wie Benno Wagner an den amtlichen Schriften Kafkas zeigt: Mal hat die Form ihre Schuldigkeit getan und kann gehen, mal hat die Formlosigkeit ihre Schuld getan und kann gehen. Mal hat das Starren, mal das Regen seine Schuldigkeit getan. Man schreibt und spricht in unbeständigen, meteorologischen und polaren Umgebungen.
3.
Wir definieren das Schreiben als diplomatische, juridische, büro- und studiokratisch zügige Einfalt der Differenz aus auf und ab, hoch und runter, rein und raus, hin und her, upside/down, also nach Warburgschem Vorbild als vagues und vogues Trennen und Assoziieren, oder aber: als systematisch verkehrende, verzehrende und begehrende Scheidekunst, Schichtkunst und Musterkunst.
2 notes
·
View notes
Text

Bewegung über Messe(n)
1.
Aby Warburg beginnt seine Arbeiten zur Bild- und Rechtswissenschaft 1896, gleich nach seiner Rückkehr aus Amerika. Bildwissenschaft kann danach nicht nur Kunstgeschichte sein, Bildgeschichte nicht nur Kunstwissenschaft. Warburg hat eine anthropologische Erfahrung gemacht: Bei den anderen kommt alles das vor, was auch bei uns vorkommt, nur in anderen Reihenfolgen. Ihnen fehlt nicht, was sie haben und ihnen fehlt nicht, was wir haben. Man muss ihnen nicht mit der Frage des Nebenbuhlers begegnen, also nicht mit der Frage, was sie bloß hätten und uns fehlen würde, dass alle die Liebe (auch ihre Liebe und die Liebe zu ihnen) an uns vorbei gehen würde. Man muss ihnen auch nicht mit der Frage stolzer Konkurrenz begegne und sich selbst bewundern oder wundern, was ihnen bloß fehlen, uns aber so groß und reich machen würde. Rechtstheorien und Rechtsgeschichten können das tun, sie tut es ja bis heute, wundern sich über die Armut in Mexico und die Leute im Osten und fragen, was denen bloß fehlt, oder aber, mit großen Begehren, fragen was uns fehlen würde und was dafür sorgen würde, dass an uns die Liebe vorbei geht. Das alles geht und das alles gibt es, auch in der Rechtsgeschichte und der Rechtstheorie.
Aber es muss nicht sein, und mit Warburg sollte es so auch nicht sein. Warburg, und das bringt Viveiros de Castro fantastisch auf einen Punkt, (nämlich einen Punkt, der außerhalb von Warburg liegt und mit Warburg nichts zu tun hat), arbeitet an Verhältnissen, in denen der Andere denkbar und unverzichtbar ist, er arbeitet an Werten relationaler Affinität (nicht substantieller Identität). Das heiß auch, dass der Andere in Warburgs Bild-und Rechtswissenschaft nicht unbedingt unser Spiegel ist. Ein Spiegel verkehrt zwar auch etwas, macht etwas spiegelverehrt.
Aber Warburg entwirft seine Erfahrung nicht um das anthropologische Paradigma des Spiegels herum. Wozu und worum er es entwirft, wird lange noch nicht deutlich, aber 1929 auf den Staatstafeln wird es deutlich, sehr deutlich. Er entwirft seine Erfahrung um eine Kombination aus anthropologischem und anthropofagischem (auch theo- und statophagischem) Paradigma: Das Objekt, das Bilder gibt, verkehrt mehr und intensiver und gleichzeitig schwächer und minderer als ein Spiegel, das ist nämlich ein Polobjekt, das durchgehend und in alle Richtungen dreh- und wend- und kippbar ist. Die Technik der Bildgebung ist durch dieses Objekt und durch die Bewegung dieses Objektes verschlingend und verschlungen. Dazu: Das Verzehren des Gottes, Tafel 79, dazu legt Warburg sie an. Nicht nur dazu. Tafel 79 ist eine Summe und Summen sind immer zu viel und zu vielem. Aber dazu auch.
2.
1896 ist das alles noch nicht deutlich. Warburgs Arbeit an einer Bild- und Rechtswissenschaft beginnt damit, dass er kreuzt. Er hat in Amerika gesehen, dass die Leute mit den Schlangen etwas anderes machen als das im Fall Laokoon der Fall ist. Andere machen anderes mit den Bildern, aber das ist nicht nur, das macht auch möglich. Das macht auch möglich, das lässt Bewegung auch gehen. Warburg kreuzt, indem er sich jemanden schnappt, der kein Kunsthistoriker ist ist, sondern, wie die Schlangentänzer, jemand anders: er sucht sich diesmal jemanden, der Jurist ist und das römische Recht kennt. Er kreuzt die Grenze seiner Wissenschaft, und setzt sich mit dem Juristen auf ein Schiff, sie machen wirklich eine kleine Kreuzfahrt, natürlich auf einem Schiff, auf Wellen. Mit Sally George Melchior, dem Juristen, will sich Warburg unterhalten und tut es professionell, mit Zettlkasten und wissenschaftlichem Apparat (daher wissen wir von diesen Gesprächen).
Melchior und Warburg sprechen auf dem Schiff über symbolische Handlungen, also über daejenige, was am Anfang eines gründsätzlich rechtswissenschaftlicen Textes des 19. Jahrhunderts besprochen und dort auch wieder als Anfang des römischen Rechts zum Gegenstand wird. Savigny beginnt seinen berühmten Text über den Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Wissenschaft mit Passagen zu "symbolischen Handlungen". Bevor die Römer nämlich etwas begrifflich begriffen und dann mit kanonischen Methoden wieder ausgelegt hätten, hätte sie symbolische Handlungen eingsetzt und verwendet. Dort wird zwar auchgegriffen, aber sie gehenen nicht im Begriff auf. Savigny meint damit Formeln, Protokolle und Akte, also das, was man auch als actio und als Teil eins älteren, noch antikeren, archaischen römischen Rechts versteht. Reinach würde das als Akt und Versprechen, wir heute als Sprech- und Bildakt beschreiben können. Savigny schreibt von der mancipatio, Warburg und Melchior sprechen über die mancipation. Alle drei nennen das symbolische Handlungen, so muss man die mancipatio nicht nennen. Es ist gut möglich und wahrscheinlich, dass Warburg und Melchior diesen Text gelesen haben, notwendig ist es nicht. Gaius wiederum nennt den Akt, die Formel oder das Protokoll ein Bild, eine bildliches Geschäft oder einen bildlichen Verkauf. Das passt dem Warburg gut in den Kram. Das Geschäft bildet.
3.
Die mancipatio ist eine Formel, durch die Bewegung geht. Diese Bewegung beschreibt man unter anderem als Übertragung, und zwar als Übertragung von Eigentum. Der Formel ist Bewegung und Übertragung eigen, der Bewegung ist Formel und Übertragen eigen, der Übertragung ist Formel und Bewgung eigen, das Eigentum word übertragen, Formel und bewegt. Das passt dem Warburg gut in den Kram. Warburg forscht daran, durch das Bewegung geht, er forscht daran, wie Beweung geht, wie sie möglich wird, auch Bewegung, die etwas übertragen soll, in der nämlich Antike nachleben soll. Er gliedert nicht nur seine Forschung, sondern macht die Gliederung, wie das auch in der frühen Neuzeit bildrhetorisch gemacht wurde (Carstenpeter Warncke hat das detailliert nachgewiesen) zum Argument. Gliederung ist Argument, Argument ist Gliederung. Warburgs Gliederung lautet Wort, Bild, Orientierung, Handlung (actio). Eine Bewegung geht, durch etwas geht Bewegung, in dem der Bewegung Wort und Bild, Orientierung und Handlung, actio, Aktion, gegeben wird. Das intesssier an der mancipatio, darum interessiert ihn die mancipatio. Ihr wird Wort gegeben, bei Gaius, der sie wörtlich, mit Worten beschreibt.Er gibt ihr doppelt Wort: Gaius beschreibt sie mit Worten, damit sie verbindlich wird, damit die manicipatio selbst Wort geben, sebst verbindlich sein kann. Er gibt ihr Bild, indem er sie Bild nennt und indem er sie vorstellbar, wahrnehmbar und ausübbar macht. Er gibt ihr Orientierung, indem Gaius sie mit dem Kosmos assoziiert und ihr da eine Stellung gibt, als Teil einer Technik, die gut macht, die also vergütet oder veredelt oder die durchgehen lässt, die also passend ist oder passieren lässt, die angemessen, billig oder gerecht erscheint, auch wenn sie nicht fest sitzt und nicht dem Gesetz genügt, dem Gesetzt nicht genügt. Er fügt die Beschreibung an einer bestimmten Stelle der Institutionen ein. Er gibt ihr Aktion, in dem er sie actio nennt, als Teil des römischen Formularprozesses begreift und indem er sie so schildert, dass sie als Handlung erscheint, als etwa, in der es ein intentionales Subjekt (die Person) und ein Ding gibt und die Person mit dem Ding was macht.
So weit so gut, so weit, so einerseits überraschend, aber anderseits auch trivial. Hätte man nicht gedacht, dass Warburg Rechtswissenschaftler war, hätte man sich aber denken können, denn alles lag vor, auch dem Dogma großer Trennung und auch den Behauptungen, dass man das Eine und das Andere, also etwas das Bild und das Recht oder den Westen und New Mexico im Westen, also u.a. Athen, Rom und Oraibi nicht verwechseln solle.
4.
In der Messehalle von Neresheim wurde gestern nichts verkauft, kein Eigentum übertragen. Gestern wurde dort geheiratet und getauft. Übertragen wurde. Durch das Bewegung gehen soll, das wird in dieser Messehalle auch über Formel, Protokoll und 'actio' verstanden, aber nicht in dem römischen Recht beschrieben, das wir ius civile nennen. Das Verfahren wird als Liturgie bezeichnet, beschrieben wird es im kanonischen Recht und in den Literaturen zur Liturgie. Knollers Bewegung über Messe(n) teilt eine Gemeinsamkeit mit dem, was Luhmann Legitimation durch Verfahren nennt, das istnämlich der Umstand, das die Wahrnehmbarkeit verdoppelt wird, man spricht teilweise von einer Aufteilung in Form und Materie, teilweise von einer Aufteilung in Form und Inhalt eines Vorgangs. Luhmann denkt dabei an Regeln, die sich auf Regeln beziehen, die eine zweite Beobachtung enführen würden und die Entscheidungen her- und darstellbar machen würden. Wie anders das Verhältnis zwischen Knollers Decken und den Vorgängen am Boden ist, das ist mir noch nicht klar.
Rekursiv ist es bestimmt. Unten wird getauft, oben wird gezeigt, wie man tauft. Aber unten wird auch gezeigt, wie man tauft und oben wird auch getauft. Alles was unten passiert, sieht man oben wie. Alles was oben passiert sieht man unten wie. Man spricht davon, dass das Bildprogramm in Neresheim einem strengen liturgischen Protokoll folgen würde. Es kann sein, dass hier nichts vermehrt wird, dass die Beobachtung nicht mehr wird, weil sie so geteilt wird. Aber Rekursion findet schon statt, auch Mimesis. More to follow.
2 notes
·
View notes
Text
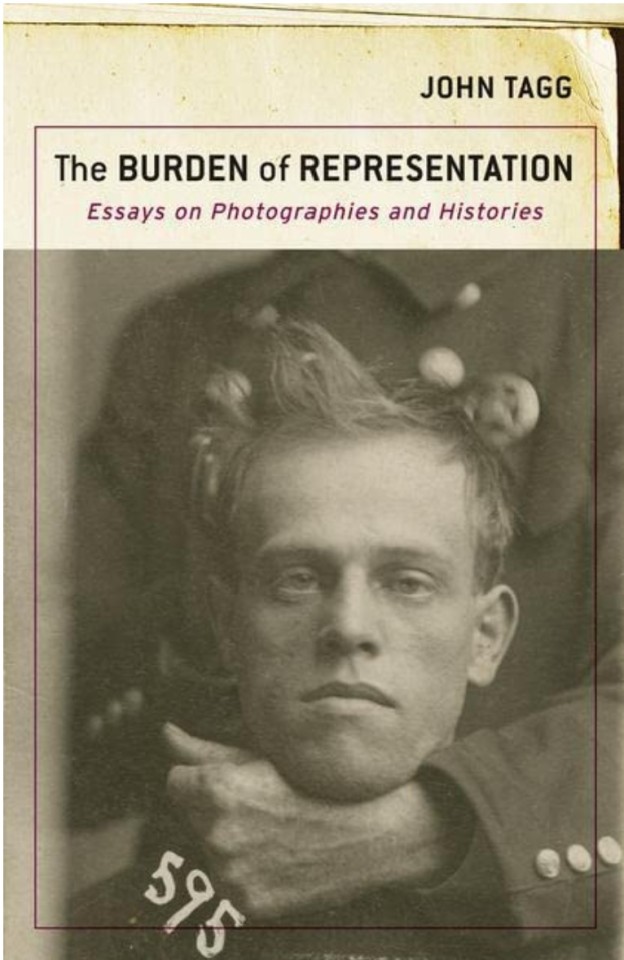
Surveillance
1.
John Taggs Aufsatz A Means of Surveillance ist teilweise übersetzt worden. Dieser Teil heißt deutsch Eine Rechtsrealität. Die Fotografie als Eigentum vor dem Gesetz.
Herta Wolf die Fantastische hat den Text in Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters aufgenommen. Der Text ist bei suhrkamp angekommen, in einer kanonischen akademischen Literatur. Besucht man ein Seminar oder eine Vorlesung zum Urheberrecht und taucht der Text dort nicht auf, kann die Veranstaltung praktisch sein. Sie wird oberflächlich sein, das gilt vor allem dann, wenn ein Rechtswissenschaftler die Auswahl der Texte damit begründet, nur die rechtliche Seite des Themas und nicht die unrechtliche oder die fotografische Seite des Themas behandeln zu wollen. Dann wird die Veranstaltung wahrscheinlich blöd und man klickt sich besser durch youtube durch, ununiversitärer wird es bestimmt nicht werden. Diesen Text wollen wir überwachen.
2.
Mit folgenden Thesen steigt John Tagg ein:
Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert hätte es eine grundlegende ökonomische und soziale Transormation gegeben. Was ist eine Transformation, wann ist sie grundlegend, was genau ist passsiert?
In diesem Zuge seien kapitalistische Gesellschaften Westeuropas entstanden. Kamen sie aus dem Nichts? Gab es vorher keinen Kapitalismus? War er vorher nicht gesellschaftsfähig? Was war in Nordeuropa, Südeuropa Osteuropa und was im Rest der Welt? Ist Deutschland damals Osteuropa oder Westeuropa gewesen?
Damit sei auch die Ausübung von Macht radikal restrukturiert worden. Welche Macht hat die Macht, Macht radikal abzuschaffen und an ihre Stelle eine neue Macht zu setzen? Ist Restrukturierung revolutionär?
Es habe einen absoluten Monarchen gegeben und seine Macht sei total, dramatisch und offensichtlich gewesen. Also gab es sie nur auf dem Theater, oder gab es die Totalität und das Offensichtliche auch jenseits des Dramas?
Diese Macht sei ersetzt worden. Ist sie damit verschwunden, ist sie vorbei?
Der Ersatz seine eine diffuse, alles durchdringende Mikrophysik der Macht, die unbemerkt in den kleinsten Pflichten und Gesten des Alltagslebens operierte. Nur da? Waren die Leute alle doof, blind, taub, oder warum hat niemand etwas bemerkt oder hat doch jemand was bemerkt, zumal es ja offensichtlich gewesen sein soll (s.o.).
Ihren Sitz hätte diese feinverästelte Macht in einer neuen Technologie gehabt, einer Konstellation von Institutionen - u.a. dem Krankenhaus, der Schule, dem Gefängnis, der Polizei, deren Disziplinierungsmethoden und genormten Überwachtungstechniken eine Hierarchie dienstfertiger Subjekte in genau der Form hervorbrachtem, ausbildeten und aufstellten, wie sie die kapitalistische Arbeitsteilung für das ordnungsgemäße Funktionieren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens benötigte. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Hat sich das der Tagg ausgedacht, hat er es entdeckt oder ein anderer? Ist alles klar an diesem Satz oder wäre es hilfreich, in den Texten nachzulesen, in denen weiter beschrieben wird, wie so ein Krankenhaus sterbende, siechende, überlebende, verdienende und unverdienende Subjekte diszipliniert?
Fazit: Warum stehen da keine Fußnoten? Ist das, was da steht, ist alles an der Passage selbstverständlich und eigentümlich, ist es so formuliert, wie es sich gehört, scheint und gemeint ist, ist es schon so proper und musterhaft formuliert, dass nichts mehr von diesem Satz absteht und nicht abstehen muss? Steht etwas ab, wie Fußnoten das tun und so den Satz darum zu einem Satz von Leuten machen, nach denen man, wie der Laokoon es tut, schauen muss, weil an ihnen immer etwas absteht? Ist die Passage sogar keine Passage mehr, sondern nur eine Stelle?
2.
Man kann Texte befragen, um jedes Problem, dem sie gewidmet sind, wegzureden. Dekonstruktion kann ein Abführmittel oder eine Entsorgung sein, muss sie aber nicht sein. Man kann die Aussagen auch befragen, um sie ernst zu nehmen. Man soll zurückhaltend dabei sein, einem Autor Unklarheit vorzuwerfen. Wenn die Schönheit schon im Auge des Betrachters liegt, dann liegt die Unklarheit eventuell im Auge des Lesers. Man soll äußerst zurückhaltend dabei sein, einem Text dasjenige vorzuwerfen, was nicht drin steht, denn der Text endet, damit andere zum Zuge kommen und schreiben können, was dort nicht geschrieben steht. Man soll zurückhaltend sein, einem Autor vorzuwerfen, auf der Strecke geblieben zu sein, die er zurückgelegt hätte. Warum soll das so sein? Das sind bei allen denns letztlich Gebote, Gebote werden nicht begründet, die habe ja nichtmal Präambeln.
Taggs Passage ist eine Einleitung. Er verdichtet dort Thesen von Michel Foucault, als Redakteur hätte ich eventuell empfohlen, doch die Quellen zu nennen, damit Leser, falls Fragen offen bleiben, weiterlesen zu können. Tagg verdichtet Motive und, wo wir schon bei der Macht und bei dem Drama sind, schreibt eine Passage, die selbst mächtig und dramatisch daher kommt. Er will ja in die kleinsten Verästelungen seiner Leser hinein, da kann man so vorgehen. Aber dennoch ist das eine Passage, die Foucaultrezeption auf den Punkt bringt und darum ein Objekt für die Frage danach ist, wie man Foucault rezipieren kann. Macht nennen manche Leute Püsenz, ehrlich gesagt sind es nicht viele, genauer gesagt ist es einer, aber vielleicht vermehrt er sich noch.
3.
Püsenz ist ein biegsamer Verwandter des pouvoir und der puissance, lebte eine zeitlang dort, wo alles Sinn machte (also in Alsenz), wo aber irgendwann die Steinhauer streikten und dann fast alle pleite gingen, weil die Stadt vom Sandstein lebte. Heute gibt es in Alsenz noch ein Steinhauermuseum, da geht aber eigentlich niemand hin. Google it, ich erfinde grundsätzlich nichts.
Püsenz ist seit dem das, was es immer ist: ein Effekt, der effektiv ist, weil er folgsam ist. Püsenz ist sekundär, dienlich, hilfreich, solange und soweit Püsenz hilft. Für Püsenz gilt eine der wichtigsten Daumenregeln: Was hilft hilft und was nicht hilft, hilft nicht. Püsenz ist ein Mittel, heiligt also die Zwecke, während die Zwecke entgegen der h.M. (die nicht Püsenzmeinung, sondern herrschende Meinung ist) niemals die Mittel heiligen.
4.
Wenn ein Text etwas verdichtet und dann noch kanonisch wird, wenn er Teil eines Corpus ist, den man, gerade weil man ihn nicht vollständig wahrnehmen und wahrhaben kann, auch nicht ignorieren kann, dann bekommt er die Form jener Norm, die die Leute Gesetz nennen. Wenn durch eine Norm Effekte reproduziert werden und wenn sie effektiv ist, dann ist sie wendig, auch so, dass ihre Überwachung der Kanal ist, in dem mitläuft, was man mit einem Wort von Niklas Luhmann Unterwachung nennen kann. Große Männer sind gefährlich, weil kleine Männer ihre Gefolgschaft bilden (Bazon Brock, Die Kinder fressen ihre Revolution) oder weil in ihnen auch kleine Männer stecken.
Macht wird mitgemacht (wie man den Besuch von Verwandten mitmacht), die Teilung und Übertragung verdient es, deswegen rezipiere ich Foucault und halte ihn für einen lesenswerten und hilfreichen Autor, sogar ohne die Lesarten, die ihn zu einem Neoliberalen machen, der sich (natürlich erst in Amerika, unweit vom Silicon Valley) vom Saulus zum Paulus verwandelt hätte. Taggs Text beginnt dort, wo Foucaults Texte enden, wo die Einleitung endet.
4 notes
·
View notes
Text

Diagramm
Das Diagramm ist ein durchgehendes Zeichen, ist also auch durchgehend ein Zeichen. Dass so ein Zeichen anhält, das ist nicht gesagt, ausgeschlossen ist es nicht. Das Diagramm ist passierende Zeichnung und zeigende Passage.
Diagramme sind niedere Bilder und niedere Texte, minore Objekte, zu gering für die Inventionen des byzantinischen Bilderstreites (wegen solcher Kleinigkeiten schlägt man sich nicht die Köpfe ein) und zu gering für den Mythos von der Geburt großer Leistung. Plinius sagt von Diagrammen nichts, und der lässt sich an sich auf so ziemlich alles herab, nur keine Diagramme. Narziss spiegelt sich lieber als seine Maße (z.B. Größe, Gewicht, Puls und Blutdruck) in Diagrammen aufzuzeichnen.
Diagramme sind, wie Embleme, Kreuzungen, in denen vorkommt, was an anderen Stellen unbedingt auseinandergehalten wird. An ihnen lassen sich Kontraktion und Distraktion leicht betrachten. Diagramme werden geschrieben und hören dadurch weder auf, Bilder zu geben oder zu zählen. Sie werden gezeichnet und gemalt, ohne dadurch aufzuhören, zu zählen und zu erzählen. Diagramme sind auch in der Moderne Tafeln und Tabellen, aus ihnen bildet Hermann Jahrreiss 1930 zum Beispiel sein System des Verfassungsrechts. Als minore Objekte sind die Diagramme den Akten affin, also denjenigen Medien, die in der Rechtspraxis auch einen niederen Status als Bücher haben und die in den Historiographien und Theorien nicht herangezogen werden, um das Dogma der großen Trennung zu stützen.
Das Diagramm soll keine Abwesenheit überbrücken und nicht vor dem Abgrund abschirmen. Diagramme sollen Regung, Relationen und Wechsel wahrnehmbar machen, zeichnen also Sterne, Waren, Herden, Wanderer auf: alles das, was zwar entfernt, aber nicht weg ist.
Hamburger, Roxburgh und Safran haben vor kurzem eine Art Handbuch zur Diagrammatik publiziert. Sie nennen das Diagramm ein Paradigma. Man könnte es auch ein Dispositiv, ein Diadigma oder schlicht Dia nennen. Die drei Herausgeber sagen, sie würden einem cross-cultural approach folgen. Weil Diagramme kreuzen und sie aus Kreuzungen kommen, also nicht vermischen, was nicht schon gemischt ist, ist das doppelt gemoppelt gesagt. Diagramme taugen nicht, um sie entweder dem Eigenen oder dem Fremden zuzuschlagen. Diagramme kommen in der reinen Rechtslehre nicht vor, das sind ja nicht einmal reine Medien. An Diagrammen lässt sich der Westen nicht gegen des Osten ausspielen, an ihnen wird die Frage, was der Andere nicht hat, einen selbst aber groß gemacht hätte, nicht gestellt. An Diagrammen lässt sich auch nicht die Zivilisation der Interpreten gegen die Barbarei der Anderen ausspielen. Diagramme nutzen alle(n), schaden auch. Die ubiquitäre Verwendung für die Guten und die Bösen, die Schlauen und die Dummen, die Wendigen und die Betonköpfe könnten ihnen einige nicht zu verzeihen. Man übersieht sie, wenn es darum geht, große Geschichte zu erzählen. Sie sind keine Kronzeugen der Ausdifferenzierung, sind Zeugen des Kreuzens, oder: Zeugen dessen, was Warburg Pendeln nennt, damit eine regende und geregte, zügige Form ist. Diagramme sind fröhliche Wechsler und Austauscher, Übersetzer und Übersteller, Versetzter, Versteller und Verleger. Sie werden nicht unterschrieben, nicht signiert, als seien sie nicht stolz genug.
Wo wir schon bei Paradigmen sind: Wo Diagramme sind, da ist Laokoon nicht weit, ist also auch das sog. Laokoon-Paradigma nicht weit: Paradigma von Digmen, durch die Regung geht.
0 notes