#perigraphé
Text
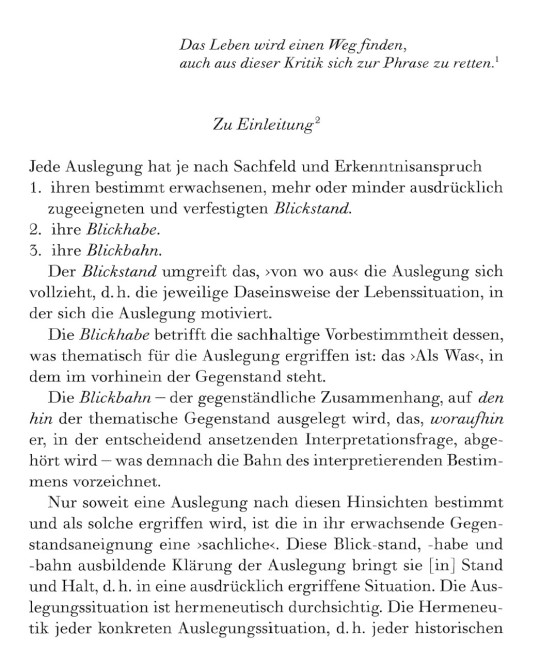
Bildrhetorik
1.
Das lebende Recht und das graphische Recht: 1922 stirbt Eugen Ehrlich, 1922 schreibt Martin Heidegger für die Universität in Marburg den sog. Natorp-Bericht. Das Motto des Textes rutscht wie ein Kommentar an Ehrlichs Arbeiten zum lebenden Recht. Das Leben, so Heidegger, wird einen Weg finden, auch aus dieser Kritik sich zur Phrase zu retten. Viele Jahre später liest Gunther Teubner Ehrlich als einen Theoretiker der Nestwärme und unterstellt im Hinblick darauf, dass in der Gegenwart eher kalte, technische Vorgänge für Rechte jenseits des Rechts sorgen würden, dass also das juristische Monopol nicht mehr durch die Wärme des Lebens, sondern kalte Autopoiesis aufgebrochen würde.
David Nelken schrieb in einer Replik auf Teubner kühl, es bedürfe mehr als ein paar Stellen von dem aufzuschreiben (" little rewriting"), was Ehrlich gesagt hätte, um ihn luhmannistisch zu interpretieren. Kleine Wiedergabe reiche nicht. Nelkens Kritik legte nahe, Teubner habe Ehrlich zu Phrasen versteinern lassen, um ihn als Fossil und sich als Erneuerer zu präsentieren. Die Linien des Schreibens liegen nicht mal auf ihren eigenen Linien, dafür haben sie einen Apparat, der sie ziehen und assoziieren lässt.
Nelken meinte eventuell, Teubner habe Ehrlich auf die Füße getreten - und verkürzt darin eventuell schon selbst eine Lesart Ehrlichs. Meint Ehrlich nämlich mit dem Lebenden nicht auch Nachleben? Das Fossil lebt nach. Teubners Ausführungen pressen Ehrlichkeit aus dem Stein. Ehrlich, Fracking, das könnte auch eine Methode sein, mit einem Leben umzugehen, das nicht erst im Moment des Todes vom Tod durchsetzt ist. et in poiesis ego. Selbst schuld, wenn man das Autopoiesis nennt.
2.
Heideggers Bericht von 1922 ist eine "phänomenologische Interpretation Aristoteles'". Heidegger argumentiert auch graphisch über eine [!] costruzione legittima, einen graphischen, optischen, visuellen, visionären, wissenproduzierenden und wissenreproduzierenden (in dem Sinne kurz: wissenden) Apparat, der das Wissen lesen lässt.
Der wissende Apparat ist in diesem Text zuerst Blick, Wahrnehmung, Interpretation. Wissen (als Bestand und Vorgang) sind hier zuerst Blick, der erstens Stand, zweitens Habe oder Griff (Fassung) und schließlich drittens Bahn, Trakt oder Streben (Trachten) hat. Etwas zu blicken und über etwas im Bild zu sein sind darin auch Metaphern des Wissens, aber solche Metaphern sind Zeichen sekundärer Bildlichkeit, vor der es keine primäre Bildlichkeit gibt, wie es auch vor einer sekundären Oralität keine primäre Oralität gibt, wie es vor sekundärer Schriftlichkeit keine primäre Schriftlichkeit gibt, weil jedes Sprechen, jedes Blicken und Bilden, Schreiben und Reden sekundär ist.
Das heißt auch, dass ein Wissen, das geblickt wird oder auch ein Wissen, durch das man im Bild ist, auch Wissen überträgt und teilt, so wie das Metaphern machen, wie es aber auch Begriffe machen. Nicht nur die Metapher ist sekundär, der Begriff ist es auch. Man muss nicht sehen können und keine Augen haben, um etwas im Blick zu haben oder um im Bild zu sein. Blick und Bild machen auch blind, machen auch unsichtbar, blenden auch. Blick und Bild sind hier Begriffe eines epistemischen Apparates, der - wie Heidegger vorschlägt, erstens Stand hat (und sei es, dass er in der Bewegung Stand hat), zweitens Habe (Griff/Fassung) und schließlich Bahn (Trakt/Trachten, Streben).
2.
Blicken und Bilden sind artifizielle Verfahren, artifizielle Apparate. Blick und Bild sind wissende Apparate, Apparate, die wissen lassen, sogar weisend. Blicken-können und Bilden-können sind instituierende Vermögen, instituierend in Cornelia Vismann Sinne: Sie helfen im Leben, sie helfen ins Leben, sie helfen leben, sie helfen aus dem Leben.
Mit ihnen kann man sich orientieren, auf andere(s) einstellen, andere(s) schätzen, andere(s) mustern. Heidegger liest Aristoteles graphisch und dabei explizit und implizit. Für solche Lektüren ist Heidegger nicht der erste. Quintillians Institutionen sind in den Passagen besonders graphisch, wo es um die kleinen, die unfertigen Römer geht, die Kinder, und wenn er später zur actio kommt, zur Verkörperung/ Beseelung (Performanz) des logos, des Wortes, der Rede und ihrer Sinne. Besonders graphisch sind sie in dem Sinne, weil sie dort sich besonders dazu äußern, wie diejenigen, die auch einmal Orator werden sollen, lernen sollen, Linien zu ziehen. Nicht erst Heidegger liest Aristoteles phänomenologisch. Das macht Quintilian auch, wenn er Griechenland 'von außen betrachtet' und griechisches Denken in seinen Äußerlichkeiten entfaltet. Peri hermeneia, perigraphé.
#Bildrhetorik#law and imaging#aristoteles#martin heidegger#eugen ehrlich#das lebende recht#das graphische recht#blick#peri hermeneia#perigraphé
1 note
·
View note
Text
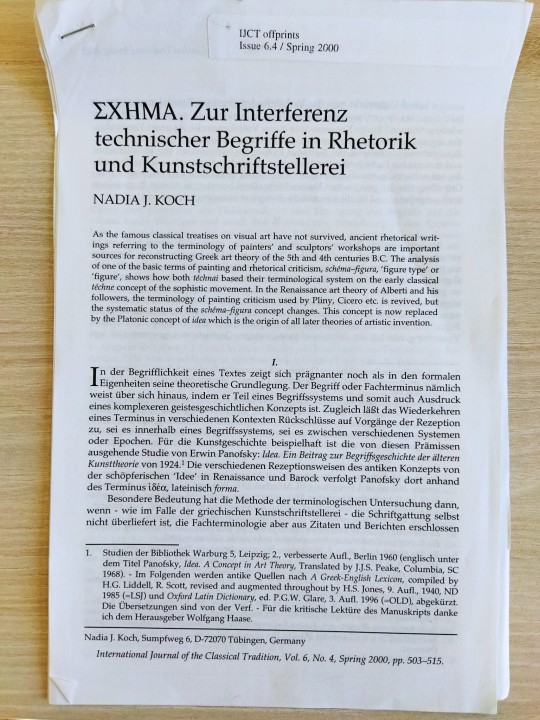
Welten kreuzen
Fröhliche Kreuzung (Steinhauer) oder stechende Versäumung ( Augsberg): Ino wollte das Buch die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt des Rechts nennen, immer diese Protestanten. Ich wollte es die Außenwelt der Innenwelt der Außenwelt des Rechts nennen. Sophie und er haben das Buch herausgegeben (eben!!!!), und sich scheinbar durchgesetzt. Wegen des pomeriums sitze ich gerade wieder an den Arbeiten von Nadia Koch, die sind top!
1 note
·
View note
Text


Das Pomeriumprotokoll
1.
Das Projekt zu Warburgs Staatstafeln forscht zu Bild- und Rechtswissenschaft, zur Rhetorik und zur Kulturtechnik, d.i. auch ein Zweig der Medienwissenschaft, der sich nach Kittler in Berlin und Weimar 'institutionalisiert' hat und der in der Rechtswissenschaft vor allem mit dem Namen Cornelia Vismann verbunden wird. Danach ist erstens Rechtstheorie auch Produktionstheorie und Reproduktionstheorie, zweitens wird Theorie auch als Effekt von Praxis gedacht, sow ei Praxis als Effekt von Theorie gedacht wird.
Mit einem nicht vergifteten, aber doch welkem Lob hat ein Kollege angemerkt, "man könnte an (...) die zu ihrer Zeit zweifellos visionäre Medientheorie von Kittler denken". Ins Grab gelobt ist auch gelobt. Diesen durchaus schönen, aber eben doch auch welkigen Blumenstrauss verknüpfte der Kollege mit höflichen Hinweisen darauf, dass Vismanns Überlegungen zum pomerium eventuell nicht auf der Höhe der Zeit seien. Vielen Dank für die Blumen von Udo Jürgens wählte das ZDF nicht zufällig als Titelsong für Tom&Jerry. Aber sicher trifft der Kollege ein Problem und Probleme werden am besten geteilt, nicht weggeredet. Das Projekt über Warburgs Staatstafel ist ein Gegenvorschlag, ein Gegenentwurf, aber auch eine Gegengabe,eine Art Rückgabe zu den Medientheorien und rechtsikonographischen Ansätzen des Kollegen und seinen Versuchen, sich an die Höhe der Zeit zu halten. Die Linie will ich klar machen.
2.
In der jüngeren Literatur zur Bild- und Rechtswissenschaft, in einer sehr kurzen Passage, hat Horst Bredekamp an eine Kooperation zwischen Aby Warburg und dem Juristen, Anwalt und Rechtswissenschaftler Sally George Melchior erinnert. Details stehen auf anderen Zetteln. Im Fazit schreibt Bredekamp, dass in Warburgs, dieser Kooperation folgenden Bemerkungen zum Distanzschaffen, zum Symbol und zum Akt eine "umfassende Theorie der notwendigen Sichtbarkeit des Rechts" stecke. Das Recht produziere "die Allgemeingültigkeit" über seine Visualisierung, über die Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit, die durch Symbole und Akte laufe.
Was Bredekamp schreibt, wäre nicht weiter kommentierungswürdig, wenn das Symbol und der Akt still halten würden (auf stumme Weise haltbar wären) und gleichzeitig ein Versprechen des Sprechens und Schreibens erfüllen würde, nämlich etwas zu beinhalten und dem Inhalt eine Form zu geben. Aber das tun sie nicht. In Warburgs kurzen, an die Gespräche mit Melchior anschließenden Bemerkungen steckt noch kein Heureka, das kommt erst später.
Die Verwandtschaft zwischen Wissen, vis und Visualität geht mit wechselseitigen Kooperationen und Komplizenschaften einher. Dass es Verwandtschaft, Abhängigkeiten und Konditionierung zwischen Recht und Bildgebung gibt, das liefert entweder keine 'Einsicht' oder nur eine Sicht der Lage. Und die polarisiert. Allein in der Literatur geht damit schon im griechischen Denken Vertrautheit und Unheimlichkeit, vor allem Ambiguität noch bei scharfen und entschiedenen Denkern einher.
Nadia Koch hat in einem Text zur Bildrhetorik und zur Werkstatt der Humanisten daran erinnert: Platon kann an einer Stelle die graphé kritisieren, an der nächsten Stelle den Aufbau des idealen Gerichtswesens unter dem Gesetz (Nomoi 768c) in Analogie zur Herstellung eines Bildes schildern und sogar das Gericht selbst mit der perigraphé eines Bildes parallelisieren. Im Politikos nennt Platon einen unvollständig ausgearbeiteten, einen nicht erschöpften und nicht vollendeten logos ein Bild, das bis zur perigraphé, bis zur Umrisszeichnung bearbeitet ist. Ist das schon, ist das noch ein peripathischer, peripathetischer, peripatetischer logos? Wandert, pendelt der logos? In den römischen Institutionen entwickelt sich das Denken der Linie einerseits weiter zu Ciceros Vorstellung vom circumscriptio, aber auch zu Quintilians Vorstellung von enargaia. Da spaltet sich in Rom nichts, was nicht schon spaltend gewesen wäre. Die Linien spalten sich nicht aus der perigraphé ab. Diese Linie ist selbst schon polarisiert, sie polarisiert - und Mommsen Klarstellung, dass das pomerium nur die Innenseite, aber nicht die Außenseite Rom bezeichne, liefert zu der Geschichte nur - aber immerhin - weiteren Witz. Im Bildersturm hilft es doch auch nichts, sich auf eine Seite zu schlagen, denn der Sturm geht durch die Bilder. In der Bilderflut hilft es nichts, sich auf eine Seite zu schlagen, denn die Flut geht durch die Bilder.
3.
Die Hinweise auf die Aporien, die Paradoxien oder die Ambiguität der Verwandtschaften zwischen Wissen, vis und Visualität sind billig zu haben, billig zu haben auch der Hinweis, dass das alles kreativ und wichtig sein könnte. Billig ist es, Leitbilder zu behaupten, also bestimmten Bildern eine kreative, schöpferische Bildmacht zuzuschreiben, ohne sich die Produktionsbedingungen und Reproduktionsbedingungen genauer anzuschauen. Schwieriger ist es, Aporien in Passagen zu verwandeln, Paradoxien zu entfalten oder Ambiguität durchzuarbeiten. Dafür braucht man Protokolle und Kommentare.
Cornelia Vismann Überlegungen zu pomerium setzen hier an, sie setzen quasi da an, wo Johanna Braun und Daniel Damler aufhören, wenn die beiden die Macht ins Leitbild verlegen. Das machen Braun und Damler nicht nur, so wie Vismann nicht nur nur weitermacht, wo andere aufhören. Aber im Detail gibt es Punkte, an denen Auseinandersetzung zu führen ist. In der Veröffentlichung zu Bildregimen des Rechts des setzt sich Vismann kritisch mit der Annahme einer Bildmacht auseinandernder, die angeblich am und im Bild liegen soll. Vismann verweist dort auch auf meine bildrhetorischen Forschungen, weil Rhetorik und Kulturtechnikforschung in einem Punkt konvergieren, nämlich darin, die Schrift nicht von der Schriftlichkeit oder das Bild nicht von der Bildlichkeit, die Sprache nicht von der Mündlichkeit her zu denken. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Entwürfen von Vesting und vielleicht auch schon ein Grund dafür, dass sich Vesting von dem, was er mit den Namen Kittler asssoziiert immer wieder distanziert. Nach rhetorischer Auffassung (wie nach Auffassung des römischen Rechts) ist das Bild ein umstrittenes Objekt, sein Status als Bild ist der Effekt von Verfahren, die zwar bildgebend sind, aber nicht nur Bilder involvieren. Sprache macht Bild, Tafeln machen Bilder, Redner machen Bilder, Fassaden machen Bilder, Klima macht Bilder - das sind nur ein paar Objekte, bei den Verfahren wird es noch mannigfaltiger. Das Schreiben ist älter als die Schrift (Macho) und nicht nur Schreiben macht Schrift. Mündlichkeit ist keine reine Oralität, die sekundäre Oralität ist nicht das erste mal ein Phänomen, in dem die Oralität sekundär ist.
In dem Aktenbuch versucht sie, Vismann, Recht von seinen Medientechniken zu denken, aber nicht die Akte von einer 'Aktheit' her. Der Begriff des Aktenaktes taucht auf, entpuppt sich aber als Beschreibung von Verfahren, die unterschiedliche medien und Techniken assozieren, und nicht nur das. Der Aktenakt steckt auch voller Passion und Passivität, voller Reaktion etwa. Am Beispiel der Akte wird deutlich, dass Vismann sich vor allem für solche Medien interessiert, die sich gegenüber der Trennung zwischen Sprache, Schrift, Buchdruck und Computer quer stellen, die sich aber auch zur Trennung zwischen Subjekt und Objekt entweder quer stellen oder nicht groß verhalten. Weiter interessiert Vismann sich für Medien, die ein "Haufen" sind, also zum Beispiel auf eine Weise geschichtet, die nicht in glatten Historiographien und Schichten aufgehen, die auch nicht an großen Trennungsmomenten, wie etwa der Erfindung der Schrift (und damit der Trennung von Mündlichkeit), der Erfindung des Buchdrucks, der Reformation, der französischen Revolution oder der industriellen Revolution festgemacht werden könne. Vismann Darstellung gleich dem Warburgschen Atlas, nicht der Evolutionstheorie Luhmanns. Vismann interessiert sich weiter für Medien, die assoziiert sind und assoziieren, die aber gleichzeitig umstrittene Objekte sind und zu dies und das gemacht werden. Das nennt sie ein Ding. Ist es ja auch.
4.
In der Arbeit über die Akten erwähnt Vismann das pomerium, die gründliche römische Linie, die gezogen wird zur Gründung der Stadt (und die in den Lateranverträgen nachlebt, sogar mit einer scharfen Graphik, dem Anhang eins zum Vertrag, unter dem sich ebenfalls die zwei Unterschriften von Mussolini und Gasparri finden).
Das pomerium ist eine gründliche römische Linie, wohl nicht die erste und nicht die letzte. Vismann legt auch schon nahe, dass diese Linie eine Assoziation ist und dass sie assoziert. Die Linie ist nur dann effektiv, wenn sie auf anderen Linien wiederholt wird, wenn also etwa anhand der Linie auch das römischer Bürgerrecht gestaltet wird oder sogar definiert wird, wer noch ein' Quirit' ist und wer kein 'Quirit' ist. Insoweit folgen auch Unterschriften noch dem Pomeriumprotokoll, denn die Unterschriften sind nur effektiv, wenn das, was sie machen, auf anderen Linien wiederholt wird. Die Unterschriften, die Warburg auf Tafel 78 mit den vier diplomatischen Schreiben präsentiert, wiederholen etwas von den Unterschriften unter den Lateranverträgen, sei es in den Ratifikationen, den Glückwunschtelegrammen. Das alles bildet schon im weiteren Sinne Anhang zu den Verträgen, auch im engeren Sinne müssen die Unterschriften sich in anderen Linien wiederholen, im Anhang unterschreiben Mussolini und Gasparri jedes Blatt noch einmal - und die Linien, die dort gezogen werden, die Umrisse des neuen römischen Staates wiederholen die Effektivität dieser Unterschriften, schon weil jetzt klar gezogen ist, wessen Staatssekretär Gasparri und wessen Premierminister Mussolini eigentlich ist. Das war ja bis dahin völlig unscharf. Das ist Gestaltung, Recht und Bildgebung. Die Macht hat dort keinen Parkplatz, vor kommt sie aber.
5.
Wie bei Warburg kommt es bei Vismann nicht auf das Ob der Verwandtschaft zwischen Wissen, vis und Visualität an. Über ihren eigenen Namen hat sie genug Witze gemacht, auch über die Verwandtschaft zu einem Vater, der Pastor, ein (gut-)aussehender, kräftiger Vismann hinter den Mauern Roms (post moerium), da wo die Schafe gehütet werden und der ihr angeblich schon in der Kindheit Heidegger vorlas. Wer das glaubt, wird nicht selig, stimmen kann es schon, auf jeden Fall hatte Vismann einen Sinn für das, was Bachofen mal Gerücht, mal Mythos, mal Legende, mal Gesetz nennt.
Auf das Ob der Verwandtschaft kommt es nicht an. Bei Theorie kommt es nicht darauf an, ob sie umfassend ist, ob sie irgendwo drin steckt. Der Witz entwickelt sich bei Vismann damit, die gründliche römische Linie auf eine Struktur der Referenzialität und weiter noch auf den Begriff des Begehrens zu beziehen. Damit ist auch angeregt, Aby Warburgs Ausführungen zum Distanzschaffen nicht in dem Hinweis darauf zu belassen, dass es eine Verwandtschaft zwischen Recht und Bildgebung gäbe und wie wichtig eines für das andere wäre. Es reicht auch nicht, an Macht oder auch an eine institutionelle Macht zu appellieren. Warburg Symbol und Warburgs Akt produziert auch Linien, sogar Linien, die auf Linien liegen können. Das können auch gründliche römische Linien sein. Es kann zum Beispiel die gründliche römische Linien sei, die Vergil mit einem Flashback (das gehört in der Moderne in jedes Court-Room-Drama) an den Anfang der römischen Geschichte stellt.
Die Linie duzt Warburg, er sagt ihr Du lebst und thust mir nichts. Das ist eine Schlängellinie, mehr noch, es ist eine Schlangenlinien. Anders als Vismann bezieht Warburg diese Linie nicht auf das Begehren, er bezieht sie auf das Verzehren, auf die Schlangen, den Laokoon, auf die Frage nach dem Bewegtbild (nicht unbedingt in Deleuzes Sinne). Das alles ist Symbol und Akt, die nicht still halten, die nicht auf stumme Weise haltbar sind und die ein Versprechen des Sprechens und Schreibens (und insoweit nach Adolf Reinach auch ein Versprechen des Aktes) nicht erfüllen, nämlich etwas zu beinhalten und ihm eine Form zu geben.
Warburgs Linie ist Zug und Assoziation, die kein Versprechen erfüllt, sondern Versprechen prozessiert. Dabei, das ist jetzt nicht nur ein Witz, verspricht er sich oft genug, das sind immer die Momente, wo er nicht nur Theoretiker von Verwechslungen, sondern auch ein Praktiker der Verwechselns ist (im Tagebuch wimmelt es von Belegen dazu, auch in den Briefen). Das Versprechen ist in solchen Fällen das Versprechen bewegt zu sein und zu bewegen, sogar die Sprache und das Sprechen. Man muss und man kann sowohl aus Warburgs schriftlichen Arbeiten als auch aus den Tafel scharfe, konkrete Bewegungsstudien extrahieren, die im Begriff der Polarität bündelbar sind. Was dann polarisieren meint, das meint bei Warburg nicht spalten (denn die Differenzen sind ohnehin schon da). Er spricht von pendeln, schaukeln, schwingen. Ich würde weiter gehen: Das ist wohl auch drehen, wenden, kehren, kippen. Es ist auch, was Warburg seit seiner Dissertation verfolgt, biegen. Das ist ein diplomatisches Protokoll, das die Grenzen von Tafel 78 entweder sprengt oder aber vorschiebt, da müsste man an anderer Stelle klären. Die Einfühlung, die Konkretisierung erfüllt nichts, sie bewegt was.
6.
Vismanns Überlegungen zu gründlichen römischen Linie, zur Struktur der Referenzialität und zum Begehren sind, das ist trivial, andere als Warburgs Überlegungen zum Distanzschaffen. Mit Nachdruck will ich aber betonen, wie produktiv ihre Arbeiten für das Projekt sind und wieso ihre Arbeiten 'mich auf Linie', mich auf die Fragen nach der Linie gebracht haben. Selbst wenn solche Arbeiten nicht auf der Höhe der Zeit wären, dann schöpfen sie auch aus der Tiefe, vor allem aber aus der Plastizität einer Zeit, deren Gegenwart ohnehin von Entfernung durchsetzt ist. Der Gegenvorschlag, die Gegen- oder Rückgabe an den Kollegen wäre insofern, kreative Ambiguität nicht zu versprechen, eventuell könnte das mehr bewegen.
2 notes
·
View notes