#theorie des flüchtigen
Text
Rabgiusa
1
Ich habe zwar keine Farm in Afrika, aber eine halbe Wohnung in Sils Maria. Das ist ein ehemaliges Fischerdorf in Graubünden, gehört zur Schweiz und liegt am Inn. In Sils Maria geben die Leute den Häusern keine Nummer, sondern Namen. Das Haus, in dem die Wohnung liegt, heißt Rabgiusa, Chesa Rabgiusa. Rabgiusa ist ein Ort, der oberhalb von Sils Maria liegt und eine Art Mont Ventoux von Sils Maria ist. Das ist zwar kein Berg, zwei Gipfel liegen noch höher, das sind Corvatsch und Furtschellas. Der Ort ist eine Matte und Alm, man könnte ihn Mout' Ventoux nennen. Wie Ventoux so ist dieser Ort äußert windig, windumtosst und daher immer wütend, tosend, rabiat oder rasend, daher hat der Ort einen Namen, wie der Mont Ventoux.
Das Haus wurde in einem Herbst gebaut, den man in Deutschland den deutschen Herbst nennt. Winter 78/79 war das Haus bezugsfertig und eine große Anzahl von Deutschen hatten sich dort eingekauft, um etwas zu haben, in dem Antike nachlebt: Ein Villa vor der Stadt, ein Jagdschloss, eine Eremitage, eine Sommer- oder Winterresidenz, ein Refugium, also Asyl oder Zufluchtsstätte.
2.
Was raste in diesem Haus? Unter anderem Frau Dürr, die schnellste Porschefahrerin von Sils Maria, Mutter dreier kesser, gewandter und bildschöner Töchter, Ehefrau des Nachfolgers von Emil und Walther Rathenau Heinz Dürr, der gerade im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Dieter Steinhauer, nicht ganz so schnell rasender, sogenannter Düsenknallanwalt ebenfalls mit Porsche aus Wuppertal, die Rembolds, ein Lehrerehepaar aus Baden-Württemberg, die Weisshaupts - Kesselproduzenten wie die Vissmanns (diesmal aber wirklich mit doppeltem S). Die Gehrings und die Nanns aus Esslingen, aus der gleichen Stadt Renate Pilz die gerade ihren Mann bei einem Flugzeugabsturz verloren hatte und das zum Anlaß nahm, die Firma ihres Mannes zu einem Weltmarktführer für Relais und Sicherungsschalter zu machen; die Fernaus aus Bochum, die beide offensichtlich an der Pommesbude zu sprechen gelernt hatten und das nicht nur zu hohen Kunst entwickelt hatten, sondern damit auch große Reichtümer erlangt hatten; Jürgen Edler, ein porschefahrender Zahnarzt mit leichtem Herzen aus Solingen. Sepp Hort, guter Freund von Franz Josef Strauß und sein Double, der hatte dort auch Quadratmeter, er war vor allem bei MBB in Lohn und Speise. Fast alle aus dem Schwabenland waren bescheiden, gläubig und pietistisch, die aus dem Rheinland fröhliche Nihilisten á lá James Last, die Bayern pragmatisch.
Kurz gesagt: Es wohnten auch Schweizer in dem Haus, aber in weiten Teilen war das eine deutsche Trotzanlage aus den Zeiten des sog. deutschen Herbstes. Das Haus war und ist streng stratifiziert, die Wohnungen im Erdgeschloss waren die billigsten, aber dort kauften sich die Berater, Ärzte und Lehrer ein, die damals noch auf einer Schicht gemeinsam kaufen konnten, also eben Sportlehrer vom Gymnasium, Anwälte und Zahnärzte.
Dort liegt auch die Wohnung, deren Hälfte meine Sorge sein soll, die andere Hälfte soll die Sorge meines Bruders Cajus sein. Vom ersten Stock an fast nur noch Unternehmer, höheres Management und Gesellschafter , wie eben die Familien Dürr, Weisshaupt oder Pilz (Ausnahmen gab es wie Frau Anwältin Steinberg aus Berlin mit einer kleinen Wohnung im ersten Stock).
Die Leute rasten. Dürrs rasten schon bald weiter und verließen nach ca. 12 Jahren das Haus, um neben Diana von Fürstenberg am Suvrettahang zu ziehen, Klassenaufstieg! Danach gab es in der Deutschen Bahn Fürstenbergpils, was alle Trincker und sonstwie Beteiligten eine zeitlang glücklich gemacht hat, bis vermutlich Mehdorn auf Radeberger umstellte, der Mensch muss gestalten und soll es tun.
3.
In den sieben mageren Jahren hätte ich die Hälfte beinahe verkauft, wenn mich nicht mein treuer Beirat Markus Krajewski mit Rat und Direktorin Marietta Auer mit Tat davon abgehalten hätte. Er sagte: spinn' nicht zu doll, mein lieber Freund (er liebt die Wohnung als Museum der BRD), und sie gab Kredit und Job, um das nicht zu tun.
Im Sommer bin ich mit Markus Krajewski zum Dank hoch zu Rabgiusa, wo er lustigerweise gleich und aufgefordert von Thomas Vesting aus Tübingen erzählte, was mich jetzt dazu bringt, mit Thomas Vesting unbedingt einmal ein paar Tage in dieser Wohnung verbringen zu wollen und nach Rabgiusa hochlaufen zu wollen: zum rasenden Dank. Dann ist Marietta Auer dran, aber Schritt für Schritt.
Rasen und Tosen, Wüten kann man als Kulturtechnik verstehen, das geht, denn die Leute tun es und tun einiges dafür, mit dem Rasen und Tosen, mit intensiv flüchtigen Dingen dankbar umgehen zu können. Alle meine Qualifikationsarbeiten habe ich dort geschrieben, jeweils im Sommer rasend schnell. Wer Tipps für hochengadiner Kulturtechniken juristischer oder juridischer Art braucht, darf sich bei mir melden, ich mache zu äußerst fairem Lohn Angebote, die man ablehnen kann, das bin ich dem Erbe schuldig, so verpflichtet Eigentum.
3 notes
·
View notes
Text
Mond setzt Gase frei: Theorie um Mondentstehung gerät ins Wanken

Überraschende Messergebnisse stellen die bisherige Theorie zur Mond-Entstehung in Frage. Ein japanisches Forscherteam der Universität Osaka hat das nach Auswertung der Messdaten der Mondsonde Kaguya festgestellt: Der Erdtrabant dünstet jede Sekunde 50.000 elektrisch geladene Kohlenstoff-Atome (Ionen) aus.
Im Fachmagazin "Science Advances" heißt es, dass die gängige Therorie der Mondentstehung damit in Wanken kommt. Laut dieser sei der MOnd vor Jahmilliarden wegen einer Kollision aus der jungen Erde herausgeschlagen worden.
Die Wissenschaftler aus Japan betonen: Die Armut an flüchtigen Elementen und Verbindungen, wie etwa Kohlenstoff oder Wasser, war bislang die zentrale Voraussetzung für dieses Entstehungsmodell. Tatsächlich sollen laut dpa neuere Analysen der NASA nachgewiesen haben: In den gesammelten Bodenproben des Mondes befindet sich auch Wasser. Dieser Fund stellte die Entstehungstheorie bereits damals auf den Kopf.
Wie der Kohlenstoff allerdings in den Mond gelangt ist, konnten die Wissenschaftler bislang noch nicht herausfinden. Auch eine Abschätzung des Kohlestoffvorrats stehe laut "Science Advances" noch aus.
Read the full article
0 notes
Text
Weihrauch / Olibanam Ätherische Öle (ätherische Öle)
Weihrauch / Olibanam Ätherische Öle (ätherische Öle) Frankincense / Olibanum FRANKINCENSE Name der Schüler: Boswellia carteri Familienname: Canlan Typ: Bäume Extrakt: Harz Extraktionsmethode: Dampfdestillationsmethode Herkunfts-, Vertriebs- und Produktionsbereich Sie stammt aus der Region des Roten Meeres. Sie wächst in China, Äthiopien, Iran, Libanon usw. Das Öl wird hauptsächlich in Europa und Indien destilliert. [ Systemische Stämme, Eigenschaften und Ausdrücke von Duftstoffen, Farbe ätherischer Öle ] Einige sind hellgelb bis grün. erfrischend, würzig, warm, reich und süß, wie ein schwacher Kleinhirn Es riecht nach einem balsamartigen, holzigen, trockenen, Incensey. Hinweise (Dufttyp): Mittlere zu Basisnotizen Duftgrad: Stark [Hauptzutaten] Kajinen, Campen, Pinene, Dippenten, Limonene, Tsujong, Ferrandren, Simen, Myrsen, Terpinene, Octylessigsäure, Octanol, Tintenhol, etc. Heilung für das Herz Angst und Nervosität. Stresssymptome. in einem Zustand des Unbehagens, das in die Vergangenheit führt. zu einem Zustand des Geistes besessen von Besessenheit. Es verursacht ruhige Emotionen. Atmen Sie tiefer durch und reduzieren Sie die Anzahl der Male. Auswirkungen, Auswirkungen und Auswirkungen auf den Körper Husten, Asthma, Bronchitis, Laryngitis, Catalum-Symptome. Erkältung, Grippe. für Zystitis. Zur Haut Ja Für Haut mit Ausbrüchen, trockener Haut und Haut mittleren Alters. Zu Kratzern, Narben, Falten. ♀ für Frauen ♀ Zur Belastung, Dysmenorrhoe, und unregelmäßige Blutungen. [Effekt Sohn der Aromatherapie] Sedierung, Tonikum, entzündungshemmend, antibakteriell, desinfizierend, adstringierend, angitus, Narbenbildung, Traumaheilung, Zellverteidigung, Zellwachstumsförderung, Leukozytenaktivitätsverbesserung, Es gibt Verdauung, Diuretikum, Menstruationsförderung, Uterustonik und schleimende Wirkung. [Anmerkungen und Kontraindikationen] Nicht besonders. Ätherische Öle, die miteinander kompatibel sind Sandelholz,Kiefer,Betibar, Geranium, Wäscherei, Mimosa, Orange, Neroli, Bergamotte, Grapefruit, Galvanam, Es wird gut mit Melissa, schwarzem Pfeffer, Basilikum, Zimt, Kampfer und mehr passen. Es gibt ein Gewürzsystem und ein Zitrussystem. Insbesondere verleiht es der Zitrusmischung eine seltsame Süße. Boswellia carteri 2.jpg ein wenig ein wenig ein kleiner Vortrag ♪ ( Weihrauch stammt aus dem alten französischen Wort, was "der Weihrauch der Wahrheit" bedeutet. "Olivanam" ist eine Theorie, die aus "Al-luban" kommt, was auf Arabisch "Milch" bedeutet, Es scheint zwei Arten von "Oreum Livanum" zu geben, was auf Latein "Libanonöl" bedeutet. In Japan wird es "Nyuko" genannt. Es ist weit verbreitet als Weihrauch verwendet worden, vor allem in religiösen Zeremonien seit der Antike. (Es ist sehr nützlich zum Beten und Meditieren, weil es den Effekt hat, die Atmung zu vertiefen und die Anzahl der Male zu reduzieren.) In der Antike gaben Ägypter und Hebräer viel Geld aus, um von Phöniziern importiert zu werden. Es war sehr wertvoll zu dieser Zeit, und es war fast den goldenen Blick wert. Übrigens gibt es eine internationale Handelsroute aus der Antike, die "die Straße des Weihrauchs" genannt wird. (Dieser Ort wurde im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe erklärt.) Weihrauch: Der Weihrauch ist schon lange so wichtig, dass es eine Beschreibung in der Bibel gibt. Darüber hinaus benutzten die Ägypter es, um Schmerzen in ihren Händen und Füßen in Verbindung mit Zimt zu lindern. Es wurde auch für Verjüngungspackungen, Kosmetika und Parfums verwendet. Darüber hinaus sind die Chinesen Es wird gesagt, dass es entdeckt, dass Weihrauch nützlich ist. Harz und Öl werden derzeit in Seifen, flüchtigen Halterungen in Kosmetika und Rohstoffen für Duftstoffe verwendet. Es wird auch für äußere Präparate wie Verstauchungen und Prellungen, sowie Kehlsand verwendet. Jüngsten Untersuchungen zufolge hat Weihrauch eine DNA-Reparaturwirkung. Es ist ein ziemlich wertvolles Öl. [Impression des Hausmeisters] Es fühlt sich ein wenig würzig an, aber es ist ein ätherisches Öl, das auch Wärme zu einem Bild macht. Als ich es zum ersten Mal roch, dachte ich: "Ich rieche es irgendwo." Ich erinnerte mich, dass dieser Duft mit dem Wachs für das Instrument gemischt wurde, das ich in der Vergangenheit verwendet habe. Es ist nicht so irritierend und einfach zu bedienen, und es ist sehr nützlich. Es ist so ein Duft, der das Summen eines kleinen Herzens beruhigt. 2aroma.jpg Dies ist Weihrauch, besonders zu empfehlen.
0 notes
Text
Marx macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel
Neuer Beitrag veröffentlicht bei https://melby.de/marx-macht-mobil-bei-arbeit-sport-und-spiel/
Marx macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel
Grab von Karl Marx in London. Foto: Paasikivi/CC BY-SA 4.0
Marx macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel
Ohne Marx wird die gegenwärtige Welt nicht begriffen
Back to the rotten roots
Auf einer Seite lesen
Die aktuelle Marx-Jubiläum legt vor allem eins offen: den zunehmenden Konservatismus innerhalb einer Linken, die sich verstärkt dem reaktionären Zeitgeist anpasst
Endlich, beim Blick zurück ins 19. Jahrhundert, scheint die Linke zumindest kurzfristig so etwas wie öffentliche Relevanz zu erfahren. Karl Marx würde 200 Jahre alt – und da müssen schon alle relevanten Medien, die ansonsten die üblichen Sachzwänge legitimieren, irgendeine Form von Würdigung veröffentlichen.
Der Hype um Marx, befeuert durch einen krisenhaften Spätkapitalismus, der alle antikapitalistischen Klischees früherer Jahrhunderte zu bestätigen scheint, geht einher mit den üblichen Strategien der Domestizierung eines kritischen Theoretikers, wie sie der Mainstream routinemäßig bei solchen Anlässen einschlägt.
Es wird der Fokus aufs Biographische, auf den „Menschen“ Marx gelegt, wie etwa bei der ZDF-Produktion zu Karl Marx, die den Verfasser der Deutschen Ideologie – ganz im rechtspopulistischen Zeitgeist – als einen „deutschen Propheten“ bezeichnete.
Man erfahre in dem Dokudrama viel über die Familie, über seine Geldsorgen, die Todesfälle und den „immerwährenden Vorwurf, Marx habe sich mehr um seine Studien und die Politik gekümmert als um die Seinen“, hieß es in einer Rezension. Marx‘ Werk – das gerade diesen Theoretiker berühmt machte – wurde in der ZDF-Produktion hingegen „sehr vernachlässigt“.
Der Marx von nebenan
Dieses kulturindustrielle Bemühen, dem Medienpublikum Marx als Menschen „näherzubringen“, geht somit mit einer inhaltlichen Unschärfe bezüglich seiner Theorie einher, so dass ziemlich jeder auf den Marx-Zug aufspringen kann. Zumeist reichen die Verweise auf Irgendwas mit sozialer Ungleichheit, Globalisierung oder den Krisen des Kapitalismus, um dann Teil des Medienhypes zu werden. Sobald diese formelle positive Bezugnahme auf Marx erfolgt, ist Heutzutage – wo kurze Youtube-Videos die mühselige Textarbeit an den Originalen ersetzen – so ziemlich alles möglich.
Selbst die SPD will nun Marx wiederentdeckt haben, der laut Andrea Nahles „die Notwendigkeit einer demokratischen Politik der schrittweisen Verbesserung der Lebensverhältnisse“ gesehen haben solle. Der „Kommunismus“ in der Ära des Kalten Krieges habe diese angebliche Erkenntnis des Autors des Kommunistischen Manifests nur „verdunkelt“, so die Orwellsche SPD-Marxistin, die in einem Tweet auch noch behauptete, dass Marx die Hartz-IV-Partei SPD „wie kein anderer“ geprägt habe.
Weitaus weiter links als die SPD (und weite Teile der Linkspartei) steht derzeit die katholische Kirche unter Papst Franziskus, der – im Gegensatz zu Nahles oder Lafontaine – immerhin eine einigermaßen brauchbare Kapitalismuskritik formulieren kann.
Folglich schien es gerade die Namensverwandtschaft mit dem kämpferischen Atheisten („Religion als Opium des Volkes“) zu sein, die Kardinal Reinhard Marx dazu prädestinierte, in Zeitungsinterviews seinen Namensvetter als „scharfsinnigen Analytiker des Kapitalismus“ zu preisen – und zugleich Werbung für die katholische Soziallehre zu machen, die „ja die marxistische Analyse des Kapitalismus und der Gefährdungen, die daraus entstehen, nie bestritten“ habe.
Auch die FDP weiß Karl Marx als den großen liberalen Denker zu würdigen, der hochaktuell bleibe. In einem Zeitungsinterview erklärte der FDP-Politiker Kubicki, er möge Marx wegen seines Hangs zum Freihandel. Laut der FDP-Größe würde Marx heutzutage „für Freihandelsabkommen wie Ceta“ stimmen. Dennoch scheute Kubicki auf Nachfrage davor zurück, Karl Marx posthum die FDP-Mitgliedschaft zu verleihen: „Das wäre wohl etwas übertrieben.“
Marx in der Kritik
Nur der Springer-Verlag wollte beim großen Marx-Kuscheln nicht mitmachen, das nun – quasi klassenübergreifend – das Marx-Gedenken in der Bundesrepublik prägt. Die Angestellten von Friede Springer (geschätztes, sicherlich sehr hart erarbeitetes Vermögen: 5,4 Milliarden Dollar) schimpften Marx einen Schmarotzer, dessen Texte „Knoten im Gehirn“ verursachten – und der für Hunderte von Millionen Toten verantwortlich sei, die seine Thesen verursacht haben sollen.
Dabei wäre eine kritische Auseinandersetzung mit dem widersprüchlichen marxschen Theoriegebäude – gerade angesichts der aktuellen Marx-Welle, die alles in postmoderner Beliebigkeit zu ertränken droht – von zentraler Bedeutung für eine radikal antikapitalistische Theorie und Praxis. Doch kann diese theoretische Arbeit, bei der anachronistische Teile der marxschen Theorie entsorgt würden, nur von der Linken in dem Bemühen geleistet werden, den Marxismus auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu heben.
Wenn ihm der Tag lang wurde, konnte nämlich auch ein Karl Marx viel Unsinn von sich geben. Und das nicht zu knapp: Die Marx’sche Teleologie, wonach der Sozialismus/Kommunismus den Kapitalismus mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes quasi automatisch beerben würde, wirkt angesichts der jüngsten Geschichte – wie auch der aktuellen, ins Barbarische tendierenden Krisenentwicklung – eigentlich nur noch peinlich.
Der Klassenkampf, von Marxisten aller Couleur als zentraler zur Hebel zur Überwindung des Kapitalismus postuliert, erweist sich selbst bei einem flüchtigen Blick auf die Sozialgeschichte der vergangenen 200 Jahre als binnenkapitalistischer Verteilungskampf – und somit als ein Mittel zur Integration der Arbeiterklasse in die kapitalistische Arbeitsgesellschaft in deren historischer Aufstiegsphase.
Und es lässt sich folglich mit Fug und Recht fragen, wann sich das werte Proletariat endlich dazu bequemen wird, seiner historischen Mission als revolutionäres Subjekt nachzukommen, die ihm Marx und Engels zugewiesen haben.
Viel Zeit, besagte „historische Mission“ zu vollenden, bleibt der lieben Arbeiterklasse angesichts rasch voranschreitender Automatisierung nicht. Die gegenwärtige krisenhafte Entwicklungstendenz kulminiert ja eher im Aufkommen einer ökonomisch überflüssigen Menschheit – siehe Flüchtlingskrise.
Telepolis
heise online
Quelle
قالب وردپرس
0 notes
Text
In der Mittagspause mit… Eberhard Baier – Genussbotschafter und Geschichtenerzähler
Als Leiter der Statistik und Steuerungsunterstützung ist Eberhard Baier eigentlich zuständig für die harten Zahlen, Daten und Fakten in der Stadt Konstanz. Dass er aber auch gerne mal eine Geschichte erzählt, ist nicht unbekannt. Das am liebsten in geselliger Runde. Eine gewisse Vorkenntnis des gastronomischen Getränkesortiments ergibt sich dabei fast schon von allein. Da traf es sich gut, dass ein Freund aus dem Kreis, mit dem Eberhard schon den einen oder anderen Edelbrand testete, sich eines Tages im Herbst 2015 einen Hof als Altersruhesitz kaufte. Zu diesem gehörte eine etwa drei Hektar große Streuobstwiese und, wie der Zufall so will, eine Brennanlage mit geltendem Brennrecht. Schnell war eine vierköpfige „Brennercrew“ in besagtem Freundeskreis gefunden – mit Eberhard als einer von ihnen.
Bevor die Geschichte jedoch seinen Lauf nehmen und das erste edle „Selbstgebrannte“ verköstigt werden konnte, war es noch ein langer Weg. Denn das Brennen als bodenständiges Handwerk lernt man nicht eben an einem Wochenende. Gemeinsam besuchte die Crew verschiedene Seminare, in denen sie alles angefangen vom Unterschied zwischen Kern- und Steinobst, die chemischen Reaktionen über die technische Umsetzung sowie zollrechtliche Vorgaben, bis hin zur Geschichte des Brennens erlernten.
Galt das Brennen ursprünglich nur als Resteverwertung für Fallobst, wird für den Edelbrand das Obst heute speziell für diesen Zweck angebaut – denn „ein guter Brand braucht gute Produkte.“ Im Fall von Eberhards Brennercrew ist das der sortenreine Apfel „Kaiser Wilhelm“. Dieser wird gewaschen, zerkleinert und schließlich mit Hefe angesetzt. Die Maische beginnt zu gären und nach einigen Wochen entsteht ein fünfprozentiger Alkohol. Die Flüssigkeit wird anschließend im Schnapsbrennkessel von unten erhitzt, verdampft und wird schließlich durch Herunterkühlen wieder in einen flüssigen Zustand versetzt. Durch mehrere Zwischenböden, an denen der Dampf jeweils kondensiert, kann Brand in einem Durchgang mehrfach destilliert werden. Am Ende erhält man dann ein 80-prozentiges Alkohol-Wasser-Gemisch. Für einen Liter davon braucht man im Schnitt etwa 20 Kilogramm Äpfel.
Das Gemisch, das jetzt aus dem Brennkessel läuft, setzt sich aus mehr als 400 Bestandteilen – „Die nicht alle besonders gut schmecken.“ – zusammen. Unterschieden wird in Vorlauf, Herzstück und Nachlauf. Der Vorlauf besteht aus den flüchtigen Bestandteilen, die zuerst beim Brennen aufsteigen und schmeckt nach Lösungsmittel. Der Nachlauf ist eher buttrig und „bleibt einem fast am Gaumen kleben.“ Das Herzstück ist – wie der Name schon verrät – das, um was es eigentlich geht. Die Aufgabe des Brenners ist es den richtigen Zeitpunkt zwischen Vor- und Nachlauf abzupassen, wenn das Aroma am besten zur Geltung kommt. Denn der Übergang ist fließend (wortwörtlich). Das funktioniert in erster Linie über die Sinne, also Geruch und Geschmack. Jeder Tropfen wird dabei aufgefangen, schnapsglas-große Proben davon in einem Aromarad Jede einzelne Phase hat Eberhard probiert: „Das ist ja die Aufgabe! Darin liegt die Herausforderung, das perfekte Aroma durch die Sinne einzufangen.“ Die kleinste Verunreinigung kann den Unterschied ausmachen. Anschließend wird das Ergebnis in Glasballons gefüllt und dem Ganzen etwas Ruhe gegönnt. „Dabei verändern sich Geschmack und Geruch nochmal“, erklärt Eberhard und ergänzt lachend: „Das Brennen ist auf der einen Seite ein handwerklicher und sensorischer Prozess, aber auch Alchemie und ein bisschen Zauber.“

Im Herbst 2016 war es dann so weit, die Vier der Brennercrew stellten sich der Herausforderung und setzten die Theorie praktisch um. Heraus kam ein Apfelbrand, „der nicht brennt. Wir waren sehr vorsichtig, darum ist er noch ein bisschen zahm.“ Nichtsdestotrotz wurde er mit einer Silbermedaille prämiert. Die ersten Flaschen des Edelbrandes sind auch schon fast alle so gut wie ausgetrunken oder verschenkt. Denn momentan haben die Vier den Luxus nur für den Eigenbedarf und für ausgewählte Freunde brennen zu können: „Es ist auch eine Kapazitätsfrage, schließlich haben wir alle noch einen Vollzeitjob.“ Wichtig ist ihnen eine hohe Qualität und so wenig Kompromisse wie möglich – ganz nach dem selbstgewählten Grundprinzip: „Immer Weniger von immer Besseren“.
Doch hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende: Denn anschließend qualifizierte sich Eberhard zum international zertifizierten Edelbrandsommelier. An sieben mal zwei Tagen eignete er sich in einem weiteren Seminar das Wissen über Geschichte, Herstellung sowie Verteilung verschiedenster Spirituosen und natürlich Edelbrände an. So zum Beispiel den Unterschied zwischen schottischem von den amerikanischen Whiskey. Am beliebtesten ist Whiskey übrigens in Indien. Auch dieses Wissen ist Teil der Ausbildung. Ebenso wie das intensive Training der sensorischen Fähigkeiten: Wie unterscheiden sich die verschiedenen Spirituosen in Aroma und Geschmack? An einem Vormittag wurden dabei schon mal bis zu 60 Produkte verköstigt. Teil der Abschlussprüfung war auch eine Blinddegustation. Drei Produkte mussten hier erkannt und beschrieben werden. „Es ist spannend sich der Welt über die Nase zu nähern.“ Ein idealer Ausgleich zur Arbeit, denn allein mit Zahlen, Daten, Fakten kommt man in diesem Metier nicht sehr weit.
Zu seinem 60. Geburtstag im nächsten Jahr hat sich Eberhard schon ein neues Projekt vorgenommen: einen eigenen Gin. Hier spielt die Mazeration eine entscheidende Rolle. Während Maischen einen Gärprozess braucht, werden beim Mazerieren Botanicals – also zum Beispiel Beeren, Fruchtschalen oder Kräuter – in hochprozentigen Alkohol „eingeweicht“, abgeleitet vom lateinischen „macerare“. Diese verleihen dem Gin schließlich den Geschmack. Grundsätzlich beinhält jeder Gin dieselben fünf Grundbestandteile. Alles darüber hinaus macht ihn einzigartig. Das ist zumindest das Ziel. „Mittlerweile gibt es bestimmt über 300 verschiedene Gins in Deutschland. Es ist die Kunst ein harmonisches Zusammenspiel hinzubekommen. Da ist Kreativität gefragt.“ Die meisten Hersteller setzen auf regionale Zutaten; es gibt sogar einen Gin, der Bodenseewasser enthält.
Das Schöne am Brennen ist, Fragt man Eberhard, die Wiederentdeckung eines klassischen, alten Handwerks in Verbindung mit neuen Ideen. Der Gin ist das beste Beispiel. „Man kann aus der ganzen Sache eine Geschichte machen. Das gehört auch zu den Aufgaben des Sommeliers: eine Geschichte zu erzählen und nicht nur dafür zu sorgen, dass es schmeckt.“ Dass er das kann, beweist er gleich an Ort und Stelle auf der Terrasse des Brigantinus. Gleich eine ganze Auswahl an winzigen Fläschchen mit Aromaproben hat er mitgebracht. Etwas kritisch vom Kellner beäugt, ist es durchaus spannend, wenn man „weich“ plötzlich riechen kann. Die verborgenen Seiten und das Wissen dazu mit anderen zu teilen macht Eberhard sichtlich Spaß. Auch seine Begeisterung ist ansteckend. Ein Genussbotschafter eben, denn „das Leben ist zu kurz für schlechte Produkte.“ Und mit einem Sommelier kommt immer gut ins Gespräch. Das ist hiermit bestätigt.
Serie in der Mitarbeiterzeitung der Stadt Konstanz.
0 notes
Text
Robinson und das gesellschaftliche Bedürfnis
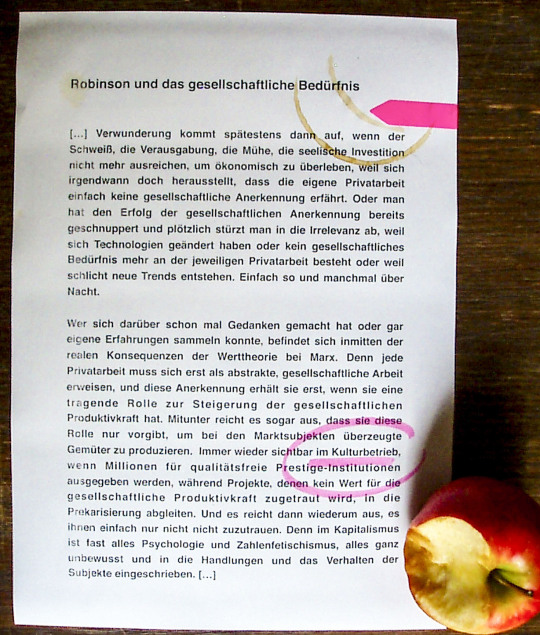
Es ist einsam geworden.
Zumindest für Marx und die, die ihn für heute noch für bedeutend halten. Außer flüchtigen Lippenbekenntnissen oder dem üblich wiederkehrenden und kurzfristigen Hype um ihn gibt es außerhalb der einschlägigen akademischen Szene kaum Zuspruch für eine zeitgenössische Lesart seiner Theorie.
Denn seine Kritik der politischen Ökonomie und ihrer methodischen Nutzung der Robinsonaden des 18. Jahrhunderts zur Analyse von Arbeit und Gesellschaft aus den Triebfedern jedes einzelnen Individuums scheint es heute schwerer zu haben denn je.
Die Annahme der klassischen ökonomischen Theorien, dass ein einzelner Produzent zur Befriedigung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses jederzeit auf der Platform der Zirkulationssphäre auftreten könne, und alle heißen einen begierig willkommen, spiegelt auf den ersten Blick tatsächlich das wider, was wir tagtäglich beobachten können und was auch irgendwie zu funktionieren scheint. Schließlich zeigen uns zahlreiche Beispiele, dass es niemals einfacher war, mit der Behauptung und Bereitstellung eines neuartigen Bedürfnisses, Begehrlichkeiten zu wecken, die das eigene Produkt oder eine Dienstleistung jederzeit zum Kassenschlager machen können.
Und nicht nur das.
Kaum eine Zeit hat uns deutlicher vorgeführt, wie schnell es sich mit oder wahlweise auch ohne Talent, dafür aber mit ordentlicher Penetranz zum Matador der lokalen Kulturszene oder gar zum Star der gesamten Republik aufsteigen lässt.
Die grundsätzliche Änderung gesellschaftlicher Arbeit in westlichen Industrieländern von der rationalisierten Fabrikarbeit hin zu innovativeren Formen innerhalb der Kreativwirtschaft scheint somit auf den ersten Blick dem klassischen Liberalismus völlig entgegenzukommen und Marx dagegen auf eine Theorie der industriellen Arbeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, resp. auf eine Theorie zum Verstehen gesellschaftlicher und politischer Konsequenzen in industrialisierten und verelendeten Schwellenländern zu reduzieren, in welche wir die hässlichen Seiten des Kapitalismus längst ausgelagert haben.
Deshalb scheint die Frage angebracht, wie das nun ist mit all den Robinsons: den Selfmade–People, den Gründern, Szenegastronomen und Clubbesitzern, den Handwerkskünstlern, Designern und Kreativen und all denen, die in Großstädten wie Pilze aus dem Boden sprießen, und auf die sich der zeitgenössische Konsument regelrecht stürzt, um ihnen ihre Waren aus den Händen zu reißen. Sind sie die wirklich wahr gewordenen Erfolgsversprechen klassischer Ökonomietheorien und hat sich Marx doch mit seiner Kritik am destruktiven Potential moderner Arbeits- und Produktionsverhältnisse erledigt?
* * *
Die Einsamkeit um Marx gründet in seiner Werttheorie, welche, grandios missverstanden, das Los alles Missverstandenen teilt: Es hat sich eine Meinung über sie verfestigt und die aus den Köpfen rauszubekommen, ist schwierig. Und so denken alle Angepassten, Erfolgsverwöhnten und die, die mit sich im Reinen sind, dass Marx in eine andere Zeit gehört oder zumindest in eine Welt, die uns nicht mehr betrifft.
Schließlich hat uns der Kapitalismus längst von seinen angenehmen Seiten überzeugt. Seine Unzulänglichkeiten lassen sich jederzeit hinfortkonsumieren. Kaufglück lässt uns alles vergessen. Es belohnt, entschädigt, zerstreut und berauscht. Unangenehmes wird plötzlich irrelevant. Und wenn es uns doch einmal unwohl wird beim Anblick unseres eigenen Wohlbefindens, dann leisten wir uns einfach Fairtrade-Produkte, und schon ist alles bereinigt. Unsere Einstellung zum Kapitalismus hat viel mit unserem persönlichen Wohlgefühl zu tun. Fühlen wir uns wohl, dann gibt es zumeist auch keinen Grund für Kritik.
Kommen wir allerdings doch mal in Verlegenheit, Stellung zu beziehen, um unser Bekenntnis zu untermauern, doch irgendwie auf der richtigen Seite zu stehen – man will ja schließlich nicht als das gelackte Arschloch gelten, das man ist –, dann sind wir oftmals, ohne es zu merken, inmitten der Marx’schen Theorie. Denn all die Unzulänglichkeiten des Kapitalismus spiegeln das wider, was Marx zwischen seinem Frühwerk, die »Entfremdete Arbeit«, und seinem Spätwerk, dem »Kapital«, längst analysiert hat: die Abstiegsgesellschaft (über die tendenzielle Verarmung durch die abhängige Lohnarbeit im Kapitalismus und aufgrund dessen hohlen Versprechen der vermeintlichen Partizipation an seinen Möglichkeiten), die menschenunwürdigen Hartz-Gesetze (über die Reduktion des Menschen auf seine tierischen Funktionen), das Verderben der Arbeitsverhältnisse (über die entfremdete Arbeit als Interesse- und Beziehungslosigkeit zu dem, womit man im Grunde genommen sein Leben verbringt), die Ausbeutung so genannter Arbeitssklaven (über die Einrichtung einer Reservearmee), die Verselbständigung des Geldes im Finanzsektor (durch die Analyse des Geldes als Ware, die vom Tausch zurückgehalten werden kann, zu Spar- und Spekulationszwecken) oder die prekarisierten Arbeitskraftunternehmer (über den Verkauf der Ware Arbeitskraft und die Möglichkeit ihrer extensiven Nutzung).
Selbst das Vokabular Marx’ verbirgt sich in unserem Sprachgebrauch: Aus der Reservearmee wird die Manövriermasse, aus Entfremdung werden die innere Kündigung und Machtlosigkeit gegenüber unserer Arbeitsexistenz; wir fühlen uns beherrscht von Systemen, wir sprechen von Arbeitsarmut und Prekarisierung, wir erfinden den Job des Arbeitskraftunternehmers, wir installieren moderne Tagelöhner und Arbeitssklaven und der Kapitalismus erscheint uns als etwas Natürliches und nicht historisch Entstandenes.
Und vieles davon zeigt wiederum die Werttheorie.
Marx tut uns natürlich nicht den Gefallen, sich über all die Schweinereien moralisch zu empören, sondern zeigt uns vielmehr, wie das System »Kapitalismus« funktioniert, und dass all die Schweinereien einfach dazugehören, um den Betrieb am Laufen zu halten. Darüber erklärt sich dann auch das inhärent destruktive Potential des Kapitalismus, denn die Aufrechterhaltung des Betriebs ist notwendigerweise bedingungslos.
Und so ist die Werttheorie die Grundlage zum differenzierten Verständnis von Arbeit und Produktion in kapitalistischen Gesellschaften. Und dass auch jenseits der Fabriken gearbeitet und produziert wird, scheint eine Binsenweisheit zu sein. Doch genau gesehen liegt darin das Problem, dass die Binse eigentlich gar keine Binse ist. Schließlich wird Marx nach wie vor auf eine Theorie der Fabrikarbeit reduziert, die der zeitgenössischen Geschmeidigkeit nichts mehr entgegenzusetzen habe – so zumindest aus Perspektive derjenigen, die sich mit den Möglichkeiten des Kapitalismus arrangiert haben und dessen destruktive Realität lieber der Verantwortung menschlicher Maßlosigkeit zurechnen.
Verwunderung kommt spätestens dann auf, wenn der Schweiß, die Verausgabung, die Mühe, die seelische Investition nicht mehr ausreichen, um ökonomisch zu überleben, weil sich irgendwann doch herausstellt, dass die eigene Privatarbeit einfach keine gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Oder man hat den Erfolg der gesellschaftlichen Anerkennung bereits geschnuppert und plötzlich stürzt man in die Irrelevanz ab, weil sich Technologien geändert haben oder kein gesellschaftliches Bedürfnis mehr an der jeweiligen Privatarbeit besteht oder weil schlicht neue Trends entstehen. Einfach so und manchmal über Nacht.
Wer sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat oder gar eigene Erfahrungen sammeln konnte, befindet sich inmitten der realen Konsequenzen der Werttheorie bei Marx. Denn jede Privatarbeit muss sich erst als abstrakte, gesellschaftliche Arbeit erweisen, und diese Anerkennung erhält sie erst, wenn sie eine tragende Rolle zur Steigerung gesellschaftlicher Produktivkraft hat. Mitunter reicht es sogar aus, dass sie diese Rolle nur vorgibt, um bei den Marktsubjekten überzeugte Gemüter zu produzieren. Immer wieder sichtbar im Kulturbetrieb, wenn Millionen für qualitätsfreie Prestige-Institutionen ausgegeben werden, während Projekte, denen kein Wert für die gesellschaftliche Produktivkraft zugetraut wird, in die Prekarisierung abgleiten. Und es reicht dann wiederum aus, es ihnen einfach nur nicht zuzutrauen. Denn im Kapitalismus ist fast alles Psychologie und Zahlenfetischismus, alles ganz unbewusst und in die Handlungen und das Verhalten der Subjekte eingeschrieben.
Nun kann man sagen, gut, dann mach ich eben etwas anderes, wenn das nicht klappt, schließlich ermöglicht mir der Liberalismus all dieses Freiheiten, doch man ist niemals der Robinson, der man zu sein glaubt, denn in jedem Betrieb hängen Arbeitsplätze, die bei gescheiterten Geschäftsideen auf der Strecke bleiben.
Und so ist die Werttheorie nicht einfach nur der Beweis, dass sich Arbeitsmengen in ein Produkt verausgaben, damit Wert stiften und gleichzeitig schon Gesellschaftlichkeit imitieren. Marx präzisiert nicht die Ricardo’sche Vorlage, wie viele ihm unterstellen.
Die Voraussetzung für Gesellschaftlichkeit ist zuallererst, dass die Verausgabung als gesellschaftlich notwendig anerkannt ist und nicht einfach nur ein gut gemeintes Vorhaben, das letztlich kein Schwein interessiert. Und dass diese gesellschaftliche Notwendigkeit eine riesige Hürde ist, nicht einfach nur eine strategische Entscheidung, sich mit einer Geschäftsidee in der Produktions- oder Zirkulationssphäre zu verabreden und alle heißen sich gegenseitig willkommen – wie es die politische Ökonomie zu meinen glaubt –, sondern eine Hürde von zahlreichen und schmerzhaften Störungen, all das zeigt die Werttheorie bei Marx.
Über seine Kritik an der politischen Ökonomie leistet Marx somit nicht nur die Analyse der Funktion des Kapitalismus und seiner Möglichkeiten, sondern zeigt – in Abgrenzung zur politischen Ökonomie – dessen grundsätzlichen Widersprüche sowie seine inhärenten und notwendigen Störungen. Störungen, die all das eben genannte verursachen.
Dagegen versuchen die klassischen ökonomischen Theorien, die bis heute nicht nur theoretischen Eingang in die Wirtschaftswissenschaften haben, sondern auch das Unterbewusstsein der Marktsubjekte besiedeln, den Kapitalismus in x-ter Gedanken–Generation gegen jegliche Realität als harmonisches, störungsfreies und rationales Zusammenspiel zwischen Bedürfnisbefriedigung, Nutzen und objektivem Reichtum für die Gesellschaft, Profit für den Geldbesitzer sowie adäquate Bezahlung für den Arbeitsaufwand des einzelnen Arbeiters darzustellen. Die realen Disharmonien, die Phänomene von Verelendung, die implizit notwendige und legitimierte Ausbeutung des Arbeiters sowie die regelmäßigen Krisen sind in klassischen ökonomischen Theorien, wie beispielsweise bei Adam Smith oder David Ricardo nicht enthalten.
Die Widersprüche des Kapitalismus bewegen sich bei Marx demnach zwischen der Ermöglichung eines objektiven gesellschaftlichen Reichtums und der realen Verarmung eines Großteils der Gesellschaft, zwischen der Behauptung, dass vertragliche Arbeit die Quelle von Reichtum für alle sei und deren reale Kehrseite der Lohn- und Wertarbeit, die Ausbeutung (als nicht-moralische Kategorie) über die unbezahlte Abschöpfung der Mehrarbeit legitimiert, und darüber hinaus auch noch den systemimmanenten Zwang produziert, sich an der allgemeinen Reichtumsproduktion über Arbeit zu beteiligen.
Tatsächlich – so Marx – bringt der Kapitalismus alle Selbstverständnisse der politischen Ökonomie, die ewigen Zusammenhänge und Naturannahmen zum Wanken, worüber erst seine implizite Krisenhaftigkeit verstanden werden kann: Kauf und Verkauf, Bedürfnis und Produktion, Gebrauchswert und Wert, Ware und Geld sowie Produktion und Zirkulation fallen vielmehr auseinander und verselbständigen sich jeweils.
Erstmals wird es historisch möglich, lediglich bedürfnissuggerierenden über bedürfnisunabhängigen, bis hin zu völlig funktionslosem Waren–Müll zu produzieren (nutzlose Staubfänger, unsinnige Geschenkartikel, Kartoffelsalat aus der Tube, schwedische Regale ohne Belastbarkeit), die Produktion nur um ihrer selbst willen aufrechtzuerhalten (VW produziert dann Curry-Würste statt Autos), den Arbeiter produktionsnotwendig über die Einrichtung einer menschlichen Manövriermasse verarmen zu lassen, und das Geld verselbstständigt sich zu einer eigenen Ware, die vom Tausch zurückgehalten werden kann, im Sparstrumpf oder zu Spekulationszwecken.
Störungen kommen – so Ingo Elbe – in klassischen ökonomischen Theorien nur als externe Zutat ins Spiel: entweder über den Staat, der in unnötiger Weise eingreift, oder durch einzelne Individuen, die über das rechte Maß hinaus Ansprüche stellen, (siehe Ingo Elbe: 2001). Insofern ist die typische und wenig originelle Kritik am »raffgierigen« Banker eine durch und durch bourgeoise Kapitalismuskritik.
Versteht man die Werttheorie von Marx somit lediglich als Weiterführung der klassischen Arbeitswerttheorie von David Ricardo, einer simplen Arbeitsmengentheorie, die den Wert einer Ware nach ihrer darin verausgabten Arbeitsmenge bemisst (die Menge der Verausgabung zur Herstellung eines Produktes), und lässt man sie darüber aus heutiger Sicht scheitern, so kann man nicht erklären, wie auch andere gesellschaftliche Arbeit, die keine dinglichen Fabrikwaren produziert, aber trotzdem aus kapitalistischer Sicht höchst produktiv ist, in die gesellschaftliche Gesamtproduktion eingeht.
Alle immaterielle Arbeit, in der sich Verausgabungsmengen nicht eindeutig zuordnen lassen, wäre dann auf einen Schlag irrelevant, weshalb nicht zuletzt auch Negri/Hardt die Werttheorie Marx’ daran scheitern ließen, dass immaterielle Arbeit immer wichtiger ist innerhalb der kapitalistischen Gesamtproduktion (siehe dazu auch Philipp Metzger).
Implizit geht man damit von der Annahme aus, dass der Kapitalismus bereinigt sei. Schäbig ist er nur noch in den Fabriken der Schwellenländer oder dann, wenn seine Akteure über die Stränge schlagen.
Nach dieser Vorstellung darf sich der zeitgenössische Networker lässig zurücklehnen. Sein Arsenal aus Laptop und Smartphone, hergestellt in asiatischen Fabriken zu Centlöhnen, kann er in chicen Cafés einsetzen, während er seine Biolimonade schlürft und mit »like« und »tweet« die immer richtigen Bekenntnisse zu einem vermeintlich neuen Kapitalismus bekundet. All seine Handlungen sind dann umgehend bereinigt: »Alles super, wenn man’s nur richtig macht.«
Explizit unterstellt man Marx damit die Übernahme des Substanzbegriffes aus der politischen Ökonomie, der Verausgabungsgrößen als messbar und Wert als materiell Greifbares versteht oder als etwas, das sich nach dem Einsatz entsprechender Mühe ernten lasse: »Schaff was, dann wird was aus dir!« oder noch einfacher: »Gold ist wertvoll, weil’s glänzt. Und krisenfest ist es noch dazu.« Jede produzierende Arbeit schaffe darüber hinaus unmittelbar Wert.
Immaterielle Arbeit dagegen sei emanzipatorisch, auch deshalb, weil sie sich über ihre kommunikative Form des Austausches mit anderen immateriellen Arbeitern und Arbeiterinnen der im Kapitalismus zählenden Messbarkeit von Arbeitsentäußerungen entziehe. Es geht jetzt – so die Vorstellung – herrschaftsfreier, gleichberechtigter und diskursorientierter zu; eine Vorstellung, die die Postoperaisten auch zur Annahme geführt hat, dass in Technologien, wie der weltweiten Vernetzung, schon Formen eines potentiellen Kommunismus enthalten seien; die Entstehung einer Multitude und deren Schaffung eines General Intellects, unter Berufung auf Marx’ »allgemeines gesellschaftliches Wissen« (MEW 42, 602), seien die maßgeblichen Anzeichen dafür (siehe dazu auch Philipp Metzger).
Aus heutiger Sicht eine naive Vorstellung, nachdem man weiß, dass das Internet und seine Vernetzungsdienste längst zum weltweiten Stammtisch verkommen sind, den die Gegner von Emanzipation und Aufklärung besser zu nutzen wissen, als uns lieb sein kann. Nicht zuletzt auch in der Informationskriegsführung durch so genannte Bots und Fake-News. Und eine wirklich absurde Interpretation der Werttheorie noch dazu, denn sie zeigt, welche Arbeitsformen damit analytisch irrelevant seien: Der komplette Dienstleistungssektor, das Gesundheitswesen sowie sämtliche Kopfarbeit, die die Grundlage für technologische Neuerungen und Entwicklungen und den Fortschritt von Gesellschaften bildet, fallen somit aus der Wertanalyse heraus. Auch der Banken- und Finanzsektor und dessen Potential zur Krise spiele dann keine Rolle. Und man stelle sich zudem vor, welche konkreten Arbeiten ebenfalls immateriell sind und damit wiederum emanzipatorisch seien: Sexarbeit, Hausarbeit, Pflegearbeit oder alle Formen von Dienstleistung.
Genauso wenig ließe sich damit die grundlegende Änderung gesellschaftlicher Arbeit analysieren, nämlich die durch die Agenda 2010 eingeführte prekäre Selbstständigkeit über die Erfindung so genannter »Arbeitskraftunternehmer«. Diese Änderung hat aber erst dazu geführt, dass eine neue Form von Arbeitsarmut entstand; die eigenverantwortliche Armut, die lediglich die Arbeitslosenzahlen beschönigen konnte und die Folgen des neoliberalen Kapitalismus für gesellschaftliche Arbeit insgesamt auf das Individuum abwälzte.
Insofern müsse man Marx heutzutage tatsächlich als erledigt ansehen und er spiele nur noch eine Rolle, wenn es um die nach wie vor relevante Fabrikarbeit und deren produktionsinhärente, legitime Ausbeutung (Mehrwertabschöpfung) menschlicher Arbeitskraft geht. Bestenfalls lasse sich seine Theorie noch so anwenden, dass sie in heutige Überlegungen zum Leid tierischer Produktionsarbeit und zur extensiven Nutzung natürlicher Ressourcen einfließen könne.
Lässt man die Marx’sche Werttheorie an der unter Volkswirtschaftlern heute immer noch relevanten Grenznutzentheorie scheitern, so verkenne man die Bedeutung gesellschaftlicher Arbeit insgesamt für die Stabilität von Gesellschaften sowie den realen Zynismus dieser Theorie, die nicht nur Wert und Preis gleichsetzt, sondern auch die Höhe des Preises über den realen Nutzen einer Ware bestimmt.
Die Grenznutzentheorie aus dem 19. Jahrhundert, auch subjektive Werttheorie genannt, bemisst den Nutzen genau jener Waren als besonders hoch und ihren Handel damit als entsprechend gewinnbringend, die von besonders vielen Menschen dringend gebraucht werden. Dabei nimmt der Nutzen kongruent mit der Befriedigung eines Bedürfnisses ab und lässt den Preis ebenfalls kongruent dazu fallen, bis zum völligen Verlust seiner Marktchance, dem Moment, wo der Markt gesättigt ist und die Bereitschaft für ein Produkt zu zahlen gegen Null geht.
Der Zynismus dieser Theorie entsteht durch das, was sie implizit bedeutet, denn die Grenznutzentheorie vertritt nichts anderes als die Perspektive derjenigen, die sich auf ungestillte Bedürfnisse stürzen und im Idealfall diese Bedürfnisse niemals sättigen, denn andernfalls berauben sie sich ja ihrer eigenen Einnahme- und Profitquelle (siehe dazu auch Pfreundschuh).
Ein beliebtes Beispiel, das diesen Zynismus aufdeckt, ist das Bedürfnis nach Nahrungsmitteln: Bei besonders großem Hunger und Durst erweisen sich das erste Stück Brot und das erste Glas Wasser als besonders hoher Nutzen, der mit stetigem Stillen von Hunger und Durst abnimmt. Kongruent dazu fällt die Bereitschaft, einen hohen Preis für Brot und Wasser zu bezahlen.
Wie bei allem positivistischen Theoriemüll lesen sich die wirklichen Schweinereien erst zwischen den Zeilen, denn das Interesse derer, die über Brot und Wasser verfügen, kann ja nur darin bestehen, Hunger und Durst konstant hoch zu halten oder zumindest dafür zu sorgen, dass Hungernde und Dürstende niemals ausgehen.
Als Nachfolgerin der einfachen Nutzentheorie ignoriert sie den von Adam Smith aufgedeckten Widerspruch ihrer Vorgängerin, dass eine Ware, die von besonders hohem Nutzen ist – beispielsweise Wasser – billiger ist als eine Ware, die von gänzlich geringem Nutzen ist – beispielsweise Diamanten oder Gold –, (siehe Smith: 27) indem sie nicht den Wert eines Produktes, sondern die Zahl der Bedürfenden in die Preisregulierung einrechnet.
Eine Ware wird dann umso teurer, je höher ihr realer Nutzen und je größer die Anzahl derer ist, die Bedürfnisse haben, zu deren Befriedigung sich diese Ware als besonders nützlich erweist. Der Preis dafür kann jetzt ins Unermeßliche steigen, denn er bemisst sich nicht mehr über die darin verausgabte gesellschaftlich notwendige Arbeit (wie in der Arbeitswerttheorie), sondern kann vom Produzenten oder Warenbesitzer nach Gutdünken festgelegt werden. Das Ausmaß dieses Gutdünkens regelt allein die Dringlichkeit zur Befriedigung dieses Bedürfnisses und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Je höher die Nachfrage, desto höher der Nutzen, desto höher sein Preis.
Theoretisch geht aber noch mehr. Wenn der Nutzen einer Ware bis aufs Letzte, bis zu seiner Grenze erschöpft ist, ist ein Bedürfnis gestillt und der Markt gesättigt. Jetzt zeigt sich die gedankliche Verselbständigung dieser Theorie erst recht, denn um nun weiteren Profit zu machen, muss zwangsläufig zum nächsten Desiderat einer Gesellschaft oder auf dem Markt weitergegangen werden, weshalb diese Theorie sich implizit auch nicht weiter darum zu kümmern hat, was nach dem Erschöpfen eines Nutzens mit der jeweiligen Ware, ihrer Produktion oder der Spekulation mit ihr passiert. Es bedarf also rein gar keiner Produktionsethik mehr; vielmehr lassen sich die Trümmer des ausgeschöpften Nutzens jederzeit problemlos hinterlassen, was sich anschaulich an spekulationsbedingten Hungersnöten, zerstörten Binnenmärkten und Volkswirtschaften, etc. feststellen lässt.
Irgendjemand kommt dann schon, um aufzuräumen – oder auch nicht.
Der Zynismus ergibt sich aber auch dadurch, dass die Befriedigung von Bedürfnissen, wie Wohnraum in Großstädten oder Lebensmittel in Gesellschaften mit großer Verknappung, von besonders hohem Nutzen ist und insofern die Preise kongruent dazu – bis ins Absurde – steigen können.
Aber auch der Begriff des Bedürfnisses selbst erhält hier eine zynische Umkehr, denn tatsächlich geht es gar nicht um eine Bedürfnisbefriedigung, sondern um das Ausnutzen eines gesellschaftlichen Elementarbedürfnisses, das nutzennützlich aufrechterhalten wird. Je mehr Menschen etwas bedürfen, umso nützlicher die Ware zur Befriedigung des Bedürfnisses, umso höher ihr Preis.
In unserem oben genannten Beispiel aus der Befriedigung von Hunger und Durst ist – so die reale Konsequenz aus dieser Theorie – nur für eine hungernde und dürstende Gesellschaft der Nutzen der Waren Brot und Wasser als besonders hoch zu bewerten, womit der subjektive Preis dafür vom Verkäufer dieser Waren entsprechend hoch bemessen werden kann. Eine Gesellschaft wiederum, in der Überproduktion herrscht, darf sich über günstige Fleischlappen, Butterberge und Milchbäder freuen. Die Leidtragenden dagegen sind die Arbeiter und Nutztiere; denn bei zunehmender Sättigung fallen nicht nur die Preise, sondern im Normalfall auch die Bereitschaft zur Investition in beispielsweise verbesserte Produktionsbedingungen.
Hat jeder erst mal seinen Fleischlappen auf dem Mittagstisch, kann das Schwein getrost im Stall verrecken und die Leiharbeiter noch mehr in die legitime Arbeitssklaverei gedrängt werden. Wen interessieren schon Arbeitsverhältnisse, wen interessiert schon Tierschutz?
Mietwucher, Lebensmittelpreis–Spekulationen und die Privatisierung von Wasser – anything goes, da daraus besonders viel Gewinn für den einzelnen Warenbesitzer gezogen werden kann. Die Grenznutzentheorie wird so zur theoretischen Legitimation der realen Perversion des neoliberalen Kapitalismus und seiner schier absurden Möglichkeiten (siehe Pfreundschuh). Sie versteht sich nicht als Theorie kapitalistischer Produktion und Zirkulation und deren selbstbehaupteten Anspruchs eines Gesamtnutzens für die Gesellschaft, sondern rechtfertigt lediglich das Interesse des einzelnen Geldbesitzers. Sie wendet sich gegen die Arbeitswerttheorie, indem sie rechtfertigen kann, warum Preise von besonders nützlichen Waren geradezu übertrieben über ihren eigentlichen Produktionskosten liegen können.
Und nicht nur das. Für ihre eigene Theoriebildung braucht sie weder gesellschaftliche Arbeit und ihre Bedeutung für den Menschen noch einen Begriff von Gesellschaft überhaupt, und sie zeigt damit einmal mehr, worum es hier überhaupt geht, nämlich einzig und allein um die neoliberale Rechtfertigung des willkürlichen Umgangs mit gesellschaftlicher Arbeit, dem einzelnen Arbeiter, seiner Bezahlung, seiner Kündigung sowie die willkürliche Definition von produktionsimmanent notwendiger oder nicht-notwendiger Arbeit.
Der Umgang mit Arbeit entlarvt sich in diesem Modell aber auch anderweitig: Denn auch die Investitionen in Bildung werden hier direkt ökonomisch bewertet (siehe dazu auch Gess: 2005). Der gesamte Bologna–Prozess und die Bachelorisierung des Universitätsstudiums fügen sich reibungslos in dieses Modell ein: Sie hinterlassen den zugerichteten, affirmativen Uniabsolventen, der fleißig Klassifikationen auswendig gelernt hat und darin gedanklich und intellektuell steckenbleibt. Damit trägt er genau die kritik- und störungsfreie Arbeitnehmermaske, die sich ein Neoliberaler nur wünschen kann.
Beide Theorien können somit mit der Marx’schen Werttheorie im Folgenden kritisiert werden, indem nochmals klargestellt wird, dass der Wert bei Marx ein gesellschaftliches Verhältnis beschreibt, das darüber entscheidet, ob und warum eine Privatarbeit überhaupt erst zu gesellschaftlicher Arbeit wird und warum der Kapitalismus reihenweise gegen seine eigenen Versprechen verstößt. Und vor allem, wie es in den Köpfen der Marktsubjekte zugeht, ohne, dass sie es selbst durchschauen.
Die Marx’sche Werttheorie – und das ist alles entscheidend – ist keine Arbeitswert- oder Arbeitsmengentheorie. Ebenfalls ist Marx kein Ökonom, sondern ein Kritiker klassischer Ökonomietheorien, der die Funktion des Kapitalismus und dessen zwangsläufige Grenzen zu analysieren versucht (siehe Heinrich 2005: 31; sowie 2001).
Die Marx’sche Werttheorie ist ein Modell der analytischen Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, indem sie zeigen kann, dass die kapitalistische Produktion eine Reihe von Verselbständigungen entfesselt, die dem rationalen Handlungsrahmen der Subjekte zwangsläufig entgleiten; sie tilgt alle natürlichen Beziehungen, die in der klassischen politischen Ökonomie vorausgesetzt werden; darüber hinaus erklärt sie erstmals überhaupt, was gesellschaftliche Arbeit ist, und zwar sowohl aus kapitalistischer als auch aus post-kapitalistischer Sicht, indem sie zeigt, dass diese über das schlichte Produktionsverhältnis zwischen Arbeiter und Geldbesitzer und dem Zirkulationsverhältnis zwischen verschiedenen Privatarbeiten weit hinausgeht.
Entscheidend ist darüber hinaus, dass der Kapitalismus nicht als moralisches Versagen kritisiert wird, sondern seine inhärenten Widersprüchen aufgezeigt und verstanden werden sollen, eine Produktionsweise, die nach heutiger Sicht endlich ist, denn die Möglichkeiten und Ressourcen sind zwangsläufig irgendwann erschöpft.
Marx selbst spricht im »Kapital« nicht von einer produktionsimmanenten Selbstzerstörung des Kapitalismus, da ihm dazu das politisierte Proletariat als historisches Subjekt methodisch und – zumindest zu seiner Zeit – auch real zu Hilfe kommt. Bekanntlich hat es dieses nur bis zum Sozialismus als reale Kopie des Kapitalismus geschafft hat, mit dem Unterschied, dass jetzt die Bestimmung des Arbeiters auf alle ausgedehnt ist, wie Marx selbst kritisch einwendet (MEW 40: 534). Sein geschichtsphilosophisches Konzept der freien Gesellschaft, in der ausschließlich bedürfnisbefriedigende Produktion stattfindet, das, was Marx als »Kommunismus« bezeichnet, hat mit dem realen Kommunismus – nur so am Rande – nicht das Geringste zu tun. Insofern wurde Marx von verschiedenen Produktions- und Gesellschaftsentwürfen eindeutig missbraucht und instrumentalisiert und mitnichten verstanden. All das kann hier aber nicht weiter verfolgt werden.
Auf das Proletariat ist ja bekanntlich kein Verlass mehr, wenn es um den Übergang in die freie Gesellschaft geht. Dieses hat sich längst als Bestandteil der AFD–Wählerschaft enttarnt, um sein eigenes Elend auf Geflüchtete zu projizieren oder es mischt sich unter die neuerdings beliebten Querfronten, die Kapitalismus mit dem Einfluss irgendwelcher »raffender« und nicht-greifbarer Finanzgruppen gleichzusetzen versucht – dem Ursprung der typisch antisemitischen Kapitalismuskritik.
Über die Analyse und Kritik der klassischen Werttheorie kann Marx nun zeigen, dass die freie Vertragsarbeit tatsächlich nur als Verkauf ihres Gebrauchswertes, als Verkauf der Ware Arbeitskraft, das Prinzip des objektiven Reichtums moderner Gesellschaften ist und damit als grundlegender Stabilisator unmittelbar ausscheidet, da realiter mit ihr Armut und Verelendung erzeugt werden.
Scheitert jedoch die freie Vertragsarbeit an ihren eigenen Prinzipien, ihren Versprechen, auch dem einzelnen Arbeiter die Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Reichtum und seinen Möglichkeiten zu öffnen (Bildung, politische Teilhabe, individuelle und politische Freiheit, Selbstverwirklichung), dann scheitert die Gesellschaft als Ganzes.
Genau das aber ist es, was wird derzeit über die so genannte »Abstiegsgesellschaft« erleben. Insofern ist Marx einer der zeitgenössischsten Theoretiker, der uns heute mehr denn je zeigen kann, wohin eine Gesellschaft abdriften kann, die die Prinzipien ihrer eigenen Produktion nicht versteht.
Im Folgenden werden wir nun sehen, dass die Marx’sche Werttheorie die klassische Arbeitswerttheorie tilgt, denn diese scheitert insgesamt an ihrem Verständnis von gesellschaftlicher Arbeit. Arbeit ist hier allein gesellschaftlich, weil sie Wert stiftet. Es genügt die nötige Verausgabungsmenge zur Produktion einer Ware, um ihren Wert zu bestimmen. Arbeit wird damit selbst unmittelbar wertgebend, ohne die entscheidende Vorbedingung, dass sie erst einmal gesellschaftlich anerkannt sein muss. Denn wie soll es jetzt zur kapitalistischen Realität kommen, dass es auch produktionsinhärent nicht-notwendige Arbeit gibt? Wie wird Privatarbeit überhaupt gesellschaftlich? Und wie kann erklärt werden, warum eine gesellschaftliche Arbeit urplötzlich wieder in die Privatarbeit abstürzen kann?
Darüber hinaus regelt sich in der Arbeitswerttheorie die Produktion über Angebot und Nachfrage zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Es bleibt jedoch unklar, wie Bedürfnisse überhaupt entstehen und vor allem, wie und warum sie wieder verschwinden. Die Arbeitswerttheorie verkennt darüber hinaus die Bedeutung des Unterschiedes zwischen Arbeit und Arbeitskraft und kann deshalb ebenso wenig verstehen, warum der Arbeiter trotz Arbeit verarmt. Nicht allein ein niedriger Lohn – wie politische Ökonomen bereits warnen – sondern erst der extensive und effiziente Gebrauch seiner Arbeitskraft lässt den empörten und sich politisierenden Arbeiter entstehen. Denn jetzt erst passiert Entscheidendes: Die notwendige Steigerung der Produktivkräfte wirkt unmittelbar auf die Arbeitskraft selbst ein. Ihre Brauchbarkeit kongruiert mit der realen Qualität des Selbsterhalts der Produktion, die mal einfach so, mal von Krisen gebeutelt, mal einfach nur die Krise als Vorstellung im Kopf habend (denn im Kapitalismus ist fast alles Psychologie), Arbeit bedarfsabhängig abrufbar macht. Sie wird nun austauschbar durch die Errichtung einer Reservearmee, auf die der Arbeitgeber nach Bedarf zurückgreifen kann, und die wiederum allein durch ihre Existenz auf die Verschärfung der Arbeitsverhältnisse einwirkt. Es geht hier also nicht nur ums Geld, um eine vermeintlich gerechte Bezahlung – der typische Lösungsansatz einer Sozialdemokratie –, es geht darum, dass der Kapitalismus ein durch und durch menschenverachtendes System ist. Und dieses System verachtet ebenso die Tiere und die Umwelt.
Darüber hinaus fehlt in der Arbeitsmengentheorie die Analyse der Geldform als sich verselbständigende Ware. Geld ist hier einfach eine externe Zutat, ein Zahlungsmittel. Wie aber kann sich Geld verselbständigen und dadurch Krisen auslösen?
Empörte oder sich politisierende Arbeiter sowie sich verselbständigendes Geld sind aber die bedeutenden Störungen im Kapitalismus, deren Entstehung erstmals Marx analysiert.
Die Marx’sche Werttheorie tilgt aus heutiger Sicht die Grenznutzentheorie (subjektive Werttheorie), da diese einen völlig depravierten Begriff von Arbeit und Gesellschaft hat (Marx selbst hat sich mit dieser Theorie nicht befasst. Sie soll deshalb nur mithilfe seiner Analyse kritisiert werden). Sie setzt Wert und Preis über die Existenz besonders dringender Bedürfnisse gleich und zieht damit ihren Profit aus der realen Verknappung zur Steigerung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses. Sie zeigt, was realiter passiert, wenn Geld als externe Größe nur zum Zwecke der Spekulation und somit investitionshemmend eingesetzt wird, ein Umstand, den Marx bereits über die Kritik der krisenfreien Arbeitsmengentheorie aufgezeigt hat:
Erst »[d]urch das Auseinanderfallen des Produktionsprozesses (unmittelbaren) und Zirkulationsprozesses ist wieder und weiter entwickelt die Möglichkeit der Krise, die sich bei der bloßen Metamorphose der Ware (Verkauf und Kauf) zeigte. Sobald sie nicht flüssig ineinander übergehen, sondern sich gegenseitig verselbständigen, ist die Krise da« (MEW 26.2, 508).
Das beweist aber auch, dass die Zirkulation und Spekulation im Finanzsektor mit der Produktionssphäre notwendiger Weise verwoben sind; wie sonst auch sollten Investitionen oder Kredite möglich sein, wenn der Finanzsektor ein völlig unabhängiges System wäre? Ihre Unabhängigkeit ist dagegen ein bis heute währendes Konstrukt, sichtbar auch darin, dass Banken günstige Zinssätze bei der Kreditvergabe nicht an Unternehmen weitergeben, weil sie sich völlig unabhängig von der Produktion wähnen, und mit diesem Selbstverständnis entsprechend viel auch angerichtet haben.
Das Prinzip »gesellschaftliche Arbeit« als Grundlage kapitalistischer Produktion sowie die These, dass der Kapitalismus den Reichtum der Gesellschaft und nicht nur einzelner Geldbesitzer vermehre, aber auch Grundlage gesellschaftlicher Stabilität und Freiheit sei – so der Anspruch klassischer Ökonomietheorien – wird in der Grenznutzentheorie gänzlich getilgt.
Sie bedient sich an den Ermöglichungen durch gesellschaftliche Arbeit, lässt sie jedoch in ihrer eigenen Theoriebildung weitestgehend unberücksichtigt.
Sie bildet demnach den realen Zynismus der letzten Jahre ab: Die ungebremste Spekulation und den Ruin ganzer Volkswirtschaften als Glanzleistung des Finanz- und Bankensektors, und den Hilferuf nach gesellschaftlicher und politischer Unterstützung, wenn das ganze schief läuft; das Erwarten der Hilfe von genau denjenigen, die am Entstehen des gesellschaftlichen Reichtums mit beteiligt waren. Als Entschuldigung für das eigene Versagen und quasi als Notausgang – so Hans-Peter Büttner – lässt sich mithilfe dieser Theorie der Schaden rückwirkend als zumindest nutzenmaximierend erklären (siehe Büttner: 6)
Aber selbst die Kritik daran bildet mithilfe der Marx’schen Analyse aus heutiger Sicht keine moralische Kategorie, keine Kritik als Empörung, oder die immer wieder mühsame Gegenüberstellung von so genanntem »schaffenden und raffenden Kapital«, sondern zeigt letztlich nur, wozu der Kapitalismus implizit und explizit in der Lage ist. Diese Theorie bildet nichts anders ab, als die realen Möglichkeiten unserer Produktionsverhältnisse. Sie ist nichts anderes als das Buch zum Film.
Die Grenznutzentheorie ist zur Arbeitsmengentheorie vergleichbar ahistorisch. Im Gegensatz zum Rückgriff auf die menschliche Natur und deren Vollendung in der kapitalistischen Gesellschaft, interessiert die Grenznutzentheorie vielmehr ausschließlich der Moment des graduellen Bedürfnisses. Alle gesellschaftlichen Beziehungen sind dagegen getilgt zugunsten einer ökonomischen Entscheidungstheorie des einzelnen Geldbesitzers (siehe dazu Büttner: 4).
Mit dem Verstehen von Gesellschaft und gesellschaftlicher Arbeit hat sie somit rein gar nichts zu tun, und sie interessiert uns deshalb im Folgenden nur noch am Rande.
* * *
Um die Bedeutung der Marx’schen Werttheorie für heute zu verstehen, hilft ein Blick zurück zu Marx selbst und seiner Kritik an den Robinsonaden, die sämtliche historischen Entwicklungen unterschlagen und stattdessen natürliche Veranlagungen des Menschen als Grundlage von Arbeit, Tausch und Markt verstehen. Die reibungslose Funktion all dieser Sphären erfolgt unmittelbar im Tauschhandeln und unter der sanften Lenkung einer unsichtbaren Hand (Adam Smith), der Geburt der politischen Ökonomie, welche die persönlichen Interessen des Individuums mit seinen menschlichen Veranlagungen harmonisch zu verschmelzen versucht. Die Verbindung von politischer und ökonomischer Sphäre, von Staat und Individuum, erfolgt über das vermeintlich sanfte Verwalten dieses Prozesses (siehe dazu Foucault: 2006).
Was die Vertragstheorien des 16. bis 18. Jahrhunderts bereits untersuchen, bringt Kants Formulierung der »ungeselligen Geselligkeit« (Kant: 37) beispielhaft auf einen Nenner: Der Mensch kann einfach nicht anders, als sich zu vergesellschaften, wenn er sich vereinzeln und isolieren will (ebd. 38). Und das spezifisch Menschliche liegt gerade in diesem Hang zur Isolation, worin implizit erste Ansätze moderner Selbstverwirklichungstheorien enthalten sind. Möglich ist die selbstgewählte Isolation ausschließlich in einer Gesellschaftsform, die die nötigen Rahmenbedingungen dafür schafft.
Die Eingangsvoraussetzungen für die Vergesellschaftung des Menschen werden in den Vertragstheorien und politischen Ökonomien sehr unterschiedlich bewertet. Denn die Frage, wie die menschliche Natur als Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft zu sehen sei, ob günstig (wie bei Rousseau) oder ungünstig (wie bei Hobbes), und wie man sie beflügelt oder zähmt, bilden das Fundament kontraktualistischer Theorien und deren Überlegung zu einer jeweils entsprechenden Regierungsform als wahlweise starker Staat (bei Hobbes) oder dem Vertrauen in die Demokratie (bei Rousseau).
Die Robinsonaden der politischen Ökonomie unterstellen dagegen zur methodischen Rechtfertigung ihrer eigenen Theorien notwendigerweise günstige – doch letztlich egoistische – menschliche Veranlagungen, die in der ökonomischen Sphäre zum Zwecke eines allgemeinen Nutzens harmonisiert werden, ohne paternalistische Eingriffe des Staates oder einer anderen (beispielsweise ideologischen) Instanz, weil die Menschen erkennen, dass das gemeinsame Interesse ihrer persönlichen Interessenbefriedigung bereits von gesellschaftsstiftender Kraft ist. Durch diese Annahme rechtfertigt man nicht nur die ökonomische Sphäre als grundsätzlich der menschlichen Natur zuträglich; man hält sich damit gleichzeitig den Staat als leidigen Bevormunder vom Hals.
Jeder ist sich selbst der Nächste und muss deshalb irgendwie mit dem anderen auskommen und sich mit ihm arrangieren, damit dieser ihm wiederum nicht in die Quere kommt. Und davon wiederum profitieren alle. So die Weisheit dieser Theorien. Denn »[n]icht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.« (Smith: 17)
Dass das Ganze nur funktioniert, wenn auch alle die Möglichkeit dazu haben, ihre eigenen Interessen und Vorteile zu verfolgen, und keiner sich dabei zu kurz gekommen fühlt oder gar armutsbedingt oder aufgrund mangelnder Bildung ausgeschlossen ist, liegt auf der Hand, weshalb Hegel einer der ersten ist, der in seiner Rechtsphilosophie von 1820 über die Gefahren der strukturellen und verrohenden Armut in der bürgerlichen Gesellschaft schreibt, nämlich die Entstehung des so genannten »Pöbels« (siehe Hegel: 1986, § 244), der empörten Armen, die keinerlei Zugang mehr zu Arbeit haben, oder trotz Arbeit verarmen. Insofern bilden sie den pejorativen Gegenpol des Marx’schen Proletariats, das stets selbst an der dünnen Grenze zwischen politischem Protest und sozialer Empörung steht, eine Grenze, die man heute zwischen politischer Revolte und Ressentiment ziehen würde.
Doch der Ökonom wäre kein Ökonom, wenn er nicht auch hier argumentativ vorgesorgt hätte, um das Interesse seiner Theorie zu verteidigen. Schließlich kommt ihm seine stärkste Waffe zur Hilfe: die menschliche Natur und ihre »Neigung zum Tausch« (Smith: 17) Und die hat nunmal auch der Bettler – denkt zumindest der Ökonom: »Auch ein Bettler deckt seinen gelegentlichen Bedarf überwiegend wie alle anderen Menschen, nämlich durch Verhandeln, Tausch und Kauf. Mit dem erbettelten Geld kauft er sich etwas zum Essen, geschenkte, alte Kleider tauscht er gegen andere, die ihm besser passen, gegen eine Unterkunft, Essen oder Geld, mit dem er wiederum Lebensmittel, Kleidung oder eine Schlafstätte, je nach Bedarf, kaufen kann.« (Smith: 17)
An der Stelle stelle ich mir vor, wie ein Studierender der Wirtschaftswissenschaften im Seminar sitzt, diesen Schwachsinn liest und auch noch glaubt. Denn Adam Smith ist tatsächlich heute noch der heiße Scheiß unter Wirtschaftswissenschaftlern. Unweigerlich kommt dem Seminarteilnehmer doch in den Sinn, dass Hartz-IV–Sätze ausreichen, um zu essen, zu schlafen oder gebrauchte Klamotten zu erwerben. Niemals alles auf einmal, sondern gut danach abgewägt, was gerade am Dringlichsten ansteht. Was braucht der Mensch schon mehr, als zur unmittelbaren Bedarfsdeckung seiner »tierischen Funktionen« (MEW 40, 514).
Und auch die Politik zieht nach. »Lasst uns das Flaschenpfand erhöhen. Dann kommen die Armen auch garantiert über die Runden.« (Kein Witz. Diesen Vorschlag gab es tatsächlich aus der CDU).
So einfach kann man es sich machen.
An der Stelle kommt mir noch mehr in den Sinn. Meine Nachbarin äußerte sich neulich über einen Obdachlosen, der sie auf der Zeil angeschnorrt hatte, folgendermaßen: »Also, wenn dem nur jeder Hundertste fünfzig Cent gibt . . . Da kommt der – bei statistisch gesehen vierzehntausend Menschen pro Stunde auf der Zeil – auf ein Vermögen! Und das steuerfrei. Du, also da werd’ ich auch Bettler.«
Ein Beweis der Arbeitswerttheorie im Kopf der Bourgeoisie. Und wenn er ganz pfiffig ist, bekommt er sogar einen Euro von jedem hundertsten Passanten, denn Gewinnmaximierung liegt doch auch irgendwie in seiner Natur, oder?
Doch zurück zu Smith. Dass das Interessenband auch so, unabhängig von der Entstehung von Armut, dünn sein kann und jederzeit im Begriff ist zu reißen, bringen bereits lange vor Hegel verschiedene Konzepte der Moralphilosophie zum Ausdruck, nicht zuletzt auch von Adam Smith selbst, der im Anschluss zu »Wealth of Nations« die »Theory of Moral Sentiments« schreibt.
Kapitalismus scheint also doch eine Moral zu brauchen, die seine schlechten Seiten zügelt. Doch geht das überhaupt?
Die Robinsonaden (so bei Smith beispielsweise) unterstellen einen zeitlichen Urzustand und halten das Individuum in der Blase seiner eigenen Natur (Schaffen und Tauschen) gefangen, die es in der Produktions- und Zirkulationssphäre erst zur ihrer eigentlichen Vollendung bringt. Der Kapitalismus ist demzufolge nichts anderes, als die objektivierte Vollendung menschlicher Natur. Die Individuen handeln und verhalten sich in der ökonomischen Sphäre zum Zweck gemeinsamer Interessenwahrung ausschließlich so, dass eine vernünftige und harmonische Ordnung entsteht. Weshalb viele heute immer noch denken – inklusive unseres ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck –, dass nur der Kapitalismus Freiheit und Demokratie mit sich bringt.
Dieser methodische Individualismus erklärt somit einen vermeintlichen Naturzustand zum methodischen Ausgangspunkt und macht dadurch die ökonomische Sphäre zum Ort strategischer Handlungen und der Verwirklichung natürlicher menschlicher Interessen. Kein Wunder, dass es aus diesem Gedankenmodell keinen Ausweg gibt, wenn es überall nur natürlich zugeht.
Sämtliche Produktionsinstrumente, angehäufte Arbeit und Kapital als objektivierte Arbeit, alle historischen Entstehungen und Objektivierungsprozesse, auch die ursprüngliche Akkumulation (MEW 23, 741), über die sich – kriegs- und eroberungsbedingt – frucht- und schröpfbare Ländereien angeeignet wurden, sind hier zugunsten eines ewigen Naturverhältnisses getilgt (siehe MEW 13, 617). Ihre gesellschaftliche Vermittlung erfolgt lediglich über das richtige und vernünftige Zusammenspiel der Individuen.
Marx schreibt dazu: »In diesem Vergessen liegt z.B. die ganze Weisheit der modernen Ökonomen, die die Ewigkeit und Harmonie der bestehenden sozialen Verhältnisse beweisen.« (MEW 13,617)
Arbeit selbst wird somit unmittelbar gesellschaftlich, allein über das jeweilige Bedürfnis, das sie stillt. Und die Notwendigkeit der Arbeit und ihres jeweiligen Produktes regelt sich über Angebot und Nachfrage.
Bei Smith kommt hinzu, dass seine Analyse der freien Vertragsarbeit als Ursprung für gesellschaftlichen Wohlstand höchst normativ ausgearbeitet ist. Als Ökonom und Moralphilosoph ist ihm unweigerlich daran gelegen, die Bedingungen dafür zu analysieren, wie die neue gesellschaftliche Realität, der freie Arbeitsvertrag, zum allgemeinen Nutzen und Reichtum eingesetzt werden kann, nicht zuletzt durch angemessenen Lohn, der sich seinem Modell zufolge kongruent zum wirtschaftlichen Reichtum einer Nation entwickelt (Smith: 61) und niemals unter die Grenze der Menschlichkeit fallen darf (ebd: 64) .
An manchen Stellen liest sich »Wealth of Nations« dann auch wie ein Fürstenspiegel, den man dazu nutzte, feudalen Regenten zu zeigen, dass nur die Zufriedenheit der Bevölkerung die Stabilität ihrer eigenen Herrschaft garantiert; auf Smith übertragen: ein gerechter Lohn = zufriedene Arbeiter = eine stabile Gesellschaft = ungestörtes Wirtschaften.
Die Verwirklichung dieser Gleichung ist natürlich rein strategisch. Es geht also um die wechselseitige Stabilisierung von zufriedenen Arbeitern und einer unabhängigen Wirtschaft, die sich weder durch empörte Arme, noch durch einen bevormundeten Staat gegängelt fühlt.
So zumindest im klassischen Liberalismus. Und auch Smith scheint durch seine normativen Ansätze zu ahnen, dass es sich hier um eine Produktionsform handelt, die das Potential hat, sich in die falsche Richtung zu entwickeln. Zwangsläufig. Denn Moralphilosophen verdienen ja ihre Brötchen damit, dass Realität und Wunschdenken auseinander klaffen. Problematisch wird es nur, wenn sie denken, dass ihre Theorie reale Anwendung genießt, geschweige denn irgendeinen Sinn macht. Denn wie man mittlerweile weiß, ging das Konzept ohnehin nicht auf. Moral taugt also mitnichten dazu, Verselbständigungen produktiver Systeme zu zügeln.
Denn der Neoliberalismus hat den Staat längst an der Leine und weiß ihn für sich zu nutzen, indem er jetzt die Armen durch Ausgleichsgesetze ruhigstellt oder ihnen so lange vom Mythos der Eigenverantwortung erzählt, bis die Dummen es auch noch selbst glauben. Aus empörten Armen werden nicht politisierte, sondern zugerichtete Arme. Und wenn sie sich empören, dann schließen sie sich Pegida an oder glauben an Verschwörungstheorien.
Der Arbeitslohn erscheint darüber hinaus bei Smith – so Marx’ Einwand – automatisch als Tauschwert und Lohn für Arbeit, und zwar im wörtlichen Sinn. Der Wert der Ware ergebe sich nach Smith aus der darin verausgabten Privatarbeit und Mühe (Smith: 28), der Mehrwert, den sie produziert, wiederum durch Rationalisierung, dem Einsatz aller menschlicher Fähigkeiten und durch individuellen Fleiß.
Wäre das alles tatsächlich so, wären einerseits alle Bedürfnisse – unabhängig von Moden und Trends – jederzeit auf Befriedigungskurs, andererseits wäre ich mir als Arbeitender sicher, dass meine Mühe und Verausgabung jederzeit anständig bezahlt würde und weiterhin wird; und ein Manager, der eben mal einen Konzern wie VW rasiert hat, würde – nur so am Rande – dazu kongruierend einen schmerzlichen ökonomischen Malus hinnehmen müssen. Dieses Modell versprüht also die Naivität einer beeinflussbaren fairen und harmonischen ökonomischen Sphäre, die realiter gar nicht existiert und noch nie existiert hat.
Denn alle Konsequenzen aus diesem Konstrukt kommen uns – bezogen auf die eingangs genannten zeitgenössischen Formen des Selbstunternehmertums – sogleich lächerlich bis zynisch vor. Einerseits wissen wir nämlich alle, wiesehr gesellschaftliche Arbeit – gerade im Kreativbereich – Moden und Trends unterworfen ist; andererseits gehören viele aus diesem Bereich zu den Prekarisiertesten, die unsere Gesellschaft mitunter zu bieten hat; die vielbeschworene Freiheit, um die man als Kreativer immer beneidet wird, kann sich der Neider gut und gerne an den Hut stecken, wenn ich von meiner Verausgabung nicht überleben kann. Und dass es generell in der Arbeit harmonisch und fair zwischen Verausgabung und Bezahlung zugehe, kann wirklich keiner ernsthaft bejahen, nicht zuletzt auch beim Verhältnis zwischen Erfolg und Bezahlung im Managersektor.
Zudem stellt sich die Frage, wie all diejenigen, die nicht nur einen kurzfristigen Hype, sondern einen langfristigen Erfolg geschafft haben oder sich gar als feste Institution etablieren konnten, überhaupt Profit aus ihrem Betrieb ziehen könnten, wenn sie all die Menschen, die für sie arbeiten, verausgabungsgerecht bezahlten, wenn sie die Produkte für ihren Betrieb fair und ökologisch korrekt erwerben würden und die Preise gleichzeitig so gestaltet wären, dass sie sich jeder leisten könnte und weiterhin kann; wenn es sozusagen keine Möglichkeit gäbe, Mehrarbeit abzuschöpfen.
Man sieht also, dass bereits im ersten Ansatz einer Arbeit–als–Tauschwert–Theorie etliches hinkt, da hier lediglich Privatarbeiten untereinander tauschbar sind. Doch auch die Arbeitswerttheorie bei Ricardo kann dieses Problem nicht auflösen, weil die Bestimmung der erstmals genannten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit unklar bleibt.
Denn weder erklärt sich hier der Schritt von Privatarbeit zu gesellschaftlicher Arbeit, noch der Unterschied zwischen Arbeit und der Ware Arbeitskraft, über welche erst der Mehrwert produktionssteigernd abgeschöpft werden kann. Hält man an der Arbeitswerttheorie nach Ricardo fest, dann erhält man unweigerlich einen Substanzbegriff, der Waren eine Werthaftigkeit unterstellt, sobald darin Arbeit verausgabt wurde, denn dieser Theorie nach materialisiert sich in der Ware entäußerte Arbeit. Darüber hinaus wird Arbeit dadurch wertgebend, denn sie ist ja das Maß der Dinge, die Wertstifterin der Waren. Die Folge sind – so Ingo Elbe – der Waren- und Arbeitsfetisch, der bis heute im Bewusstsein der Arbeits- und Marktsubjekte verankert ist: Wir unterliegen der Selbständigkeit der Waren und unsere Arbeit trägt automatisch zum Reichtum der Gesellschaft bei (siehe Elbe: 229).
Dass die Verausgabung allein alles andere als wertstiftend ist, wenn sie nicht als abstrakte gesellschaftliche Form erscheint, und dass dieser Abstraktionsprozess selbst nicht störungsfrei ist, liegt auf der Hand.
Darüber hinaus geht die Arbeitswerttheorie davon aus, dass sich die Entwicklung von notwendiger Arbeit rational zur Entwicklung von technologischen Erneuerungen verhält. Wird der Arbeiter arbeitslos, dann hat das einen guten Grund, so der klassische Ökonom. Dass diese Form eines ökonomischen Rationalismus problematisch, wenn nicht sogar naiv ist, werden wir noch sehen.
In beiden Theorien fehlen demnach die realen und inhärenten Störungen und Disharmonien, denn die Möglichkeit, dass eine Privatarbeit niemals gesellschaftliche Arbeit wird, oder gar eine gesellschaftliche Arbeit plötzlich in die Nicht-Notwendigkeit abstürzt, ist hier erst gar nicht gegeben.
Genau dieser Widerspruch ist es, den Marx aufzulösen vermag, indem er erstmals die Grundlage zur Entstehung gesellschaftlicher Arbeit entwickelt, und zwar einerseits über den Doppelcharakter der Ware (Gebrauchs- und Tauschwert), andererseits über ihren Wert, über den Privatarbeit überhaupt erst abstrakte gesellschaftliche Arbeit wird.
Was heißt das nun?
Die Unterteilung der Ware (nützliches Produkt oder Dienstleistung) in Gebrauchswert und Tauschwert kann zunächst zeigen, dass beide Dimensionen historisch entstanden, und nicht als natürlicher Ausgangspunkt einfach mal so vorhanden sind, um sie methodisch zu nutzen. Der Gebrauchswert entsteht erst über das spezifische Bedürfnis einer Gesellschaft, und zwar zu einem spezifischen historischen Zeitpunkt. Er ist »gesellschaftliche[r] Gebrauchswert« (MEW 23: 55). Beispielsweise machen Staubsauger keinen Sinn in einer Gesellschaft, die historisch noch nicht mit Strom versorgt war, oder es geografisch bedingt überhaupt nie sein wird. Ebensowenig macht zum Beispiel eine Dienstleistung in einem Sonnenstudio Sinn, solange das allgemeine Schönheitsideal der noblen Blässe nicht durch den Wunsch nach knuspriger Epidermis aufgeweicht wurde, und sie macht ebenfalls keinen Sinn in einem Land, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint.
Im Tauschwert wiederum drückt sich das Äquivalent des jeweiligen Gebrauchswertes aus, welches zwei Waren erst vergleichbar und damit untereinander austauschbar macht. Auch der Tauschwert ist somit an die jeweilige Gesellschaft gebunden. Denn wir werden wohl kaum Weizen gegen Klamotten tauschen, es sei denn, man etabliert einen privaten Tauschhandel, den es mitunter wieder gibt, um beispielsweise gegen die Verschwendung von Lebensmitteln oder die modebedingt geringe Halbwertszeit von Klamotten zu protestieren.
Somit kann man sich vorstellen, dass auch Nicht-Waren – gebrauchte Dinge, Gegenstände oder Liebhaberstücke – einen Tauschwert haben, insbesondere auch auf der Zirkulationsplatform ebay, oder in den eben genannten Tauschökonomien. Der Tauschwert ist demnach kapitalismusunabhängig. Darüber hinaus – so ein weiteres Problem – macht ein permanent äquivalenter Tausch für eine kapitalistische Produktion überhaupt keinen Sinn. Wie sollte es jemals zur Produktionssteigerung und Profit kommen, wenn alles nur vergleichbar wäre?
Der Wert, der jetzt ins Spiel kommt, bildet demnach nicht nur eine äquivalente Verausgabungsgröße ab, um Waren untereinander austauschbar zu machen, sondern beinhaltet das Gemeinsame der Waren oder Dienstleistungen, nämlich die Vergleichbarkeit über Arbeit in ihrer abstrakten gesellschaftlichen Form.
Und damit etwas überhaupt diese Qualifikation erhält, muss sie sich als gesellschaftliche Arbeit etabliert haben. Der Wert ist demnach die Größe, in der sich »abstrakt menschliche Arbeit« (MEW 23: 52) darstellt.
Man kann jetzt einwenden, dass auch der private Verkauf auf ebay Gegenstände als Resultat menschlicher Arbeit und somit Waren veräußert. Doch sind das zumeist Dinge, die zu anderen Zeiten Waren darstellten (Antiquitäten, Vintage-Klamotten, nicht mehr produzierte Geräte) oder überhaupt keine gesellschaftliche Arbeit materialisieren (selbstgestrickte oder selbstgenähte Klamotten, kuriose und nur von Liebhabern geschätzte Handwerksprodukte); und auch abgelaufene Lebensmittel, die der Zirkulationssphäre entnommen werden, und durch das so genannte »Containern«, dem Protest gegen Lebensmittelverschwendung, in die private Tauschwirtschaft übergehen, sind keine Waren im kapitalistischen Sinne.
Um uns dies verstehen zu lassen, schreibt Marx: »Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein.« Beispielsweise Regenwasser und Luft. »Ein Ding kann nützlich sein und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein.« Beispielsweise ein selbst gestrickter Pullover. »Wer durch ein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware« Ein zubereitetes Abendessen oder aus Containern gerettete Lebensmittel. (MEW 23: 55, eigene Beispielsnennungen).
Alle drei eingefügten Beispiele zeigen bereits ein erstes Problem, denn Hausarbeit, in der Essen zubereitet wird, Liebesarbeit, in der für einen Freund oder das Kind ein Pullover gestrickt wird und frei verfügbares Wasser und Luft sind vom Wertbildungsprozess ausgeschlossen und insofern in der Logik der Werttheorie nicht nur produktionsbedingt, sondern auch gesellschaftlich irrelevant, denn eine kapitalistische Gesellschaft definiert sich ja nur über ökonomisch produktive und anerkannte Arbeit.
Kann aber eine Gesellschaft ohne Hausarbeit und Liebesarbeit auskommen? Und wie steht es um Luft und Wasser, die niemandem gehören und frei verfügbar sind? Ist das der Grund, weshalb Umweltschutz so stiefmütterlich behandelt wird? Und wie steht es um die abgelaufenen Lebensmittel? Wieso kann sich eine Gesellschaft leisten, so verschwenderisch mit lebenswichtigen Produkten umzugehen, während andernorts die Menschen verhungern?
Marx schreibt weiter: »Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher auch keinen Wert.« (MEW 23:55)
Und seine Formulierung zeigt gleichzeitig eindrucksvoll seine Methode, nämlich die analytische Darstellung des Kapitalismus, wie dieser aus seinem Selbstverständnis heraus tickt. Dass das mitnichten affirmativ sei und er sich so als Vordenker der modernen Arbeitergesellschaft erweise, wie ihm Hannah Arendt in »Vita Activa« (Arendt: 81) vorwirft, liegt auf der Hand: Wie soll im weiteren Verlauf eine seriöse Kapitalismuskritik, und zwar frei von moralischem Geplänkel und Ressentiments funktionieren, wenn man das System erst gar nicht verstanden hat?
Aus diesen einfachen Sätzen eröffnet sich nämlich sogleich ein Stapel an Fragen, die genau das grundlegende Problem gesellschaftlicher Arbeit im Kapitalismus darstellen. Denn der Zusammenhang von Nutzen über den Gebrauchswert eines Gebrauchsgegenstandes und die Anerkennung als gesellschaftliche Arbeit über das Erfüllen dieses Nutzens führt uns geradewegs in eine erste entscheidende Zwischenüberlegung: Warum kann im Kapitalismus eine Arbeit gesellschaftliche Arbeit sein, die insgesamt Nutzloses produziert? (Wegwerfprodukte; Dinge, die ihre Garantiezeit gerade mal kurz überleben; Dinge von schlechter Verarbeitung und Qualität; Dinge, die gar nicht erst funktionieren; mein Internetanschluss, der ständig ausfällt oder das Rührei–Brot von Maggi).
Und warum kann Arbeit, die gesellschaftlich von geradezu herausragendem Nutzen ist, dennoch von der Definition gesellschaftlicher Arbeit im Kapitalismus ausgeschlossen sein? (Arbeit aus dem informellen Sektor, wie Haus- und Erziehungsarbeit; die private Pflege von Angehörigen; Ehrenamt). Und rechtfertigt das, Lebensmittel wegzuwerfen, die noch genießbar sind, nur weil sie für den normalen zahlenden Konsumenten keinen Gebrauchswert haben?
Darüber hinaus ergeben sich aber noch weitere Probleme zur abstrakten gesellschaftlichen Arbeit, die im Wert vergleichbar wird: Das Prinzip des Kapitalismus ist es, die Verausgabung der produktiven Arbeit so effektiv und kostengünstig zu gestalten wie möglich – durch technologische Innovationen beispielsweise oder durch Einsparungen in den Produktionskosten. Das heißt: Je geringer und effektiver der Aufwand und die Kosten, umso besser für die Produktion, umso besser für den Geldbesitzer.
Und darin liegt auch schon der Knackpunkt, denn je geringer die Kosten der Produktion, umso schlechter für den Arbeiter, der diese Kosteneinsparung unmittelbar zu spüren bekommt: Über Arbeitstagsverlängerungen, Lohnkürzungen, bis hin zu seiner eigenen Kündigung, weil die Produktion beispielsweise Kosten einsparen muss.
Marx: »Innerhalb des kapitalistischen Systems vollziehn sich alle Methoden zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters; alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in Beherrschungs- und Exploitationsmittel des Produzenten (MEW 23: 674).
Und weiter: »Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter« (MEW 23: 529f.)
Aber auch die grundsätzliche Änderung gesellschaftlicher Arbeit kommt hier zum Tragen: Der technologiebedingte Wegfall von Arbeitsplätzen (Entwicklung von Robotern) sowie die seit der Agenda 2010 wieder eingeführte Einrichtung einer Reservearmee – mittlerweile »Manövriermasse« genannt –, die Arbeit auf der Ersatzbank, die nur zum Einsatz kommt, wenn sie gebraucht wird, ist ein wesentliches Symptom des Wertes (beispielsweise Leiharbeit oder auch die in Großbritannien üblichen Null-Euro-Verträge, die einen an die Arbeit und Bezahlung auf Abruf sogar noch vertraglich binden).
Marx: »Wenn die Produktionsmittel, wie sie an Umfang und Wirkungskraft zunehmen, in geringerem Grad Beschäftigungsmittel der Arbeiter werden, wird dies Verhältnis selbst wieder dadurch modifiziert, daß im Maß, wie die Produktivkraft der Arbeit wächst, das Kapital seine Zufuhr von Arbeit rascher steigert als seine Nachfrage nach Arbeitern. […] Der kapitalistischen Produktion genügt keineswegs das Quantum disponibler Arbeitskraft, welches der natürliche Zuwachs der Bevölkerung liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser Naturschranke unabhängigen industriellen Reservearmee.« (MEW 23, 664)
In diesen Überlegungen liegt bereits ein wichtiger Schritt aus der klassischen Arbeitswerttheorie, denn die realen Depravationen, die wir heutzutage wieder eindrücklich erfahren, gibt es in dieser Theorie erst gar nicht.
Wenn hier Arbeitslose entstehen, dann nur, weil sie aufgrund technologischer Erneuerungen wegrationalisiert wurden und das lässt sich als Gesamtnutzen für den technologischen Standard und Wettbewerb einer Gesellschaft auch rechtfertigen. Arbeit kann eben produktionsbedingt unbrauchbar werden und das versteht womöglich auch der Arbeiter. Aus heutiger Sicht würde man ihm eine Umschulung anbieten.
Die produktionsnotwendig unbrauchbare Arbeit, und zwar die Arbeit auf Abruf einer Reservearmee, und die Möglichkeit des Drucks und Lohndumpings aufgrund der alleinigen Existenz dieser Arbeitsreservisten, ist jedoch neu. Die Folgen dieser Reservisten sind aber eklatant: Denn jetzt braucht der Arbeitgeber noch nicht mal jemanden zu suchen, der einen Arbeiter ersetzt, wenn dieser erkrankt oder aufmuckt. Der Arbeiter muckt von sich aus nicht mehr auf oder geht sogar krank zur Arbeit, weil es Hunderte oder gar Tausende gibt, die ihn jederzeit ersetzen können. Er wird schlichtweg austauschbar.
Zuletzt konnte man das eindrücklich beim Poststreik erkennen, der dadurch entschärft wurde, dass private Betriebe ihre Mitarbeiter in die Sortierzentren schickten oder Briefe und Pakete sonntags von Leiharbeitern ausgeliefert wurden.
Wohin aber driftet eine Gesellschaft ab, in der Arbeiterprotest inhärent unmöglich wird?
Dieser entscheidende Schritt führt jetzt dazu, dass der Arbeiter trotz seiner Arbeit, trotz seiner Verausgabung verarmt. Er verarmt also nicht, weil er wegrationalisiert wurde, weil er arbeitslos wurde, sondern obwohl der arbeitet.
Die Arbeit des Arbeiters ist jetzt produktionsnotwendig verarmend und verelendend. Denn das liefert dem Produzenten eindeutige Vorteile, die seine Macht gegenüber dem Arbeiter noch mehr verstärken. Das aber ist ein entscheidender Schritt hin zur grundlegenden Depravation moderner Arbeitsverhältnisse, die erstmals überhaupt von Marx aufgedeckt werden.
Marx: »Im großen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Zyklus entsprechen.» (MEW 23: 664)
Aber auch die Produktion von nutzlosem, lediglich die Produktion aufrechterhaltenem Waren–Müll sowie die produktionsnotwendig irrelevante und dennoch gesellschaftlich höchst bedeutungsvolle Arbeit aus dem informellen Sektor spielen nach einer Arbeitsmengentheorie, die sich nur positiv auf die Beziehung zwischen Arbeitsverausgabung und Steigerung der Produktivkraft bezieht, keine Rolle. Womöglich – nur so am Rande – wird der informelle Sektor sogar deshalb aufrechterhalten, weil er produktionsnotwendig irrelevant ist und diese doch irgendwie notwendige Arbeit nun ohne ökonomische Anerkennung problemlos weiter existieren kann. Sie macht sich somit unentgeltlich bezahlt.
Wie aber kann eine Gesellschaft funktionieren, in der die wichtigste Arbeit, die Arbeit am Menschen – Familienarbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit – gesellschaftlich irrelevant ist? Und leben wir nicht längst in einer solchen Gesellschaft, die alle Arbeit am Menschen gänzlich geringschätzt, gerade wenn man sieht, wiesehr vor allem in der Pflegearbeit auch Arbeitssklaven eingesetzt werden?
Die Arbeitsmengentheorie der klassischen Ökonomie zeigt deshalb ganz klar Ansätze einer positivistischen Theorie, die Überlegungen einer Depravation von Arbeits- und Produktionsverhältnissen und von Gesellschaft insgesamt nicht in ihr Konzept einschließt.
Marx kann hingegen zeigen, dass abstrakte gesellschaftliche Arbeit im Kapitalismus produktiv zu sein hat. Punkt. Und alle Arbeit, die das nicht ist = nicht gesellschaftlich = nicht wertbildend = gesellschaftlich irrelevant. Und aus diesem Zirkel gibt es keinen Ausweg.
In der Arbeitsmengentheorie werden darüber hinaus Bedürfnisse mit Waren befriedigt, so ihr naives Selbstverständnis. Aber kann sich eine kapitalistische Produktion überhaupt aufrechterhalten, wenn es ihr nur um Bedürfnisbefriedigung gehe?
Die Marx’schen Werttheorie zeigt dagegen, dass sich die Produktion selbst aufrechterhält, und zwar egal wie. Egal, ob mit Arbeiter oder Reservist, ob mit Bezahlung oder ohne. Egal, ob mit oder ohne Waren-Müll. Es geht also alles, was gehen muss. Und es kann aber auch nicht anders gehen, denn nur so wird die Aufrechterhaltung der Produktion überhaupt garantiert, und zwar bedingungslos gegen alle Widrigkeiten und Krisen. Und steht dem etwas entgegen, dann muss eben gehandelt werden: über Entlassungen, über Niedriglöhne, Werkverträge, über die Einrichtung einer Manövriermasse oder über Arbeitssklaven, deren Arbeitskraft über alle Maßen ausgenutzt wird (beispielsweise in der Fleischindustrie) oder durch Knebelverträge über die genannten Null-Euro-Verträge.
Und auch der einzelne Produzent – Szenegastronom, Clubbetreiber, Handwerkskünstler, Designer – bekommt jetzt über die realen Disharmonien zwischen seiner Privatarbeit und ihrer gesellschaftlichen Notwendigkeit oder Überflüssigkeit sein Fett weg. Denn auch seine Arbeit kann unter bestimmten Voraussetzungen gesellschaftlich und mitunter sogar willkürlich irrelevant werden. Denn der Wert bemisst sich nicht über die jeweilige Privatarbeit, sondern erst über ihre abstrakte gesellschaftliche Form.
Einschneidend und mitunter existenzgefährdend hatten das zuletzt Fotografen zu spüren bekommen, als die Digitalisierung der Fotografie diese nachhaltig verändert hat. Wer jetzt glaubt, es genügte damals, sich dieser technischen Neuerung anzupassen, irrt gewaltig. Was Baumärkte für Handwerksbetriebe bedeuteten, bedeutete die Digitalisierung für die Fotografie. Denn die reale Folge war, dass jetzt jeder selbst nötige Fotoaufnahmen erledigte. Und auch die Industrie hat bekanntlich nachgezogen, indem selbst Handys Kameras bekamen und diese noch dazu immer besser wurden, wie man auch bei Online-Diensten wie Instagram erkennen kann. Diese Digitalisierung hat letztendlich dazu geführt, dass professionelle Fotografen ihre Aufträge im Kulturbetrieb sukzessive verloren haben oder ihre Preise sosehr herabsenken mussten, dass dadurch wieder Arbeits- und Ausbildungsplätze verloren gingen.
Ich kann also als einzelner Robinson noch so viele T-Shirts durchschwitzen wie ich will, solange meine Privatarbeit nicht als abstrakte Arbeit erscheint, bleibt sie vom Wertbildungsprozess, der Anerkennung als gesellschaftliche Arbeit, schlichtweg ausgeschlossen, und diese Anerkennung kann sie auch jederzeit wieder verlieren.
Um eine Arbeit notwendig für die Gesamtproduktion und Gesellschaft zu machen, muss sie sich erst als solche etablieren. Und der Wert bildet genau diese Abstraktionsleistung ab, über die eine Arbeit produktionsbedingt notwendig oder nicht-notwendig ist; dass sie gesellschaftlich relevant oder eben irrelevant ist.
Engels: »[…] der Wertbegriff […] bei Marx ist nichts andres als der ökonomische Ausdruck für die Tatsache der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit als Grundlage des wirtschaftlichen Daseins« (MEW 25, 903f.)
Es geht also um die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit. Das allein ist die Logik des Wertes.
Doch was ist die gesellschaftliche Produktivkraft?
In einem Brief an Annenkow schreibt Marx, dass die Produktivkräfte „das Resultat der angewandten Energie der Menschen“ seien; allerdings sei diese Energie „begrenzt durch die Umstände, in welche die Menschen sich versetzt finden, durch die bereits erworbenen Produktivkräfte, durch die Gesellschaftsform, die vor ihnen da ist, die sie nicht schaffen, die das Produkt der vorhergehenden Generation ist“ (MEW 4: 548f).
Man kann die Produktivkräfte auch als die Gesamtheit aller tatsächlichen und potentiellen produktiven Möglichkeiten einer Gesellschaft bezeichnen: Technologien, Wissen, Kultur, Medizin etc.; der technologische und kulturelle Stand und das Potential einer Gesellschaft zu einem jeweils historischen Zeitpunkt. Der Kapitalismus versteht es jedoch, diese Errungenschaften und Potentiale zu seinen Gunsten und für sein Interesse zu nutzen, weshalb er definiert, was eine gesellschaftliche Produktivkraft ist. Kultur kann dann im Zweifelsfall auch mal wegfallen. Oder sie kann eine geradezu herausragende Rolle spielen, wie beispielsweise die Filmindustrie. Und gerade in der Kultur sieht man, wie willkürlich der Wert Privatarbeiten gesellschaftlich macht oder auch daran hindert. Gelder werden meist an die Institutionen vergeben, mit denen sich der Kapitalismus identifizieren kann, während alternative Projekte nicht selten davon abgehalten werden, sich zu entfalten und Fördergelder zu erhalten.
Der geschichtsphilosophische Ansatz von Marx geht jetzt davon aus, dass die Menschen sich irgendwann mit ihrem erworbenen Wissen, ihren eigenen Produktivkräften, gegen das System wenden. Denn kongruent zur Entwicklung und zum Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkräfte eigenen sich die Menschen Wissen an, das sie als Waffe gegen die Produktionsverhältnisse einsetzen. Es kommt zur Revolution.
Ein schöner Traum. Denn wie wir längst wissen, ist Bildung das, was im Neoliberalismus am sträflichsten vernachlässigt wird.
Ist der dumme Arbeiter etwa ein Garant für die Aufrechterhaltung des Systems?
Wohl kaum. Denn jetzt ist er so dumm, dass er in AFD und Pegida die Lösung für seine Misere sieht. Man hat sich also neue Waffen geschmiedet. Nicht mehr das Proletariat, sondern den dumpfen Wutbürger, den Troll, den Nazi, den Chauvinisten, Rassisten und Antisemiten. Und es gibt auch noch Schützenhilfe aus der bürgerlichen Mitte. Von all denen, denen es eigentlich gut geht.
Ob man die jemals alle wieder los wird?
Doch kommen wir zurück zum Wert. Die Abstraktionsleistung im Wert ist in die Handlungen der Marktsubjekte eingeschrieben. Sie ist gänzlich unbewusst. Sie ist keine methodische oder strategische Abstraktion als Resultat eines vermeintlich strategischen Handelns (siehe Elbe: 234 und Heinrich: 2005: 47). Alle Strategie und Vernunft, die noch in den klassischen Ökonomietheorien eine Rolle gespielt haben, verschwinden bei Marx zugunsten eingeschriebener Handlungs- und Verhaltensweise der Marktsubjekte.
Damit eine Privatarbeit und ihre Ware (Handwerksprodukt, Fabrikware, Dienstleistung) gesellschaftlich werden, genügt es also nicht, allein mit dem Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung auf der Zirkulationsplatform aufzutreten. Dieser Schritt reicht nicht aus, um aus einer Privatarbeit gesellschaftliche Arbeit zu machen, denn dort aufzutreten heißt längst nicht, dort auch willkommen zu sein. Vielmehr muss die einzelne Privatarbeit erst Eingang in die reale Abstraktion ihrer Vergleichbarkeit erhalten. Und diese Vergleichbarkeit erfolgt über den Wert. Die Gesellschaftlichkeit ist hier also doppelt vermittelt; nicht allein über das Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung, sondern zusätzlich über ihre Anerkennung als produktionssteigernde gesellschaftliche Arbeit; eine defizitäre Form der Anerkennung, da diese lediglich ökonomisch begründet ist und nicht emanzipatorisch und selbstverwirklichend, wie es in Marx’ Konzeption der freien Gesellschaft möglich sei.
Verständlich wird das ganze vielleicht so: Beispielsweise ist es durchaus möglich, dass ein Handwerkskünstler jahrelang in seinem Atelier Gebrauchswerte schafft und vor sich hinarbeitet, und urplötzlich wird die eigene Arbeit zu gesellschaftlicher Arbeit. Diesen Trend gab es zuletzt in England beim so genannten »Pottery«, dem Töpferhandwerk. Erst in dem Moment, wo die Gebrauchswerte des jeweiligen Töpfers Eingang und Anerkennung in die Zirkulationssphäre haben, werden sie zu Waren und Hüllen abstrakter gesellschaftlicher Arbeit (siehe MEW 23, 88).
Marx: »Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit angehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte – Warenwerte.« (ebd., 52) Und diese Substanz tilgt sowohl ihre konkrete Nützlichkeit sowie den Charakter der Privatarbeit.
Es interessiert nicht mehr die Form der Verausgabung; es zählt nur noch die ökonomische Produktivität. Sichtbar auch daran, dass sich der Liberale sogar freuen kann, wenn man mit Mist Geld verdient. Wie es hinter den Kulissen zugeht, und zu welchem realen Preis der Mist verhökert wird, ist dabei völlig irrelevant: Wie steht’s um die Arbeitsverhältnisse? Wie um die Betriebsverhältnisse? Greift der ungeliebte Staat doch unterstützend ein? Beispielsweise durch Hartz-Aufstockungen für Hungerlöhne oder gar durch Kooperation wie beim Riester–Maschmeyer–Deal.
In der Theorie der politischen Ökonomie hingegen (bei Ricardo beispielsweise) bleibt der Doppelcharakter der Ware als Resultat konkreter, Gebrauchswert schaffender Arbeit und Tauschwert schaffender Arbeit, beide historischen Dimensionen sowie der Wert als handelnde Abstraktion unklar. Die Ware erscheint hier lediglich als ein an das Bedürfnis gekoppelter Gebrauchswert, und diese Ware hat automatisch einen Wert, sobald Arbeit in ihr entäußert ist. Der Wert kommt ihr quasi automatisch zu und unterstellt dadurch einen Substantialismus, der die Waren unmittelbar untereinander austauschbar macht (siehe Elbe: 232). Dadurch bleibt aber unklar, dass der Wert nur gesellschaftlich vermittelt ist und sich in der Ware lediglich materialisiert (MEW 23: 53, siehe auch Postone: 261). Der Wert tut sozusagen nur so, als ob er materiell sei; tatsächlich aber ist er ein rein gesellschaftliches Verhältnis zu einem jeweils historischen Zeitpunkt. Allein dieses Verhältnis entscheidet, ob eine Privatarbeit gesellschaftliche Arbeit ist oder eben nicht.
In unserem oben genannten Beispiel des Töpfers würde er in der Arbeitswerttheorie immer Wert schaffen, und zwar unabhängig von einem vorübergehenden Hype oder dessen plötzliches Ende; im Marx’schen Modell hingegen nur, wenn die Vermittlung im Wert seine Arbeit gesellschaftlich macht.
Das Modell der politischen Ökonomie kann somit nicht erklären, warum ein Töpfer jahrelang von seiner Arbeit nicht leben konnte, einen plötzlichen Umsatzhype erlebt und danach womöglich wieder in der Versenkung verschwindet.
Das Marx’sche Modell hingegen lässt im weiteren Verlauf gesellschaftliche Umstände (Trends, Moden, sozialpsychologische Macken der Konsumenten, Begehrlichkeiten, Hype–Hysterien, Schnäppchen-Fieber, Konsumenten-Neid, Selbsterhaltung der Produktion, Preiskampf und ähnlichen Konsum- und Produktionswahnsinn) verstehen, die eine Arbeit gesellschaftlich notwendig oder auch einfach mal so eben überflüssig oder gar irrelevant machen können.
Beispiele dieser Art sind zahlreich. Drei Produkte machen die Abhängigkeit der Produktion von der Konsumentenlaune geradezu deutlich: das bereits erwähnte Rührei–Brot von Maggi, das trotz Werbetrommel keiner mag; das Tamagotchi, das irgendwann alle haben und keiner mehr braucht; die Buntstifte von Faber–Castell, die über ein unerwartetes Revival plötzlich alle haben müssen, um in Malbüchern für Erwachsene ihren Massenindividualismus auszuleben.
Der vermeintlich natürliche Wert einer Ware klebt ihr – so Marx – in der Arbeitswerttheorie somit förmlich an, sobald sie produziert ist (siehe MEW 23: 87). Da auch die Arbeitskraft nach Marx eine Ware ist, bedeutet die Anwendung dieser Theorie auf heute, dass auch Arbeit automatisch Wert anklebt, und zwar gesellschaftsunabhängig, sobald sie in entäußerter Form (als geschaffenes Projekt, Produkt, getaner Arbeitstag, als von Pfandflaschen bereinigter Stadtpark, als durchgeschwitztes T-Shirt, geschundene Hände oder als zu Papier gebrachtes Hirnschmalz) erscheint.
Ich kehre somit abends mit dem guten Gefühl nach Hause, dass ich meiner Entäußerung entsprechend adäquat bezahlt wurde, und mit meiner Tätigkeit und meinem Produkt automatisch am Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums beteiligt war. Wen wundert‘s, wie schlecht sich ein Arbeitsloser fühlen muss und wie sehr ihm nach diesem Modell ein Versagen eingeredet wird. Faul saß er den ganzen Tag auf der Haut und hat sich mitnichten an der Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtum beteiligt. Im Gegenteil: Über die ihm zugeteilte Stütze hat er sich noch unverschämter Weise daran bedient.
Durch ihren vermeintlich natürlichen Wert und ihrer scheinbaren Qualität der Reichtumsvermehrung produziert die Vorstellung dieser spezifischen Form der Wertarbeit im Kapitalismus somit den Zwang, an der Vermehrung dieses Reichtums mitzuwirken, der dem Arbeitslosen in all seiner Krassheit entgegenschlägt. Denn Arbeitslosigkeit bedeutet hier nichts weniger als die Weigerung oder Unfähigkeit zum Mitwirken an der gesellschaftlichen Reichtumsvermehrung. Gesellschafts- oder produktionsbedingt unbrauchbare Arbeit, die die unverschuldete Arbeitslosigkeit mit sich bringt, existiert in diesem Modell erst gar nicht. Die Schikanen, über die aus Jobcentern berichtet wird, spiegeln genau dieses Gedankenkonstrukt heutzutage noch wider.
Vermissen lässt die Anwendung der Arbeitswerttheorie der politischen Ökonomie ebenfalls das gängige Phänomen, dass vergleichbare Qualitäten einer Privatarbeit einmal als gesellschaftliche Arbeit Erfolg erleben, ein andermal eben nicht. Allgegenwärtig ist dies in der künstlerischen oder kulturellen Arbeit, die ebenfalls eine Form des zeitgenössischen Selbstunternehmers darstellt.
Es gibt erfahrungsgemäß keinerlei Zusammenhang zwischen Qualität und Erfolg, auch wenn das manche noch so sehr glauben. Über den liberalen Kalauer, dass man alles erreichen könne, wenn man sich nur entsprechend anstrenge, oder Qualität sich gar immer durchsetze, können unzählige herausragende Künstler, Schriftsteller, Schauspieler nur müde lächeln, wenn ihre Arbeit einfach keinerlei oder nur holpernde ökonomische Anerkennung erntet. (Und zur Klarstellung reden wir hier von der prekarisierten, bzw. standardisierten Bezahlung, die auch Durststrecken überbrücken muss, in denen man auftragslos oder ohne Engagement pleite zuhause sitzt. Künstler, Schauspielerstars, Bestsellerautoren, deren Gagen auch nach Aura und Berühmtheit bemessen werden und insofern auch spekulativen Charakters sind, sind von diesen Überlegungen ausgeschlossen. Sie machen in diesem Zusammenhang schlichtweg keinen Sinn).
Sprachlich hat man sich hingegen längst angepasst, um diese eben genannten Phänomene zumindest begrifflich zu verpacken: es begegnen sich dann Publikumserfolg / Blockbuster / Bestseller / Publikumsmagnet / Fleiß vs. Kritikerliebling / Low Budget–Produktion / Ladenhüter / Kassenflop / Faulheit. Und auch das Steuerrecht hat sprachlich und inhaltlich nachgezogen: Ein Betrieb, der keinen ökonomischen Erfolg aufweisen kann, wird schlichtweg als „Liebhaberei“ degradiert und unter Umständen steuerrechtlich abgestraft für derlei ökonomische Erfolglosigkeit, bis hin zu seiner Zwangsschließung.
Marx dagegen zeigt nun, dass Arbeit erst über eine notwendige Abstraktion zu gesellschaftlicher Arbeit wird. Es genügt nicht, wenn Bedürfnisse und deren Befriedigung deckungsgleich mit der jeweiligen Privatarbeit des einzelnen Robinsons sind; vielmehr muss sich die jeweilige Privatarbeit zunächst als gesellschaftlich notwendig beweisen, und zwar über die Vermittlung im Wert. Denn dieser ist nicht automatisch vorhanden, sondern muss über die jeweilige Gesellschaft erst als reale Abstraktion geleistet werden. Wäre er hingegen automatisch vorhanden, kann man nicht erklären, warum eine Privatarbeit einmal gesellschaftlich ist, ein andermal eben nicht.
Die Bedürfnistheorie der Robinsonaden ist aber auch anderweitig naiv. Denn eine kapitalistische Produktion, die sich allein auf Bedürfnisbefriedigung verlasse, ist spätestens dann am Ende, wenn eine Gesellschaft übersättigt ist. Beispiele erleben wir, wenn der Kapitalismus ausländische Märkte erobert oder Binnenmärkte zerstört, weil der heimische Markt einfach keinen Absatz mehr bietet. Dabei geht es auch hier nicht um die reale Bedürfnisbefriedigung neuer Märkte, sondern allein um die Selbsterhaltung der Produktion, ein Notausgang sozusagen, um selbst nicht an einer möglichen gesellschaftlichen Bedürfnislosigkeit zu Grunde zu gehen.
Denn für den Kapitalismus ist nicht schlimmer als eine rundum zufriedene Gesellschaft.
Das Bedürfnis ist hier somit Mittel zum Zweck des Produktionserhalts. Und weil Bedürfnisse irgendwann befriedigt sind, gilt es, immer wieder neue zu finden oder Begehrlichkeiten zu kreieren, aber nur zum Zweck der sich selbsterhaltenden Produktion. Trotzdem findet sich hier noch das Ideal, die Bedürfnisbefriedigung von allen bezahlbar zu gestalten, denn ein breiter Markt gestaltet sich positiv für die Produktion, sichtbar daran, dass bestimmte Konsumgüter (Fernseher, Haushaltsgeräte) mittlerweile auch für jedermann finanzierbar sind, bis hin zu eigenen Finanzdienstleistungen des jeweiligen Verkäufers zur Ermöglichung von Ratenzahlung. Das Ziel ist hier ganz klar Konsum, und zwar von möglichst vielen.
In der freien Gesellschaft bei Marx hingegen ist die Bedürfnisbefriedigung ausschließlicher Zweck der Produktion. Eine rein bedürfnisorientierte und bedürfnisbefriedigende Produktion sehe daher gänzlich anders aus. Wie, das können wir hier nicht weiterverfolgen.
In der Grenznutzentheorie wiederum ist das Bedürfnis nicht Mittel der Produktion, sondern Mittel der Spekulation und muss somit künstlich verstärkt werden; im Idealfall ist es sogar niemals befriedigt, beispielsweise, über die Aufrechterhaltung von Hunger und Wohnungsnot. Weder theoretisch noch praktisch interessiert sich diese Theorie dafür, dass die Befriedigung des jeweiligen Bedürfnisses auch für alle bezahlbar sein muss, und scheitert genau daran, dass aus der Eigenlogik des Produktionserhalts heraus möglichst viele sich auch Waren leisten können müssen.
Denn wie soll bitte eine kapitalistische Gesellschaft aussehen, die bereits an der Befriedigung ihrer Elementarbedürfnisse, wie Essen oder Wohnen, scheitert? Und wie soll ein Warenbesitzer überhaupt Profit machen, wenn sich keiner mehr was leisten kann? Und wie darüber hinaus sollen sich jemals feste Preise etablieren, deren Bezahlung für den Konsumenten auch kalkulierbar sind und nicht vom täglichen Gutdünken des jeweiligen Geld- oder Warenbesitzers abhängen? Das der Kaufkraft entzogene Subjekt erscheint nämlich, wie Hans-Peter Büttner einwendet, erst gar nicht auf dem Markt (Büttner: 7), so die reale Konsequenz dieser Theorie.
Man sieht also, dass in der Grenznutzentheorie realiter viele Probleme entstehen, die hier nicht weiter verfolgt werden können.
Die alleinige Regulierung über Angebot und Nachfrage, so eine weitere Behauptung der ökonomischen Robinsonaden, tilgt jedoch nicht das gesellschaftliche Verhältnis des Wertes einer Ware, sondern bestimmt lediglich ihren Preis. Das bedeutet, dass Verknappung Preise erhöht, ihr Überangebot ihren Preis senkt, was auch die Grenznutzentheorie für sich zu nutzen weiß.
Auf den Wert – die gesellschaftliche Notwendigkeit und Anerkennung einer Arbeit oder eines Produktes – hat das hingegen keinerlei Einfluss.
Wo stehen wir nun?
Um im Kapitalismus anerkannte gesellschaftliche Arbeit zu leisten und Waren zu produzieren, genügt nach Marx weder das Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung noch, sich auf das Verhältnis Angebot und Nachfrage zu verlassen – wie es sich die politische Ökonomie ausgedacht hat –, denn beides verbirgt die historische, aber auch sozialpsychologische Dimension, die Entstehung der Voraussetzungen dafür, dass eine Privatarbeit überhaupt erst zu gesellschaftlicher Arbeit werden kann.
Noch viel weniger zeigt die Bedürfnistheorie der klassischen Ökonomie allerdings, wie und warum gesellschaftliche Arbeit in die Privatarbeit und damit in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit zurückfallen kann.
Beispielsweise sind Youtuber, Influencer, Blogger und all diese zeitgenössischen Arbeitsformen erst möglich, seitdem beinahe jeder Haushalt einen Internetanschluss hat und ein vorwiegend junger Gesellschaftsanteil diesen Angeboten sein Vertrauen schenkt. Schnell kann so eine Erscheinung zu Ende sein, wenn Jugendliche erwachsen geworden sind und kein interessierter Nachwuchs folgt. Ein Großteil der gerade unter Jugendlichen erfolgreichen gesellschaftlichen Arbeit erlebt immer wieder das Drama ihres Absturzes, das mitunter über Nacht auf den jeweiligen Robinson einbricht. Deutlich sieht man das an Teenie–Bands, die oftmals das Erwachsenwerden ihres Publikums nicht überstehen, wie man zuletzt bei den Bands „Echt“ und „Tokio Hotel“ miterleben konnte.
Abgesehen von Tonträgern (im Fall der Bands), produzieren alle genannten Arbeiten keine Waren im eigentlichen Sinne und sind dennoch in höchstem Maße an der gesellschaftlichen Gesamtproduktion beteiligt, weil sie wiederum direkten Einfluss auf das Konsumverhalten einer Gesellschaft haben und dadurch die Produktionen ganz immens beeinflussen, indem sie neue Bedürfnisse und Begehrlichkeiten wecken, beispielsweise in Mode oder Jugendkultur. Insofern produzieren sie die wichtigste aller Waren in unserer zeitgenössischen Gesellschaft, das »Must-have«, das aber, wie man weiß, jedes Jahr neu definiert wird.
Gerade in diesen Formen zeitgenössischer Arbeit sieht man ganz besonders auch den individual- und sozialpsychologischen Aspekt, dem gesellschaftliche Arbeit unterliegt und wie schnell sie irrelevant werden kann, wenn die Sozialpsychologie zu mucken beginnt.
Jetzt wird es womöglich einen Einwand geben, dass es durchaus evident scheint, dass das klassische Liberalismus–Modell von Angebot und Nachfrage als Grundlage der Bedürfnisbefriedigung die Produktion und Zirkulation regelt. Wenn man durch Szeneviertel flaniert, in denen die Robinsons und ihre Innovationen nur so aus dem Boden sprießen; wenn man sieht, wie oft gerade Szenegastronomien randvoll mit Gästen besetzt sind, dann kommt einem unweigerlich der Gedanke, dass es einfach zu sein scheint, mit der richtigen Idee, dem Cool Knowing (Angebot), eine regelrechte Goldgrube (Nachfrage) zu schaffen, wenn man nur richtige Begehrlichkeiten weckt, um damit den Place to be zu kreieren.
Szenegastronomien, beispielsweise, sind jedoch erst so erfolgreich, seitdem sich auch die Gesellschaftsstruktur geändert hat. Womöglich koinzidiert ihr Erfolg mit der Tatsache, dass es mehr Single-Haushalte gibt, dass nicht mehr soviel zuhause gekocht wird, dass man sich auswärts zu essen eher leisten kann, dass es einfach chic ist oder dass in Städten, wie beispielsweise Frankfurt, mehr und mehr Arbeitnehmer und Pendler anreisen, die mittags oder nach Feierabend diese Gastronomien aufsuchen. In einem eher ländlichen Umfeld – so kann man sich vorstellen – oder vielleicht noch vor zehn Jahren, wäre dieser Erfolg unter Umständen nicht möglich.
Eines vergessen deshalb Hirngespinste eines natürlichen Wertes qua Entäußerung zum Ziele der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung und einer Marktregulierung über Angebot und Nachfrage, und das sind die gesellschaftlichen Strukturen, die eine Privatarbeit in die Vergleichsform der gesellschaftlichen Arbeit aufnehmen, und warum das auch scheitern kann, mitunter sogar willkürlich. Sie können weder erklären, warum ein Laden die besagte Goldgrube wird, ein anderer aber an einem vergleichbaren Standort (Attraktivität, Bevölkerungsstruktur, Betriebsausgaben) nach kürzester Zeit schließen muss. Sie können nicht erklären, warum ein Club sich über zwanzig Jahre halten kann, obwohl die Clubkultur schon oft totgesagt wurde, ein anderer nach kürzester Zeit wieder schließen muss, obwohl er in allen Szenemagazinen als der heiße Scheiß beworben wurde. Sie können nicht erklären, warum ein und derselbe DJ in einem Club die Massen anzieht, in einem anderen, gerade mal wenige Kilometer entfernt, vor einer halbvollen Tanzfläche spielt. Und diese Hirngespinste interessieren sich noch viel weniger dafür, wie es hinter den Kulissen zugeht, um einen Laden oder eine Geschäftsidee überhaupt aufrechtzuerhalten.
All diese Gedanken sind aber wichtig, denn an jedem Szeneladen, jedem Club, jedem Designbüro, jedem Fotostudio hängen Arbeitsplätze, die im Zweifelsfall gefährdet sind. Und so kann der Liberale nicht erklären, warum gerade in der boomenden Kultur- und Kreativwirtschaft die Menschen mitunter in verheerenden prekarisierten Verhältnissen überleben; wie sie mit der so genannten weitergegebenen Unsicherheit leben müssen; wie sehr der Zwang, die neoliberale Charaktermaske aufzusetzen, bereits einige Robinsons übermannt hat, diese Strukturen in ihren Betrieb aufzunehmen; wie sehr die Werkvertrags- und Aushilfsbasis das widerspiegelt; wie manche mitunter ihre Arbeitskraft kostenlos anbieten, nur um weiterhin im Gespräch zu bleiben; wie oft Löhne am Ende des Abends gedrückt oder nicht ausbezahlt werden; wie oft man auf Abruf arbeitet und unverhofft heimgeschickt wird, wenn zu wenige zahlende Gäste da waren.
Ein Liberaler kann also nicht glaubhaft erklären, warum bestimmte Hypes von heut auf morgen entstehen und wiederum vergehen. Er versteht nicht die Dramen, die sich hinter einem Erfolgsversuch verbergen; den täglichen Überlebenskampf, den Druck, im Gespräch zu bleiben, sich jederzeit neu erfinden zu müssen. Aber auch nicht die Dramen, wenn der Erfolg trotz harter Arbeit einfach nicht eintreten will.
Weshalb die Prekarisierung im Kulturbetrieb, die sexy Armut, nichts anderes ist, als die real gewordene Perversion des liberalen Arbeitsfetischs: »Robinson und der Arschtritt der Gesellschaft.«
Literatur
MEW 4 (1971), MARX, Karl: Beilagen zu Karl Marx, Das Elend der
Philosophie: Brief an P. W. Annenkow, S. 547 – 557.
MEW 13 (1971), MARX, Karl: Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, S. 615 – 642.
MEW 23 (1962), ders: Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, in: Das Kapital, Erster Band, Berlin, S. 741 - 791.
MEW 26.2 (1974): ders: Theorien über den Mehrwert, Berlin.
MEW 35 (1978), ENGELS, Friedrich: Ergänzung und Nachtrag zum III. Buche des »Kapital«, Berlin, S. 895 - 919.
MEW 40 (1983), MARX, Karl: Privateigentum und Kommunismus, in: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Berlin, S. 510 - 546.
MEW 42 (1974): ders: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin.
ARENDT, Hannah (1981): Vita Activa oder vom tätigen Leben, München.
BÜTTNER, Hans-Peter, Die Nutzlosigkeit der neoklassischen Nutzenlehre. Eine Kritik der Grundlagen der subjektiven Werttheorie, Rote Ruhr Uni,
http://www.rote-ruhr-uni.com/cms/IMG/pdf/Buttner_Die_Nutzlosigkeit_der_neoklassischen_Nutzenlehre.pdf
ELBE, Ingo: Soziale Form und Geschichte, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2/2010, Berlin, S. 221 – 240.
FOUCAULT, MIchel (2006): Sicherheit, Territorium, Bevölkerung in: Geschichte der Gouvernementalität 1, Frankfurt am Main, Vorlesung 4, S. 134 - 172.
GESS, Christopher (2005): Kritik der Humankapitaltheorie, in: Kritiknetz – Zeitschrift für Kritische Theorie der Gesellschaft, https://psychosputnik.wordpress.com/2016/05/06/13937/
HEGEL, G.W.F. (1986): Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke 7, Frankfurt am Main, § 244.
HEINRICH, Michael: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx
in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 123, 31.Jg., 2001, Nr.2, S.151-176, hier: http://www.oekonomiekritik.de/306Monetaere-Werttheorie.htm
HEINRICH, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung, Stuttgart.
KANT, Immanuel (1977): Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Werkausgabe Band XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1, Frankfurt am Main, S. 33 – 50.
METZGER, Philipp: Werttheorie des Postoperaismus. Eine Kritik an der postoperaistischen Interpretation des Marx’schen Wertgesetzes, in: PHASE 2, Zeitschrift gegen die Realität, http://phase-zwei.org/hefte/artikel/werttheorie-des-postoperaismus-63/
PFREUNDSCHUH, Wolfram: Grenznutzentheorie,
http://kulturkritik.net/begriffe/begr_txt.php?lex=grenznutzentheorie
POSTONE, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, Freiburg.
RICARDO, David (2006): Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung, Marburg.
SMITH, Adam (1999): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, München.
0 notes
Text

2 notes
·
View notes
Text

Geschichte und Theorie des Flüchtigen
1.
Welche Rolle spielen Bilder für das Flüchtige? Die bild- und rechtswissenschaftlicher Sicht stellt diese Frage auch als Frage nach den Kulturtechniken, also als Frage danach, was unterhalb der Schwelle von Recht und Gesetz liegt und trotz allem bei der Reproduktion von Recht und Gesetz kooperiert. Die Kooperation soll widerständig und insistierend sein, mit Affirmation und Negation einhergehen können. Der Mörder kooperiert, sein Anwalt, sein Richter und sein Henker auch. Kooperation muss nicht intentional getragen sein, das Tragen/ Trachten kann in viele Richtungen gerichtet sein.
Welche Rolle spielen Bilder im und für das Recht der Flüchtlinge? Die Frage nach den Kulturtechniken lässt sich auch als Frage nach dem Wissen stellen. Die Frage nach dem Wissen lässt sich wiederum auch nach der Wahrnehmung stellen und die Frage nach der Wahrnehmung als die nach den Sinnen und die wiederum als Frage nach den Gefühlen. Das Wissen ist sinnhaft und sinnlich. Das Wort Wissen ist dem Wort vis verwandt, das wiederum als Kraft oder Sichtbares d.h. Wahrnehmbares oder sinnlich Eindrückliches, als Blickbares, aber auch als Tragendes oder Trachtendes verstanden werden kann.
Klingt und liest sich relativ kurz und knapp. Um das, was ich gerade geschrieben habe, haben sich längere und exzessivere Auseinandersetzungen abgespielt.
Wenn Wissen und Gefühle vom Selben durchzogen sind, soll man dann das Wissen als Oberbegriff verstehen und das Gefühl nicht mehr im Oberbegriff vorkommen lassen, dafür aber noch im Unterbegriff Gefühle und damit das Gefühl als unteres oder minderes Wissen, nicht vollständig allgemeines Wissen dem Oberbegriff und dem allgemeinen Wissen unterstellen? Wird gemacht, wurde gemacht, aber soll das auch weiter gemacht werden? Das ist eine Frage die sich stellt und deren Antwort eine gewisse Antwort sein sollte, wie andere zum Beispiel ein gewisser Herr Müller sind: Form steht fest, die Relation rührt sich aber und wir uns mit. Ich denke, dass darum vague Assoziationen eine Herauforderung sind (darum arbeite ich auch zu Warburg und behaupte, er sei Rechtswissenschaftler).
Gibt es dann ein allgemeines, oberes Wissen, dass ohne Gefühl, ohne sinnlichen Eindruck oder Affektion, ohne Passion möglich ist? Das ist umstritten. Man kann in so einem Streit historische Episoden ausmachen und dann in diesen Episoden Positonen, Stellungnahmen markieren - etwa überlegen, welche Position Kant ode Arendt hier einnimmt. Aber ich denke, dass solche historischen Episoden übersetzt sind und übersetzt werden.
2.
Unterscheidungen, die Kant macht, macht Kant aus Übersetzungen heraus - und schon in Kommenaren zu Kant werden solche Unterscheidungn übersetzt.
Normativität, von der ich denke, dass sie Effekt operationalisierter Differenz ist, ist in dem Sinne historisch die Geschichte von Unterscheidungen, die übersetzt sind und übersetzt werden. Normatvität ist historisch die Geschichte von 'Scheidekünsten' (Ihering). Normativität ist historisch die Geschichte von Trennungen, die übersetzt sind und übersetzt werden. Normativität begreife ich insofern als Symbolisches, also als dasjenige, was durch Distanzschaffen reproduziert wird und seine Effekte, das, was auch missverständlich Macht genannt wird, als Trennungmacht entfaltet. Insofern glaube ich auch, dass Thoms Duves Begriff der Multinormativität gut ist, weil er auf etwas Historisches aufmerksam macht, unter anderem darauf, dass Normen immer multiple vorkommen, dass also auch Normativät ohne expliziten Zusatz immer schon multiple, vielfach, vervielfältigt ist und durch Reproduktion vorkommt. Aus gleichen Gründen finde ich Auers Begriff der Multidisziplinarität gut. Beides verleitet mich hoffentlich nicht dazu, zu glauben, dass irgendeine Disziplin rein und unreproduziert, unvermittelt und unübersetzt vorkäme. Dass es eine reine Rechtslehre gibt, das lässt sich zwar nicht bestreiten. Dass sie durch etwas vorkommt, was kein Recht ist, nämlich zum Beispiel durch ein Buch, durch Papier und Druckerschwärze, durch Bibliotheken, die mit viel Geld Bücher trocken und im Licht lesbar halten, das kann man auch nicht bestreiten. Man kann ja nicht einmal bestreiten, dass Kelsen das Widersprüchliche in der Lehre auffängt und in einer Norm, die fiktiv sein soll, grundlegend einfangen will - und dies im historisch nicht gelingen sollte.
3.
Eine Theorie der Normativität, auch jener Normativität, die Recht genannt wird, ist meiner Ansicht nach eine Theorie der Operationalisierung von Differenz. Solche Operationalisierung verstehe ich als Technik und nenne sie im Anschluss an Vismann Kulturtechniken. Warum nicht Rechtstechniken?
Warum nicht bloß Techniken? Das sind gute Frage. Man könnte sagen, dass ich davonausgehe, dass die Bezeichnung von etwas als Recht doch schon Effekt einer Unterscheidung ist, das Recht also schon übersetzt ist und das insoweit der Begriff der Kulturtechnik weiter oder allgemeiner gefasst wäre. Kein schlechtes Argument, denn das stimmt scheinbar, aber nicht so ganz. Denn warum soll Kultur allgemeiner sein als Recht?
Das gilt auch für den Begriff der Kulturtechnik, denn der Begriff der Kultur ist auch unterschieden und übersetzt. Weiter lässt sich einwenden, dass er tautologisch wäre, weil es keine Kultur ohne Technik gäbe und keine Technik ohne Kultur. Der Begriff der Technik ist schon Folge einer Unterscheidung und er ist übersetzt. Das ist alles richtig, nicht ganz richtig (nur differenztheoretisch richtend) - und ganz wunderbar schon durchdacht worden, bevor ich mir die Wissenschaft und Denken 'eingebrockt' habe. Im meinen Studienjahren war es unter anderem die Systemtheorie mit ihrem Umgang mit Selbstreferenz oder aber Michel Foucault (also sehr unterschiedliche Positionen) mit seinem Aufsatz über das Denken des Außen, das waren rechtswissenschaftlichen Autoren wie Gunther Teubner, Karl-Heinz Ladeur und Thomas Vesting und die Autorin Cornelia Vismann, die das alle schon durchdacht und auf eine Weise aufbereitet haben, dass ich das wie einen Apparat aufgreifen kann um den Fragen nachzugehen, die sich mir stellen. Komischer Apparat.
Das heißt zum Beispiel: Selbstreferenz kann nicht geleugnet werden, auf der Diganose kann man sich aber nicht ausruhen, weil Selbstreferenz nicht selbstgenügsam ist und keine stille, keine gestillte Referenz ist.
Selbstreferenz ist die Hälfte jener Referenz, deren andere Hälfte die Fremdreferenz ist und die weder eine totale noch absolute, keine garantierte und keine feststehende, keine fundamentale Referenz ist. Selbstreferenz ist Halbreferenz, eventuell so, wie Nietzsche vom Halbgeschriebenen schreibt. Das ist Referenz im Austausch, im Wechsel, in der Verwechslung. Daraus versuche ich Differenzierung oder Ausdifferenzierng nicht zu widerlegen, sondern der Unruhe der Differenzierung nachzugehen, zum Beispiel ihrer Unbeständigkeit oder ihrer Polarität.
Das Objekt, das als Bild auftaucht, das hat eine Geschichte, dazu gibt es Theorie, die aus rechtlicher Sicht mit der Unruhe, dem Unbeständigen, dem Bewegenden assoziert werden, vor allem seitdem das Recht auch an die Monotheistischen Religionen und an Formen großer Trennung wie etwa der mosaischen Unterscheidung oder der parmenidischen Unterscheidung geraten ist. Seitdem das Recht selbst monoreferentiell gedacht wird (und freilich darin bestritten wird) spielt auch Bilderstreit eine der Auseinandersetzungen, für die ich mit grundsätzlich - und in gewisser Hinsicht maßlos interessiere. Einseits will nicht widerlegen, dass das Recht irgendwann mit etwas angefangen hat, will mich damit aber auchnicht begnügen. Anfänge tauchen nämlich sebst wiederum als Bilder auf, als Gründungsszene etwas, als Mythos, als Geschichte vom Bismarckfall zum Beispiel.
3.
Der Flüchtling ist das fleischgewordenen, das menschgewordene Flüchtige, das personifizierte Flüchtige und das subjektivierte Flüchtige, das verkörperte Flüchtige und das geisternde Flüchtige.
Das Foto, das ich oben zeige, habe ich von der documenta 14, dort taucht das Flüchtige auch mit Flüchtlingen auf - und mit flüchtigen Medien, nämlich unter anderem dem Bild, das Foto ist, den Bildern, die Sprachbilder sind oder den Begriffen, die nach Kant leer oder blind sein können, aber nicht leer und nicht blind sein müssen.
Um der Leere und der Blindheit zu entgehen, brauchen nach Kant Gedanken einen Inhalt. Kant setzt hier vermutlich die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt ein und legt nahe, dass der Gedanke ohne Inhalt eine Form sei und die Form etwas Inhaltsloses sein könne, etwas bloßes und Äußeres oder Äußerliches, dafür aber etwas Wahrnehmbares. Anschauungen können nach Kant blind sein. Obwohl man (vermutlich durch das Schauen und/ oder Hinschauen) anschaut soll man immer noch blind dabei sein. Die Anschauung kann in dem Sinne blendend sein, die Form kann sich blendend zeigen. Das etwas blenden aussieht, muss nicht schlecht sein, kann fantastisch sein - kann aber auch pouvoir sein, normativ, operationalisierte Differenz, Trennung des Sichtbaren vom Unsichtbaren und Einrichtung und Ausrichtung beider. Man muss Kant lesen, interpretieren, kommentieren - und dabei zum Beispiel tun, was Foucault tat.
Kant berücksichtigt Unbeständigkeit, er berücksichtigt auch das Flüchtige , aber noch in der Kritik der Urteilskraft erscheint das Unbeständige und Flüchtige nicht als Ideal, nicht in Form des Gesetz, nicht als Ziel seines Denkens. Dass Kritik eine Technik sei, zu kreisen oder zu kreischen, also auch Krach zu erzeugen, das steht bei Kant nicht, schon darum nicht, weil er Kritik nicht einsetzt, um zu Querulieren oder Krach zu machen. Muss er auch nicht.
Will, muss oder soll man das aber, dann sollte man vielleicht lieber Kleist als Kant lesen, um sich darauf vorzubereiten, was das Unbeständige und Flüchtige macht, auch mit einem macht (was etwa die Verzettelung mit einem macht und wie die Verzettelung einen noch dann verschluckt, wenn man am Schluss des Zettel schluckt, wie Kohlhaas das macht.)
Das Unbeständige und Flüchtige bietet bei Kant keine frohe Botschaft, man kann grob und plump sagen: darum lasse er das lieber weg. Das bietet bei Kleist alles anderes als frohe Botschaften, so bricht das Unbeständige und Flüchtige Kleists in einem Satz, der vor allem gemein, brutal und kurz ist (nasty, brutish and....short), sowohl aus als auch ab, sowohl ab als auch aus. Das Flüchtige bricht ab, aber es verflüchtigt sich damit nicht vollständig, bricht nicht nur ab, sondern auch aus. Das Flüchtige spitzt sich mörderisch zu, blödes Bild, denn der Mord hat weder Spitze noch Stufenbau, der skaliert nur als Eskalation. Kleist war ein eher verweifelter Kantleser, vielleicht sogar ein an Kant und durch Kant verzweifelnder Leser.
4.
Das Foto von der documenta tauchte dort im Zusamenhang mit einem berühmten Text von Hanna Arendt auf.
Der trägt den Titel We Refugees. Das englische Wort ist gegenüber dem deutschen Wort anders. Zum den Fugees (die aus auch gibt) kommt der Zusatz Re, wie in Reproduktion zum Beispiel. Der Titel von Arendt reproduziert sowieso etwas, denn er ist geschrieben und gedruckt, Arendt schreibt und 'spricht' - das ist Reproduktion.
Dazu kommt aber, dass der Titel assoziiert. Der Text ist zuerst in Amerika, m.E. in New York veröffentlicht worden. Es ist möglich, dass ein Leser den Titel We Refugees mit We the people assoziiert und dann fragt, warum Arendt denn nicht We the Refugees oder gleich We the people geschrieben hat. Arendt operationalisiert Differenz und tilgt oder löscht sie nicht. Arendt arbeitete an Diferenz und Wiederholung, sie kreist, durchaus auch mimetisch im Sinne von Gabriel de Tarde, weil sie eine politische Mainfestation imitiert, die wohl jeder Amerikaner kennt. Diese Mimesis ist aber nicht perfekt, sie ist unperfekt und imperfekt, sie ist unvollendet und...wie soll man das sagen: vergangen? Begangen? In Geschichte befangen? Im Vergehen? Ein Vergehen? Arendt opereriert mimetisch im Verstoß des Mimetischen. Der Titel ist schon flüchtig geschrieben. Man kann Arendts Schreiben meisterlich nennen, wenn es der Begeisterung dient, warum nich, ein Lob kann auch schräg sein und schräge Bilder verwenden, solange es dem Lob dient. Ist Arendts Titel ohne Artikel, ohne the, unbestimmter oder leerer, als er mit Artikel wäre? Das glaube ich nicht. Er ist freigesetzter, frei gesetzer.
Das Flüchtige bringt Arendt anfänglich und prinzipiell ins Spiel - und nicht, um es aufzulösen. Was ein Maifest oder eine Manifestion sein soll, wenn ein konstitutiver Satz, ein deklartiver Satz, was eine Verfassung sein soll, wie Kulturtechniken des Verfassens operieren sollen, das variiert schon dieser Titel.
5.
Es gibt Rechtswissenschaftler, die behaupten, das Rechtswissenschaft entweder systematisch wäre oder sie wäre nicht. I object, legally blonde (je suis Elle Woods)! I, Robot, arbeite daran, я работаю над этим .
Diese Behauptung ist mit Hilfe der parmenidischen Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein getroffen. Ich behaupte das nicht, schon weil zur Geschichte des Rechts nicht nur der Parmenides gekommen ist, sondern auch Hamlet, oder wie es bei den Muppets dann ist: Humpty Dumpty, the lead of Shakespeares Omlett. Rechtswissenschaft ist nicht nur Systemwissenschaft, ist nicht nur systematisch. Sie ist auch ab ovo, aus dem Ei, auch eiernd, auch gebrochen, auch gerührt. Das System und das Systematische muss man nicht widerlegen. Aber man kann an anderem als am System und am Systematischen arbeiten, schon weil viele deutsche Rechtswissenschaftler am System und systematisch arbeiten.
Man muss nicht systemsprengend arbeiten, weil man dazu systematisch oder am System arbeiten müsste und das nicht muss, weil es bereits so viele tun - und dabei dauernd etwas brechen. In meiner Perspektive ist Rechtswissenschaft nicht unbedingt systematisch, aber unbedingt technisch. Sie ist nicht unbedingt rechtmäßig oder legal, nicht unbedingt staatlich, nicht einmal unbedingt öffentlich. Wenn einem etwas fehlt, wenn das System fehlt, dann kann man statt systematisch zu arbeiten exemplarisch oder historisch, vergleichend oder kasuistisch, episodisch oder 'phasenweise', mit Weisheit für Phasen arbeiten. Zur Theorie des Flüchtigen kann man flüchtig arbeiten, was zwar gegen das Dogma der großen Trennung verstoßen kann, aber nicht muss - und neben dem Dogma gibt es immer auch normative Techniken, sogar noch andere Dogmen. Die Anthropofagie etwa folgt dem Dogma des Verzehrens (auf eine Weise, in der Subjekt und Objekt wechseln können).
3 notes
·
View notes
Text

Vom Scheiden
Was soll man vom Recht halten? Ob das Recht überhaupt haltbar ist, das steht in Frage.
Darauf einen an der Bar, Trinkaus!
0 notes
Text

Geschichte, Theorie und Paris des Flüchtigen
1.
Paris, London? Hauptsache praktisch! Nanu, man kann das Flüchtige nicht abschieben.
2.
Das hohe Gericht in London hat heute entschieden, richtig entschieden. Flüchtlinge (egal woher) nicht egal wohin, sondern direkt in ein Land mit Verheerungen abzuschieben löst nicht das Problem - und kann eine politische und rechtliche Lösung sein, aber keine auf Grundlage der Menschenrechte. Man kann rechtlich und politische die Menschenrechte verheeren, tun die Leute ja. Aber man muss es nicht tun, man könnte es nicht tun, sollte es nicht tun. Wenn man nicht abschiebt, könnte das die Leute verheeren, darauf weist Eduard Buzila in seiner laufenden Arbeit zum Gewühle und Gefühle von Hannah Arendts Theorie des Flüchtings hin. Wenn man sie doch abschiebt, könnte auch dies die Leute verheeren. Heerscharen von Juristen arbeiten daran, andere Heerscharen auch. Herrenmenschen viele, am Rheine und am Nile.
Flüchtlingsrecht ist flüchtiges Recht, ärgerliches Recht, beunruhigendes und unruhiges Recht. Wenn man das los werden will, kann man es. Je stärker man das los werden will, desto stärker könnte die Unruhe werden. Das ist eine Maßgabe aus Aby Warburgs Bild- und Rechtswissenschaft.
MultipliCity, CompliCity! Da sagt Auer, Direktorin von our house: face it! Don't escape it, if you let it haunt, it will haunt you. Let it, it may be.
3.
Nanu, plötzlich scheint es einem, dass es nicht gelingt, Leute, die nicht abgeschreckt sind, weil jeder Schrecken sie verfolgt, jeder Schrecken in ihnen steckt und sie ihn schon so durchgegangen sind, wie er sie, abzuschrecken. Die Flüchtigen vom Ausland werden nicht abgeschreckt. Die Flüchtigen im Inland werden nicht abgeschreckt. 2017 habe ich für die SPD Wahlkamp in Niederrad gemacht, SPD-Hochburg, es war einmal. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Damals, das ist schon 6 Jahre her, erklärten ungefähr 30% der Leute, die mit uns sprachen, das sie jetzt AfD wählen. Als die Kandidatin sagte, dass sie dann Nazis wählen würden, sagten von denen 100%: Dann bin ich ein Nazi. Das war damals schon selbstverständlich, so war schon Trump angetreten. Die Verkehrung ins Gegenteil läuft, sowieso, schon lange, die schulden wir keinem, die machen wir mit, so oder so. Ich bin ratlos, ziemlich ratlos. Aber Expertise habe ich für das Kreisen, und da einen Tipp: Vertrauen und Kredit sollte man können, man sollte das Trauen lingen lassen, nicht gleich gklingen lassen. Man sollte Kredit lingen lassen, nicht gleich gelingen lassen. Die Suppe kocht, wir schwimmen drin. Alles soll man mitmachen können, zur Not auch die Flucht. Wenn es hier zu schlimm wird, dann Flucht, es wird nicht die erste sein und die letzte sein, die man macht, denn vom Flüchtigen weiß man nur flüchtig, soweit man auch flüchtig sein kann. Nichts ist zu retten: Kein einzelner, kein Volk, kein Land. Wenn die AfD nicht an die Macht kommt, sollten die, die darin ihre Rettung und Erlösung sehen flüchtig werden. Wenn sie an die Macht kommt, sollten alle anderen, die im Anderen die Rettung und Erlösung sehen, flüchtig werden. Nichts ist zu erlösen, kein einzelner, kein Volk, kein Land. Keine Macht niemandem hinter Dir, über Dir, unter Dir. Kein Gott. Kein Meister. Keinen, der nicht tanzt.
4.
Am einfachsten von allem Schweren ist Hilfe, vor allem mutual, auch mute. Der Anarchismus ist zwar das einfachste, aber auch den muss man können, soll man können, könnte man können.
Man braucht nicht Rechtswissenschaft studieren, um durchgehend und umfassend etwas vom Recht zu wissen. Man kann das tun, soll das können, könnte das können: könnte das Recht studieren. Normativität ist Konjunktivität, das Gerücht ist das normative Material schlechthin. Man hat flüchtig von gehört.
1 note
·
View note
Text
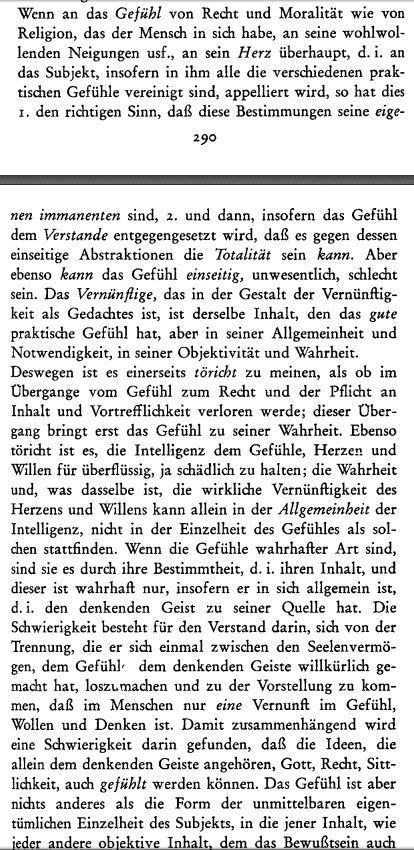
Flüchtig
Flüchtig ist, was Flucht hat, eine Fuge oder eine Fügung zum Beispiel. Was ist Hegels Flucht im Umgang mit dem Willen? Neben Kant, der eine Referenz in der Literatur zum Rechtsgefühl ist, ist Hegel eine andere Referenz.
1 note
·
View note
Text

Polarforschung
1.
Weil Warburg sich mit den beiden Staatstafeln schließlich auch auf das Verhältnis zwischen Bild- und Rechtswissenschaften einlässt, bieten diese Tafeln mit ihren Verhäkelungen in den Rest dieses Atlas gleich eine Reihe von Gelegenheiten: Man kann noch einmal fragen, ob dasjenige, was Warburg Nachleben nennt, nicht nur in solchen (hochentwickelten) Objekten wie Bildern sitzt, sondern ob es auch in schwächeren Dingen und Routinen sitzt: Vielleicht sitzt das Nachleben schon in den Falten der Gesandten, in den diplomatischen Kniebeugen und den Tabellen der Schreiber? These: Schon in den Wellen der Tischdecke, die man auf Tafel 78 während der Unterzeichnung der Lateranverträge sieht, lebt Antike nach. Insoweit kann man Ideen von Georges Didi- Hubermann zur Tafel, von Thomas Hensel zu Tischen und von Fabian Winter zu Warburgs bürokratischem Schreiben aufgreifen und weitertreiben. Man kann sagen, dass in den beiden Staatstafeln Antike in Form römischer Kanzleikultur nachlebt. Amts- und Bürokalender wie der Chronograph 354 oder Akten oder Formulare wie die notitia dignitatum geistern insoweit als Vorbilder der beiden Tafel, die heute den Schluß des Atlas markieren und auf denen sich Warburg mit der Restitution einer alten römischen Idee, nämlich der Idee vom Kirchenstaat, befasst.
Dabei fängt das, was man sonst Methode und Technik nennt, schon in gemeinen Routinen und in einem simplen Treiben an, das wenig vom Glanz einer großen Trennung oder auch nur von der Beharrlichkeit einer black box verspricht. Was dann viel später in Gesetzgebung oder Bildgebung, in Staatenbildung, Verkörperung und Subjektivierung mündet und seine Klassifikationen auch auf eine große Trennung stützt, beginnt schon bei delikateren Klassifikationen. Distanzschaffen findet schon da statt, wo eine Distanz noch nicht und nie geschafft, dafür aber immer schon sortiert wird und jeden Tag Gestelle geschoben werden. Schon das Nöseln, also auch jenes unprofessionelle Begehren, das Profis seit Ende des 18. Jahrhunderts abwertend Querulieren nennen, gehört zu den Operationen, auf die sich dann später Bilder so stützen können wie Staaten und Personen so wie Gesetze. So sitzt Nachleben nicht nur im Bild und nicht nur in der Bildgebung, sondern auch in niederen, verwaltenden, auch juridischen Kulturtechniken.
2.
Es gibt einen Zweig, in dem die Geschichte und Theorie des Bildes nicht auf die Linie, den graphischen Akt, die Fläche und die Figur, vor allem auch nicht auf den Ersatz von Leere oder Abwesenheit hinausläuft. Warburg legt solche Verläufe im Atlas zahlreich an. Seine Bildgeschichte beginnt dort mit Stöcken, Kugeln, mit Wellen, mit meteorologisch so flüchtigen wie wiederkehrenden Erscheinungen (Wolken und Blitzen) und immer wieder mit Schlangen, mit lauter polaren und vagen Wesen und Dingen.
Warburg operiert im Atlas mit Bildern, darum ist das, wo etwas durchrauscht, bei ihm auch Bild. Aber die Bildgebung beginnt schon da, wo etwas durch den Blick und seine Winkel, durch das Dämmern rauscht und in Licht, Blick und Bild nicht aufhört, zu rauschen. Es gibt im Atlas eine Geschichte und Theorie des Bildes, in der die üblichen Urbilder, etwas der scharfe Schatten oder die auf einer glatten Fläche gezogene Umrißlinie einer abwesenden Liebe, die Figur eines entfernten Gottes oder die Tafel eines abwesenden Herrschers nicht auftauchen. Nüsse, Kiesel und Stäbe gehören zu den ältesten Urahnen der Bildgeschichte, die nicht mit Vorbildern beginnt, sondern mit Polobjekten. Diese Geschichte des Bilde hebt nicht mit dem Versuch an, etwas abzubilden und eine Leere zu überbrücken. Sie beginnt damit, etwas zu drehen , zu (ver-)kehren und zu verzehren. Das Nachleben, das sitzt dementsprechend schon in den einfachsten Protokollen: nicht erst in dem, was ein Bild sein soll (und so immer schon über Positionen im Bilderstreit einen Status des Bildes gesichert hat).
3.
Die Frage läuft auch auf eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Rechts hinaus. Warburg bietet Gelegenheit, noch einmal das Recht von seinen juridischen Kulturtechniken her zu beschreiben, also von den Vorgängen her, mit denen Differenzen operationalisiert werden und für die Juristen keine Urheberschaft und keine eigenes Wissen reklamieren können, obwoh sie selbst historisch ihr Selbstverständnis vielleicht auch einmal auf solche Vorgänge stützen. Aber andere machen es ja auch, vor allem auch, um etwas anderes als Recht zu bekommen.
Georges Didi-Huberman hat in seiner Deutung von Warburgs Tafeln an die Nähe zwischen Warburg und eine der Figuren der Kulturtechnikforschung, nämlich Leroi-Gourhan erinnert: Wie die Bildgeschichte schon mit Nüssen und die Tafelgeschichte mit Laub beginnt, beginnt die Geschichte des Juridismus nicht mit dem Begriff und dem Wort. Sie beginnt auch mit Nüssen und Laub, auch mit Wellen und auch mit Schlangen, auch mit einem Himmel, der sich dreht und in dessen Drehung man etwas und noch etwas von sich selbst assoziiert.
Wie schon in Bezug auf das Bild kann man in Bezug auf dasjenige, was Recht reproduziert, bei den einfachsten Techniken, gleich bei den Routinen und bei einem alltäglichen Treiben ansetzen. Die sind so einfach, dass man von ihnen sowohl sagen kann, sie seien die abstraktesten Mittel, als auch sagen kann, sie seien die konkretesten Mittel. Sie entziehen sich keiner Trennung, aber jeder großen Trennung. Nicht erst, wenn es darum geht, Aussagen zu systematisieren, sondern schon dann, wenn etwas über den Tisch gezogen wird, wenn etwas gebeugt oder gefaltet wird, dann ist ein Protokoll im Spiel und Protokollieren ist eine solche juridische Kulturtechnik, die noch mit wenig Raffinesse als Routine und Treiben vorkommt. Bis in das Kommentieren hinein (eine schon höhere juridische Kulturtechnik) läuft dabei etwas von dem schlicht schlüpfrigen oder unfassbaren Nachleben der Antike mit, vielleicht 'nur' eine sedimentäre Geschichte und nur etwas von dem Bodensatz der Gründe, die bis heute die Idee von der Vorsprünglichkeit der Gesellschaften mittragen.
4.
Wenn, wie vor wenigen Jahren mal jemand geschrieben hat, der Kern normativer Praktiken die Abstandnahme ist und diese Abstandnahme auch über das läuft, was Warburg Distanzschaffen nennt, dann gehören die Bilder aka Polobjekte zu einer Geschichte und Theorie des Rechts, von dem man auf den Staatstafeln etwas erfährt.
0 notes