#wir haben schon immer im Schloss gelebt
Text
Shirley Jackson - Wir haben schon immer im Schloss gelebt

Inhalt:
Merricat Blackwood lebt in einer Traumwelt. Schlafwandlerisch bewegt sie sich jeden Tag durch duftende Blumenwiesen, hin zu rauschenden Wassern und flüsternd durch verlassene Räume im Schloss, in dem sie und ihre Familie schon immer lebten.
Zusammen mit ihrer über alles geliebten Schwester Constance und ihrem schrulligen Onkel Julian träumt sie in den Tag hinein. Alles wäre so perfekt, wären da nicht die anderen.
Die Dorfbewohner, die um das Schloss herum wohnen.
Die Dorfbewohner, die sie hassen.
Die Dorfbewohner, die es am liebsten hätten, wenn sie alle drei verschwinden würden.
Für immer.
„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ erschien 1962 und war der letzte Roman von Shirley Jackson, die drei Jahre später im Alter von nur 49 Jahren verstarb. Ins Deutsche übersetzt wurde die Geschichte erstmals 1988.

Meinung:
1962 erschien Shirley Jacksons Roman „Wir haben schon immer im Schloss
gelebt“, der als das beste und reifste Werk der Autorin gilt. Obwohl Shirley Jackson in Amerika als „Queen of Horror“ gefeiert wird, ist die Geschichte eher dem Mystery- oder Suspense-Genre zuzuordnen. Der Roman handelt von den Schwestern Mary Katherine „Merricat“ und Constance Blackwood und deren Onkel, die gemeinsam in einem riesigen Familienanwesen abseits eines Ortes leben. Die jüngere Merricat ist die Protagonistin des Werks und erzählt die Geschichte aus der Ich- Perspektive.
Der Roman beginnt mit einer kurzen Vorstellung Merricats, in der bereits klar wird, dass es sich hier um eine junge Frau handelt, die eine verstörende Sicht auf die Welt hat und sich fernab von gesellschaftlichen Normen bewegt. Nach dieser eindrucksvollen Einführung in den Roman entspinnt sich eine erschütternde, düstere Familiengeschichte, die tief in die Psyche Merricats blicken lässt, obwohl diese dem Leser oft rätselhaft und wenig greifbar erscheint. Selbst bedeutsame Ereignisse werden häufig nur angedeutet; nie wird geklärt, was die junge Frau antreibt, eben jene Dinge zu tun, die das Leben ihrer Mitmenschen so stark beeinflusst.
In diesem Spätwerk zeigt Shirley Jackson umso eindrücklicher ihre Gabe einzigartige, skurrile und zugleich glaubwürdige Charaktere zu kreieren. Die drei verbliebenen Blackwoods leben ein Leben, das so surreal anmutet, befolgen Regeln, die dem Leser völlig irrsinnig erscheinen und trotzdem ist ihr Alltag glaubhaft und man vermag sich nicht dem Sog entziehen, den diese Geschichte ausübt. Man lernt die Welt dieser besonderen Familie zu verstehen und erwischt sich spätestens nach 100 Seiten dabei, dass man klar Stellung bezieht; der Leser beginnt, ähnlich wie Merricat, jegliche Eindringlinge argwöhnisch zu betrachten. Die „gesellschaftliche Norm“ wird zum Feind, die das idyllische Leben ins Wanken bringt.
Der Roman schafft es bis zuletzt eine innere Spannung aufrecht zu erhalten. Zu Beginn sind es noch die Blackwood-Schwestern, von denen ein unerklärliches Unheil auszugehen scheint, später ändert sich die Perspektive, doch diese Enge in der Brust, die einem schier die Luft abschnürt, bleibt.
„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ ist ein Roman, der einerseits verstörend ist, andererseits nachhaltig im Gedächtnis bleibt, zum Nachdenken anregt und Fragen über die menschliche Psyche, über Normalität und Wahnsinn aufwirft, die nicht so leicht zu beantworten sind. Skurril und schauderhaft, aber auch melancholisch und magisch schön.
Merricat wendet im Laufe der Geschichte mehrfach Analogiezauber an. Diese Art von Magie (auch Sympathiezauber genannt) geht davon aus, dass Verbindungen zwischen verschiedenen Dingen bestehen. Zum Beispiel vergräbt Merricat gehäuft verschiedenste Sachen auf dem Grundstück des Schlosses, um so die Zeit und Sicherheit des Moments zu konservieren und böses Denken, was diesem Ort schaden könnte, auszuschließen.
Text: Aki & Jongkind
Impressum: https://post-vom-buecherwurm.tumblr.com/post/620367072772407296/impressum
#book#books#reading#bookblog#bücher#bücherblog#bücherliebe#Bücherwurm#Bücherwelt#Buchrezension#buch#Buchempfehlung#Lesen#lesenswert#lesenbildet#Leseratte#Leseempfehlung#leseliebe#shirley jackson#wir haben schon immer im Schloss gelebt#roman
2 notes
·
View notes
Photo

6. Dezember
-------------------
.::Totenmeer::.
-------------------
„Ich bin ein Fisch und kein Ding. Ich bin jemand, der fühlt. Ich bin keine Frucht, sondern ein Tier. Ich bin nur für deine Ohren stumm, für meinesgleichen singe ich, wie die Wale. Ich kommuniziere mit Lauten, die du nicht hörst. Ich empfinde Schmerz und ich bin klug. Ich sehe die Welt in Farben, so wie du. Würden wir uns begegnen, könnte ich dein Gesicht von dem anderer Menschen unterscheiden. Wenn mir ein Mensch wehtut und seinen Haken in meinem Körper stecken lässt, bin ich klug genug zu wissen, dass ich zu einem deiner Art schwimmen muss, um mir helfen zu lassen.
Ich bin kein Ding, ich habe Persönlichkeit, wie jedes andere Tier auch. Du und ich, wir sind einander auf den ersten Blick nicht sehr ähnlich. Die Evolution hat dich weit von mir entfernt, aber irgendwo in deinem Kern, lebt noch ein Stück unserer gemeinsamen Entwicklungsgeschichte. Lass uns nicht aufzählen, worin wir uns unterscheiden, lass uns anschauen, was uns verbindet:
Wir sind beide Bewohner desselben Planeten und die Wiege des Lebens, der Ursprung aller Geschöpfe ruht in den Tiefen des Meeres. Mein Lebensraum ist es noch heute und irgendwo haben wir einen gemeinsamen Vorfahren. Alle Tiere – du bist auch ein Tier, wenn es nach der Biologie geht – haben irgendwo vor langer Zeit dieselben Ahnen. Wie du, so habe auch ich eine eigene Persönlichkeit. Es gibt immer Geschöpfe derselben Familie, derselben Art, derselben Gruppe, die sich von den anderen unterscheiden.
Ich zum Beispiel bin ein mutiger und tapferer Fisch. Ich bin aber auch aufmerksam. Ich sehe deinesgleichen oft, denn ihr habt Interesse an meinem Lebensraum. Dort, wo das Leben reich ist, taucht ihr Schuppenlosen häufig auf. Oft seid ihr so ungeschickt und zerstört das kostbare Zuhause eines meiner Artgenossen. Wir merken uns das. Wir erinnern uns. Es gibt Dinge, an die wir uns ein Leben lang erinnern. So wie ihr.
Ich will dir nun meine Geschichte erzählen, denn bevor ich aufmerksam war, war ich unachtsam und bevor ich mutig wurde, musste ich dem Tod ins Gesicht sehen. Das Leben hat mich tapfer gemacht, weil ich tapfer sein musste.
Ich habe in einem Schwarm gelebt. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommen konntest, dass wir nicht fühlen und nicht denken. Unser Zusammenleben im Schwarm ist komplex. Wir bewegen uns synchron, um uns und unsere Lieben zu beschützen. Unser Leben hängt davon ab, gemeinsam zu denken. Im Schwarm sind wir groß, ein einzelnes Leben ist schutzlos.
Ich war wie alle anderen, als sich die Gefahr über unseren Köpfen zusammen braute. Es war eines eurer Schiffe, die das Meer zu einem Friedhof machen. Ihr zerstört so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt.
Das Netz schloss uns ein. Ich war Teil eines riesigen Klumpens zusammengequetschten Lebens. Ich hatte das Gefühl, alles in mir würde bersten, unter dem Druck der Masse. Ich wusste nicht, wie mir geschieht und ich hatte Todesangst. Wir stiegen in Bereiche des Meeres, in denen ich mich eigentlich nicht bewege. Der Druck veränderte sich und tat vielen nicht gut. Als wir dann aus dem Wasser gezogen wurden, begann unser aller Todeskampf. Jeder von uns begann, zu ersticken. Ein Teil unserer Kiemen trocknet an der Luft aus und macht die Sauerstoffaufnahme danach unmöglich.
Stell dir vor, wie das ist, wenn Millionen gleichzeitig um Atem ringen und vergeblich um ihr Leben kämpfen. Todesangst. Panik. Du kämpfst mit deinen eigenen Qualen, aber um dich herum ist so viel Leid, dass du es unmöglich ignorieren kannst. Ganz gleich, wie sehr du selbst mit dem Tod ringst. Ich zappelte, wand mich, in endloser Verzweiflung und unter großen Schmerzen. Ich war wie von Sinnen und vielleicht gab mir das die Kraft, lange genug weiter zu machen, bis ich durch eine der Maschen im Netz rutschte und zurück ins Meer fiel.
Erst rührte ich mich nicht. Blicklos ruhten meine Augen auf dem Netz über mir, in dem meine Familie und meine Freunde gerade verendeten. Ein Teil von mir sah zu, der Rest driftete irgendwo zwischen leben und sterben dahin. Der Schock saß in meinem ganzen Körper und als sich in meinem Kreislauf wieder annähernd genug Sauerstoff befand, zuckte ich und schwamm in Panik davon.
Die Bilder von dem, was geschehen ist, verfolgen mich noch heute. Ich kann es nicht vergessen, das Massensterben. Zahllos, muss ich die Opfer nennen. Ich kann nicht greifen, wie viele es waren und es war nur ein Netz. Es war nur ein Schiff. Auf dem Meeren sind so viele von ihnen unterwegs. Sie plündern und zerstören, rauben und morden. Sie töten nicht nur meinesgleichen.
Irgendwann wird die Erde ersticken, unter der Grausamkeit dieser Monsterschiffe. Zurück bleiben die entsorgten Folternetze. Sie landen am Meeresgrund und in ihnen verfangen sich noch nach vielen Jahren weitere Meerestiere, die sinnlos und ungesehen sterben. Delfine und Wale ertrinken, wenn sie sich nicht befreien können. Weitere Tiere erdrosseln sich, oder verletzen sich, wenn sie sich zu befreien versuchen.
Landtiere werden betäubt, ehe sie getötet werden, aber weil ihr unsere Schreie nicht hört, glaubt ihr, dass wir nicht fühlen können. Wir müssen unsagbar leiden, bis wir erstickt sind, aber eure Tierschutzgesetze greifen nicht für uns. Fast die Hälfte der Meerestiere wird in euren Netzen gefangen, ohne dass ihr sie fangen wollt. Sie sind nur überflüssige Todesopfer, die ihr teilweise einfach wieder im Meer entsorgt. Ihr habt dadurch so viele Tierarten ausgerottet oder an den Rand des Aussterbens gebracht.
Die Meere verändern sich. Sie sterben schon so lange und ihr wacht nicht auf. Ihr schickt weiter eure großen Todesschiffe los, um alles um euch her in einen Friedhof zu verwandeln. Wohin auch immer diese Schiffe unterwegs sind, sie hinterlassen ewig dasselbe Bild. Ein Totenmeer.“
#fisch#fischfang#vegan#veganismus#veganism#tierrechte#animalrights#veganzitat#veganquote#tierleid#tierqual
2 notes
·
View notes
Photo

“ICH BIN ABER NICHT DEUTSCH”
| #StêrkaCiwan
Oktober 2019 |
Es ist kein Geheimnis, dass vielleicht die Hälfte der KurdInnen (oder auch mehr?) auf der Welt sich vor sich selbst schämen. Seit hundert Jahren versucht man uns KurdInnen zu vernichten. Dafür haben Staaten wie die Türkei, Irak, Iran, Syrien und westliche Staaten wie Deutschland, Großbritannien ihr bestes getan, damit wir noch heute nicht einmal unsere Sprache sprechen können, und uns schämen, wenn uns jemand fragt woher wir kommen…
Ich war nicht wirklich anders. War ich vielleicht sogar schlimmer als die meisten Jugendlichen? Als eine junge Frau, die in einem deutschen Kaff von Deutschen umgeben war, war es natürlich nicht einfach die eigene Identität zu verstehen, vor allem wenn man Eltern hatte, die keine Antworten hatten. „Kızım wir sind keine Kurden, wir sind Aleviten, die Kurden sind zurückgeblieben“, war eine der Antworten meiner Mutter, wenn sie mir erklärte woher wir stammen. „Anne, aber es gibt doch kein Alevitistan.“ Ein verzweifelter Versuch sich selbst zu verstehen. „Keça min, wir sind Kurden“, war die stolze und überzeugte Ansicht meines Vaters. Aber es gab leider auch kein Kurdistan. Zu mindestens nicht für mich, denn mir war diese Sache zu viel. Wer war ich? Da es in der Familie keine Antwort gab, antwortete der Staat. In der Schule nämlich lernte ich schnell, deutsch zu sein. Rasch beneidete ich Freundinnen wie Katrin, Nathalie und Lisa. Denn in ihrem Leben gab es kein Chaos, keine Krisen. Ihr größten Krisen waren, wenn sie zwei mal hintereinander die gleichen Klamotten anziehen mussten oder irgendein Junge sie verließ.
So zu sein wie sie, erschien mir immer eine Lösung. Es war ein so einfaches Leben. Ich ging freiwillig zur Kinder-Bibel-Woche, nannte mich manchmal halb Türkin und halb Kurdin, wenn jemand nach dem Ursprung meines kurdischen Namens fragte antwortete ich: „der kommt aus Mesopotamien“, um das Wort Kurdistan nicht benutzen zu müssen. Was hätte ich den sagen können, wenn jemand fragen würde wo Kurdistan sei, und warum es nicht auf der Landkarte existierte?
Manchmal sagt man über uns kurdische Jugendlichen aus Europa „Schokoladen-Kinder“, doch wir sind vielmehr als das. Wir sind die Kinder der amerikanischen Musik, der europäischen Mentalität, des verlorenen Kurdistans. Wir sind die Kinder mit tausenden Fragezeichen im Kopf. Wir sind die Jugendlichen, die nicht lernen konnten, wer sie wirklich sind. Deswegen habe ich es gehasst mit meinem Vater auf Kurdendemos zu gehen. Ich erinnere mich sogar, wie ich mich einmal versteckt habe, als ich an einer Demo in Frankfurt teilnahm und ich meine Schulfreundinnen erblickte. Ich habe gehasst, wer ich bin, ohne zu wissen wer ich bin.
Doch die Revolution in mir begann mit einer Aufnahme im kurdischen TV: Es waren stolze Frauen, mit Waffen in den Händen. Sie feierten die Erfolge in Rojava. Wer waren diese wunderschönen stolzen Frauen? Was war geschehen? Mein Vater erklärte mir die Lage in Rojava und ich war verblüfft. Ich hatte oft Bücher von Rêber APO bei uns zu Hause gesehen. Aber sie interessierten mich nie. Nun aber war ich perplex. Und zu dieser Zeit gab es jeden Tag in Frankfurt Demos für Kobanê. Diesmal war ich diejenige, die meinen Vater überzeugte zu gehen. Denn auf den Demos spürte ich diesen Zusammenhalt, diese Wärme und diese Stärke. Es gab Menschen, die gegen alle anderen für ihre Überzeugung kämpften. Also musste diese Überzeugung doch richtig sein, oder? Ich schloss langsam meine ersten kurdischen Freundschaften und nahm an den politischen Arbeiten teil. Auf ein: „Hallo, ich möchte bei euch mitmachen“, folgten lächelnde Gesichter.
Durch die politischen Arbeiten habe ich gelernt wo Bakur ist, wo Başûr, Rojava und Rojhilat sind. Ich lernte, dass ich nicht Tunceli sondern Dersîm sagen sollte, ich lernte, was das Patriarchat ist und fing an, die Broschüren Rêber APOs zu lesen. Besonders seine Thesen zur Freiheit der Frau waren besonders beeindruckend für mich. Auch während den schwierigsten Uni-Zeiten, Klausur-Phasen und Familienkrisen war die politische Arbeit keine Last – sondern eine Arbeit in der ich mich wiederfand, in der ich mich entwickeln und aus mir wachsen konnte. Und wenn von dem Zeitpunkt an jemand wagte mich als Deutsche zu betiteln, wusste ich meine Antwort: „Ich bin kurdische Alevitin, Kurdistan existiert nicht, weil u.a. der Staat, in dem ich lebe, dafür gesorgt hat, dass KurdInnen die brutalsten Genozide miterleben mussten. Kurdistan ist nun in vier geteilt. Doch es gibt eine Bewegung, die dafür kämpft, die Frauen zu befreien und zusammen mit einem freien Kurdistan einen freien, demokratischen Mittleres Osten zu schaffen: die PKK.“
Um diese Phase ein wenig zusammen zu fassen: Mich faszinierte die Genossenschaft, die nur ein Bruchteil von der Genossenschaft ist, die ich heute erlebe. Mich faszinierte es etwas für meine Überzeugungen tun zu können. Ich war endlich kein Wurm mehr, der lebt um gelebt zu haben, der so lebt wie andere, weil er es nicht anders weiß. Ich nahm aktiv am Leben teil, gestaltete es. So kam es, dass ich mich irgendwann dafür entschloss, auf den freien Bergen Kurdistans auf einer Bildung teilzunehmen. Ich wandte mich an einige GenossInnen und sagte, dass ich die Berge Kurdistans sehen möchte, um mich weiterbilden zu können.
Als grün eine neue Bedeutung gewann
Was ist sind schon Farben, wenn sie keine Bedeutung haben? Jedenfalls begann grün für mich an Bedeutung zu gewinnen. Ich kam in Kurdistan an. Wir wurden von einem Genossen mit dem Auto zu den freien Bergen Kurdistans gefahren. Was war das für eine Aussicht! Die Sonne ging in dem Moment auf, als wir uns dem ersten Guerilla-Stützpunkt näherten. Das grün, grau, braun, gelb der Berge färbte sich in schimmerndes rot. Und da war er, der erste Guerillakämpfer, den ich sah. Nicht nur mein Gesicht, auch mein Herz lächelte. Er grinste uns an: „Dembaş.“ Was er danach sagte verstand ich natürlich nicht. Außer: „Çawayî? Ez baş im, kefçî, xwê, mişko“ und einigen Beleidigungen konnte ich kein kurdisch. Aber jede seiner Bewegungen waren faszinierend. Die Guerillakleidung war faszinierend, seine Aura, die grünen Augen, die hügeligen Berge, der Geruch Kurdistans… Grün war plötzlich mehr ein Gefühl, als eine Farbe: Das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.
Der Freund brachte uns zu dem Stützpunkt der Jugendbewegung. Dort sah ich die ersten weiblichen Guerillakämpferinnen. Es waren anmutige Frauen mit ihren Waffen, die ich sonst nur im TV sehen konnte. Ich konnte kaum türkisch, noch weniger kurdisch – doch ich verstand sie sehr gut. Ich fühlte mich wohl bei ihnen, bei diesem Gefühl mit Menschen zusammen zu sein, die keine schlechten Intentionen, doch ein offenes, reines Herz und einen starken Willen hatten. Neben ihnen fühlte ich, dass eigentlich vieles in meinem Leben sehr sehr sinnlos war: Die verzweifelte Suche nach der großen Liebe, der mich krank machende Schönheitswahn, dem ich eh nie gerecht wurde, der Drang sich feminin zu verhalten, der Unistress, obwohl ich wusste, dass ich später einem Staat dienen würde, der mir meine Identität und meine Freiheit geraubt hatte. Dazu noch die Familie mit ihren manchmal feudalen, manchmal liberalen Vorstellungen, wie ich sein sollte, ihre Anforderungen und die Bestimmungen, die eine kurdische Frau erwarten… Das waren Gründe die ich dort zum ersten Mal mit freiem Kopf hinterfragen konnte: „Welches Leben will ich leben?“, und es war das erste mal, dass ich mir diese Frage ernsthaft gestellt hatte. „Will ich wirklich zurück und mich mit ein wenig Veränderung, ein wenig Reform im Leben zufrieden stellen? Oder bleibe ich hier, und lerne ich ich-selbst zu sein, kurdisch zu sein, eine freie Frau zu sein, die gemeinsam mit anderen FreundInnen und mit starkem Willen für ihre Überzeugungen kämpft?“ Logisch betrachtet klingt diese Entscheidung einfach. Doch ganz so einfach war es nicht. Ich rang mit mir selbst. War nicht mutig genug diesen Schritt zu wagen, hatte Angst – denn schließlich weißt du ja nicht was auf dich zukommt. Und im System hast du ja gelernt, dass du immer alles wissen musst, planen musst, dich auf die Zukunft einstellen musst. Außerdem fühlte ich mich nicht bereit, doch was für ein Widerspruch! Wie sollte man auch bereit sein für sowas? Es gibt kein bereitsein, alles was du lernst lernst du ja sowieso in der Partei! Aber da gab es auch auch noch die Familie? Was wird mit ihr?
Es waren zwei Tage in denen Ying und Yang, Ahura Mazda und Ehriman miteinander kämpften.
Ahura Mazda gewinnt!
Einen Tag bevor ich wieder zurückgefahren wäre saß ich nochmal alleine auf einem Stein, schaute mir Kurdistan an. Dachte an diese FreundInnen, die alles hinter sich gelassen hatten, um für die ganze Menschheit ein neues Leben zu erschaffen. Genau in diesem Moment kam eine Freundin, die ich schon aus Europa kannte, und fragte mich: „An was denkst du gerade?“ Es war genau dieser Moment, in dem ich endlich mein Herz, und nicht mein Gehirn, dass von Ängsten, Zweifel und Systemgedanken geprägt wurde, sprechen ließ: „Ich glaube ich werde mich Amargî nennen.“ Sie verstand sofort und fing an zu lachen. Ich gebe zu, ich musste auch einige Freudentränen fließen lassen. Es war schön. Ich kann mir vorstellen, dass man sich das vielleicht nicht vorstellen kann. Aber es war wirklich so, als wäre eine Last von mir Gefallen. Nach dieser Entscheidung habe ich die Zweifel und Ängste losgelassen. Ahura Mazda hat diesen Kampf gewonnen!
Auch heute warten viele Jugendliche auf den „richtigen Moment“, doch hier die Wahrheit: Wir leben nicht im Film. Nicht alle deine Schritte sind bewusst. Aber manchmal läufst du in eine falsche Richtung, und versuchst vor deinem eigenen Herzen zu fliehen. Ich habe auf mein Herz gehört. Ich bin nicht einfach in eine neue Welt eingetreten. Ich habe angefangen teil der Weltveränderer zu werden, um eine neue Welt zu schaffen.
-Amargî Welat
Soundcloud
Spotify
Twitter
Instagram
1 note
·
View note
Text
Die Mörderin aus dem Grunewald - Kapitel 8: Claires Geschichte - Teil 2

“Der Reichstag” - Sitz des Deutschen Bundestages * Picture by Jürgen Matern [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Kapitel 7
Sechs Monate zuvor - Erster Anwalts-Besuch im Gefängnis (Teil 3)
“Ihr Mann hatte also ein Haus im Grunewald gekauft …"
“Ja, Frank war sehr stolz darauf, dass es ihm gelungen war ein Haus in dieser wohlhabenden Gegend zu erwerben. Der ‘besten Gegend’ Berlins, wie er immer wieder betonte. Er kannte natürlich die Geschichte dieses Ortes. Als wir noch in Boston waren hatte er mir nur gesagt, dass er ein großes Haus in einem guten Bezirk von Berlin für unsere zukünftige Familie erworben hatte. Ehrlich gesagt, mich interessierte das Ganze nicht so sehr. Zusammen mit meinem Onkel Lambert hatte ich an so vielen Orten dieser Erde und unter den unterschiedlichsten Umständen gelebt. Wichtig war nur, dass wir einen guten Ort hatten, an dem wir leben und unsere Kinder aufwachsen sehen konnten. Erst auf dem Flug nach Berlin erzählte er mir die Geschichte dieses Ortes.”
“Otto Fürst von Bismarck, der erste Kanzler des Deutschen Kaiserreiches, hat 1880 selbst dafür gesorgt, dass ein großer Teil des Forstes Grunewald vom Preußischen Staat an die Kurfürstendamm-Gesellschaft, ein Bankenkonsortium, verkauft wurde. Ziel der Gesellschaft war es, nach dem Muster der sehr erfolgreichen Villenkolonien in Alsen und in Lichterfelde noch aufwändiger angelegtes Wohnviertel zu errichten und so entstand die spätere ‘Millionärskolonie Grunewald’. Wer damals dort wohnte, der hatte es geschafft. So ist es bis heute. Etliche Staaten haben dort ihre Botschaftsgebäude und unterhalten dort auch Residenzen für ihre Botschafter. Auch Großbritannien und Irland …"
Er lächelte.
“Ich weiß. Auch das erzählte mir Frank auf dem Flug von Boston nach Berlin. Und natürlich lebten und leben dort auch Prominente – Ferdinand Sauerbruch, Lyonel Feininger, Hildegard Knef, Isadora Duncan, Max Planck, Judith und Michael Kerr.”
“Hat er Ihnen auch erzählt, dass Heinrich Himmler dort lebte?”
Claire wurde weiß.
“Nein.”
“Wusste ich's doch,” dachte Jamie, “damit kann man auch nicht angeben.” Zu Clair sagte er:
“Na ist auch egal. Fahren Sie bitte fort.”
“Wie gesagt, das Haus, in das wir zogen, war eine der so genannten ‘kleineren Villen’. Trotzdem war es nach meinem Empfinden riesig, es besaß drei Etagen. Im Erdgeschoss gab es neben Franks Bibliothek und seinem Arbeitszimmer mehrere große Räume. Und natürlich die Küche mit einem eigenen, großen Vorratsraum. Wir benutzten diese Räumlichkeiten eigentlich nur, wenn Gäste kamen. Im zweiten Stockwerk lag unser Schlafzimmer, das über einen Ankleideraum verfügte. Es war wie ein großer, begehbarer Schrank. Daneben gab es vier weitere Räume, die etwas kleiner waren. Den größten dieser Räume nutzen wir als Wohnzimmer. In einem anderen richtete ich mir ein kleines privates Zimmer ein.”
Jamie blickte von seinem Notizblock auf.
“Wozu brauchten Sie ein privates Zimmer?”
“Ich hatte einfach das Bedürfnis nach einem Ort, der nur mir allein gehörte. Ich wollte schneidern können ohne Frank zu stören. Während ich wir in Boston lebten, konnte ich das nur wenn er nicht zu Hause war. Er fühlte sich immer von dem Geräusch der Nähmaschine gestört. Außerdem wollte ich einen Ort haben, an dem ich in Ruhe Tagebuch führen konnte, einen Ort an dem ich meine Bilder aufhängen konnte.”
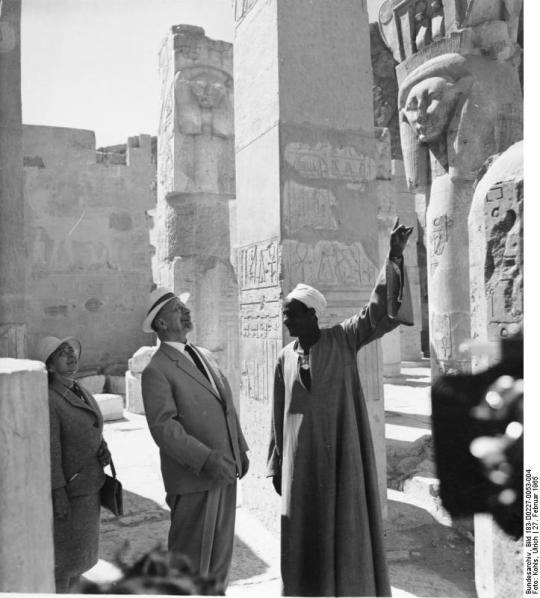
W. Ulbricht im Tal der Könige, Ägypten * Picture: Bundesarchiv, Bild 183-D0227-0053-004 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons
Jamie sah verwundert von seinen Notizen auf.
“Wieso konnten Sie ihre Bilder nicht irgendwo im Haus aufhängen?”
“Frank war dagegen. Ich habe viele Bilder von mir und meinem Onkel Lambert, von den Plätzen, die wir während seiner Expeditionen und Ausgrabungen besuchten. Es sind meistens … unkonventionelle Bilder. Frank sagte, dass sie nicht in das Gesamtbild unseres Hauses passen würden. Schließlich würden wir Gäste empfanden, Kollegen aus der Universität und dann könnten meine Bilder Fragen aufwerfen …"
“Was für Fragen?”
“Fragen bezüglich meiner ‘unkonventionellen Vergangenheit’, meiner ‘unkonventionellen Erziehung’ ... Frank wollte auf keinen Fall, dass davon etwas bei seinen neuen Kollegen bekannt wurde.”
Jamie verdrehte die Augen.
“Mein Doktortitel lag ihm dagegen bei Gesprächen mit seinen Kollegen immer schnell auf der Zunge … Er fügte dann jedoch auch immer gleich hinzu, dass ich derzeit nicht arbeiten würde, weil wir eine Familie gründen wollten.”
“Wie ging es dann weiter, nachdem sie in Berlin angekommen waren?”
“Wie gesagt, die Einrichtung des Hauses nahm viel Zeit in Anspruch, zumal ich ja die meisten Dinge allein regeln oder machen musste. Frank hatte, als er in Berlin war um das Haus zu kaufen, auch gleich eine Firma mit den Maler- und Tapezierarbeiten beauftragt. Er hatte auch einen Grundriss mitgebracht, so dass wir uns noch in Boston auf die Einteilung und Möblierung der Zimmer verständigt hatten. Aber mit dem Ausräumen der ganzen Umzugskartons war ich dann doch allein. Frank begann gleich in der Woche nach unserer Ankunft mit seiner Arbeit an der Universität und hatte – wenn überhaupt - nur an den Wochenenden Zeit, mir zu helfen. Hinzu kam noch, dass einer unserer Umzugscontainer mit Verspätung ankam. Es dauerte also ungefähr fast zwei Monate, bis wir uns so richtig eingerichtet hatten.”
“Und sonst?”
“Nun, eigentlich war diese Zeit gut. Ich kümmerte mich um das Haus, wir versuchten schwanger zu werden, … Frank lernte seine Kollegen kennen, wir gingen auf Partys … wir unternahmen auch einige Ausflüge. Obwohl Frank die Wochenenden – zumindest in dieser Zeit – gern zu Haus verbrachte, war ihm wohl bewusst, dass es nicht gut war, wenn er nichts mit mir gemeinsam unternahm. Wir besuchten den Reichstag und bestiegen die Reichstagskuppel. Frank wusste natürlich alles über die Geschichte des Gebäudes. Als wir oben in der Kuppel angekommen waren, erzählte er gerade etwas von dem Reichstagsbrand im Jahr 1933 und welche Folgen er für das Land gehabt hatte. Einige Senioren, die in unserer Nähe standen, begannen daraufhin ein Gespräch mit Frank. Sie waren begeistert, mit einem echten ‘Herrn Professor’ zu sprechen … Ich habe mich nach einigen Minuten von Frank und den Senioren abgesetzt und die Kuppel auf eigene Faust erkundet. Der Gedanke des Architekten, dass die gläserne Kuppel über den Abgeordneten des Parlaments sie zur Transparenz gegenüber den Bürgern mahnen sollte, hat mich sehr beeindruckt. Als sich Franks Senioren dann verabschiedet hatten, erzählte ich ihm davon. Doch er fand diesen Gedanken ‘unrealistisch’. Politiker würden ja doch machen, was sie wollten … kein künstlerisches Symbol würde die Kraft besitzen, daran etwas zu ändern.”

Blick durch die Kuppel des Reichstages in den Abgeordnetenhaus des Deutschen Bundestages * Picture: By Another Believer [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Sie blickte zu Boden und schwieg einen Moment.
“Trotzdem war es eigentlich eine unserer besseren Zeiten. Wir besuchten Schloss Charlottenburg, den Fernsehturm, den Gendarmenmarkt, den Deutschen und den Französischen Dom. In unserem zweiten Sommer in Berlin machten wir sogar eine Spreerundfahrt. Daran erinnere ich mich gut … und gern. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Abends waren wir dann noch essen im Corroboree. Das ist ein …"
“... australisches Restaurant im Bezirk Tiergarten. Ich weiß.”
Jamie lächelte.
“Sie kennen es?”
“Ja, ein Kollege von mir, Ben Hombach, wollte unbedingt wissen, wie Känguru schmeckt. Er hat mich dorthin eingeladen.”
“Und? Haben Sie Känguru gegessen?” fragte sie herausfordernd.
Jamie entschied sich, das Spiel mitzuspielen. Er war sicher, dass sie in ihren Gesprächen noch viele unerfreuliche Dinge ansprechen mussten. Warum sollte er ihr nicht einen Augenblick der Entspannung gönnen?
“Nein, ich habe mich dann doch für ein Rindersteak entschieden. Ich mag Kängurus. Sie sind mir viel zu sympathisch. Als das ich sie auf meinem Teller haben möchte. Aber fahren Sie bitte fort.”
“Wie gesagt, diese Zeit war positiv. Wir stritten uns kaum und wenn, dann war es nie ein großer Streit. Es war immer schnell vergeben und vergessen. Zwischendurch besuchten wir Franks Cousin in England oder Alex kam zu uns. Gegenseitige Besuche zum Weihnachtsfest waren … obligatorisch. Frank genoss diese Aufenthalte in England sehr. Obwohl es ja auch in Berlin ein großes englisches Kulturangebot gibt - und sogar einige englisch Restaurants ….”
“Wie das East London zum Beispiel.”
“Waren Sie dort auch mit ihrem Freund Ben?”
“Nein, noch nicht und um ehrlich zu sein, aufgrund meiner Herkunft ich bevorzuge den Schottischen Pub in Lichterfelde. Sie haben dort über 800 Whiskysorten im Angebot.”
“Ich wäre schon froh, wenn ich jetzt eine Sorte hätte.”
“Alkohol ist ….”
“... im Gefängnis verboten. Ich weiß. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Familienbesuche. Alex, Franks Cousin, kam auch gern zu uns nach Berlin. Ich denke, es war im dritten Jahr nach unserem Umzug, dass er uns aus Anlass meines Geburtstages besuchte. Frank lud uns zu einem Ausflug auf die Museumsinsel ein. Wir besuchten das Neue Museum mit dem Nofretete Saal. Das war ein wirklich besonderes Ereignis für mich. Mein Onkel Lamb hatte mir oft von ihrer Büste erzählt. Er war mehrfach in Berlin gewesen und hatte sie gesehen. Allerdings war das in der Zeit gewesen, bevor er mein Vormund wurde und lange bevor die Ägyptische Königin ihren eigenen Saal bekam. So war mein erster Besuch dort ein ganz besonderes Erlebnis. Die Stimmung sollte sich jedoch bald ändern. Am Samstag darauf gaben wir eine Party bei uns. Etliche von Franks Kollegen mit Frauen oder Freundinnen waren da, aber ich hatte auch einige Leute eingeladen, die ich zwischenzeitlich kennengelernt hatte.”
“Sie hatten also auch eigenständig neue Kontakte geknüpft?”
“Eine wenige, ja.”
“Erzählen Sie mir davon!”
“Nun, Sie wissen sicherlich, dass man sich Jahre vorher für einen Kindergartenplatz anmelden muss. Wir wollten natürlich nicht irgendeinen Kindergarten für unser Kind, sondern einen englischsprachigen. Also besuchten wir den von uns ausgesuchten Kindergarten und hatten ein Gespräch mit der Leiterin, Mary Hawkins. Sie war mir sofort sympathisch und nachdem ich sie dann zufällig einige Wochen später in der Stadt getroffen hatte, blieben wir in Kontakt und freundeten uns an. Neben unserem Haus im Grunewald wohnte eine ältere Dame, Glenna Fitz-Gibbons. Ihr Ehemann, der vor einigen Jahren verstorben ist, war ein britischer Offizier, der in Berlin stationiert war. Sie selbst hat für die britische Botschaft gearbeitet. Auch zu ihr entwickelte sich eine gute Beziehung. Wir kamen über die Blumen ins Gespräch, die ich in unserem Garten pflanzte und von da an trafen wir uns regelmäßig zum Tee. Eines Tages dann brachte Frank einen jungen Kollegen mit nach Hause, der mit seiner Frau gerade erst nach Berlin gezogen war. Sein Name ist Roger Wakefield. Er ist ein netter Kerl, sehr hilfsbereit und freundlich. Er und seine Frau Fiona haben eine sind allerdings sehr … konventionelle Einstellung … wenn Sie verstehen, was ich meine. Nichtsdestotrotz habe ich mich hin- und wieder mit ihr getroffen.”
“Nicht so unkonventionell wie Sie?”
Sie lächelte, doch dieses Lächeln währte nicht lang.
“Diese drei Frauen und eine Krankenschwester, die ich aus dem Berliner Benjamin-Franklin-Krankenhaus, besser gesagt über einen Freund aus Boston, kannte, hatte ich eingeladen. Ihr Name ist Gellis Duncan. Sie ist Schottin, hat aber einige Jahre in Boston gelebt und dort in demselben Krankenhaus gearbeitet wie mein Freund Joe Abernathy. Sie hatte eine Beziehung zu einem amerikanischen Arzt und als dieser nach Berlin ging, ging sie mit. Joe schrieb mir und bat mich, dass ich mich um sie kümmern sollte. Sie kannte hier in Berlin ja gar niemanden. Ich verabredete mich mit ihr und zeigte ihr ein wenig von der Stadt.”

Flußkreuzfahrtschiffe auf der Spree / Berlin, das Bode-Museum (mit Kuppel) auf der rechten Seite markiert den Eingang zur Mueseumsinsel * Picture: by Bode Museum [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
“Hatten Sie auch Kontakt zu ‘Einheimischen’?”
Claire verdrehte die Augen. Dann beugte sie sich vor und flüsterte:
“Ja, aber verraten Sie es nicht weiter!”
Jamie beugte sich zu ihr und flüsterte:
“Versprochen. Erzählen Sie mehr!”
“Nun ich lernte eine der Bibliothekarinnen der Bezirksbibliothek kennen, als ich mich dort anmeldete. Ihr Name ist Suzette Fournier.”
“Das hört sich aber französisch an.”
“Sie entstammt einer der Hugenottenfamilien, die nach den blutigen Verfolgungen vor dreihundert Jahren aus Frankreich flohen. Ihre Familie hat den Brauch beibehalten, den Kindern französische Namen zu geben und auch sonst pflegen sie einige französische Sitten. Aber Suzette ist doch schon sehr deutsch. Sie müssen sie einmal Bier trinken sehen.”
“Wie stand ihr Mann zu diesen Kontakten oder Freundschaften?”
“Er war nicht grundsätzlich dagegen, jedoch meinte er nach meiner Geburtstagsfeier, dass ich sie das nächste Mal separat einladen sollte. Diese Frauen wären nicht gerade die geeigneten Gesprächspartner, wenn seine Kollegen und ihre Frauen zu Gast seien. Ich war wütend, aber ich habe es heruntergeschluckt und später habe ich dann einfach nicht mehr darüber gesprochen und ab unserem vierten Jahr hier wurde es dann auch immer schwieriger mit uns.”
“Ich weiß, Claire, es ist sicherlich schwer für sie … aber wir müssen das besprechen. Wir wissen nicht, was diese … Zeugin …. und der Cousin ihres Mannes aussagen werden … wir müssen vorbereitet sein.”
Sie nickte und er sah, wie sich ihr Körper versteifte.
“In den ersten zwei Jahren war alles einigermaßen normal. Aber als ich dann auch im dritten Jahr nicht schwanger wurde … wurde Frank immer zorniger. Er zeigte es erst nicht, aber ich merkte doch, wie die Wut in ihm brodelte. Ich versuchte ihn zu trösten, ihm Hoffnung zu machen ….”
“Haben Sie ihm mal vorgeschlagen, dass sie beide sich medizinisch untersuchen lassen könnten?”
“Nein. Ich hatte diesen Gedanken war erwogen, aber nein. Ich … ich hatte Sorge, dass … wie er reagieren würde.”
Sie schwieg für einen Moment.
“In Boston … hatte ich einmal das Thema Adoption angesprochen …"
“Wie hat ihr Mann darauf reagiert?”
“Mit einem Wutanfall. Er … er wollte nur ein eigenes Kind akzeptieren.”
“Hatten Sie Angst, dass ihr Mann ihnen gegenüber gewalttätig werden würde?”
“Nun, wie ich sagte, einmal stand er kurz davor mich zu schlagen. Damals als er herausfand, dass ich das Medizinstudium begonnen hatte. Bei einigen Auseinandersetzungen, die wir später hatten, riss er sich ebenfalls zusammen. Aber nein, er benutzte seine Worte, um mich zu verletzen. Das war viel effektiver. Außerdem hinterließen sie keine sichtbaren Verletzungen.”
“Sie sprachen von der Verschlechterung ihrer Ehe ab dem dritten Jahr in Berlin …"
“Es begann im Herbst. Der Sommer war, wie gesagt, noch recht positiv. Er flog zu einer Historiker-Konferenz nach Prag. Zwei Wochen bevor das Herbst-Wintersemester beginnen sollte. Die Konferenz dauerte nur ein Wochenende, aber er rief an und sagte, dass er später zurückkehren würde. Er wollte sich noch mit Kollegen austauschen und die Gelegenheit wahrnehmen, die Stadt zu besichtigen. Ich wusste, dass er mich belog, noch während er redete. Später habe ich erfahren, dass Frank in Prag seiner alten Affäre aus Boston wieder begegnet ist – Sandy Travers. Nur dass sie zwischenzeitlich geheiratet hatte und nun mit Nachnamen Miller hieß.”
“Wie haben Sie das erfahren?”
“Ich erfuhr es von Roger Wakefield. Natürlich nicht freiwillig. Roger war auch auf dieser Konferenz. Jedoch kam er gleich nach dem Wochenende nach Hause. Roger mag vielleicht sehr auf Konventionen bedacht sein, aber er ist ein Mann mit einem Gewissen. Er kann nicht gut lügen. Wochen nach der besagten Konferenz war ich mit seiner Frau in der Stadt verabredet und hinterher lud sie mich noch auf ein Tee ein. Ihr Mann kam etwas früher als beabsichtigt nach Hause und beide baten mich, zum Abendessen zu bleiben. Als Fiona dann den kleinen Colin zu Bett brachte, fragte ich Roger frei heraus, ob Frank in Prag etwas mit einer anderen Frau gehabt hätte. Frank hatte ihn zwar zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber ... er wurde rot und verlegen und dann sagte er leise ‘Ja’. Mehr musste ich nicht wissen. Als er mich dann nach Hause fuhr, versuchte er noch einmal irgendwie zu vermitteln. Aber ich sagte ihm, er müsse sich keine Sorgen machen. Ich hatte nicht vor, Frank zu sagen, dass ich es wusste. Bevor wir uns verabschiedeten sagte mir Roger, dass er die Frau nicht gekannt hätte und er nannte mir auch ihren Namen. Ich wusste gleich, dass sie es war, auch wenn ihr Nachname nun anders lautete. Ich erzählte Frank nichts davon, aber ich zog mich innerlich – und äußerlich - von ihm zurück. Als er mich einige Wochen später zur Rede stellte, sagte ich ihm, dass ich ihm nicht glauben würde, dass es ihm in Prag nur um Kollegen und Stadtbesichtigung gegangen sei. Ich sagte ihm, dass ich vermute, er hätte eine neue Affäre.“
“Wie reagierte er darauf?”
“Er nannte mich hysterisch und sagte, ich hätte Wahnvorstellungen. Dann verließ er das Haus. Ich … ich betrank mich und schlief in meinem eigenen Zimmer. Frank kam irgendwann in der Nacht zurück. Am nächsten Morgen erwartete er mich am Frühstückstisch als ob nie etwas geschehen sei.”
“Sie lebten also weiterhin mit ihm zusammen.”
“Was hätte ich tun sollen? Ich hatte außer ihm niemanden. Hinzu kam, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch finanziell von ihm abhängig war. Mein Onkel hatte mir zwar eine größere Summe vererbt. Aber als wir nach Berlin umzogen, hatte ich dieses Geld für mehrere Jahre fest angelegt … zum damaligen Zeitpunkt dachte ich ja noch, dass alles besser werden würde. Jetzt kam ich nicht an dieses Geld heran. Ich war verzweifelt und glitt langsam in eine Depression hinein. Ich fühlte mich so unfähig, so ungenügend, so wertlos.”
“Haben Sie einen Arzt aufgesucht?”
“Ja. Ich habe einen deutschen Hausarzt, Dr. Clemens Dupont.”
“Ein sehr deutscher Name.”
Jamie lächelte.
“Ich habe ihn über Suzette kennengelernt, seine Familie …"
“... lebt seit 187 Jahren in Berlin.”
“So ungefähr. Aber im Ernst, er überwies mich an einen Arzt in Charlottenburg, Dr. Brosig. Die Gespräche taten mir gut. Doch gerade als es mir wieder etwas besser ging, kam der nächste Schlag.”
Jamie spürte, dass sie sich nun dem schwierigsten Punkt des Gesprächs näherten. Er nickte nur.
“Es war im Frühjahr nach der Konferenz in Prag. Ich erinnere mich noch sehr genau. Es war ein schöner, sonniger Apriltag und nach langer Zeit spürte ich zum ersten Mal wieder Lust, einen Spaziergang zu machen. Ich ging durch das Waldgebiet, das an unser Haus grenzte in Richtung des Grunewaldsees. Auf meinem Rückweg kam ich an einer der größeren Villen vorbei, die drei Straßen von unserem Haus entfernt liegt. Sie ist in mehrere Wohnungen unterteilt und da sah ich sie - Sandy Travers. Sie stand neben einem großen Möbelwagen und dirigierte Männer, die Möbel ins Haus trugen. Ich traute meinen Augen nicht. Frank hatte tatsächlich die Unverschämtheit besessen und seine Affäre in unserer Nachbarschaft einquartiert.”
#DieMörderinausdemGrunewald#Outlander Fan Fiction German#Outlander Fan Fiction deutsch#Claire Fraser#Claire Beauchamp#Claire randall#Frank Randall#Jamie Fraser#Berlin#Deutschland#Germany#Grunewald#Adso die Katze#Bismarck der Dackel#Crime AU#Kriminalgeschichte#Nach einer wahren Begebenheit
3 notes
·
View notes
Text
Der Allmächtige Gott führte mich auf den Weg der Reinigung

Der Allmächtige Gott führte mich auf den Weg der Reinigung
Von Gangqiang, USA
Im Jahr 2007 kam ich allein nach Singapur, um dort meinen Lebensunterhalt zu verdienen. In Singapur war es das ganze Jahr über sehr heiß und bei der Arbeit war ich jeden Tag schweißgebadet. Es war ein Elend. Darüber hinaus befand ich mich ohne Familie oder Freunde an einem mir vollkommen unbekannten Ort – das Leben erschien mir so öde und mühsam. An einem Tag im August drückte mir auf dem Heimweg von der Arbeit jemand ein Flugblatt über das Evangelium in die Hand. Darauf stand: „Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen“ (1 Petrus 5,10). Als ich diese Worte las, wurde mir warm ums Herz. Danach ging ich zusammen mit einem Bruder in die Kirche, wo ich mich durch die überschwängliche Begrüßung der Brüder und Schwestern, die sich nach meinem Befinden erkundigten, so geborgen wie in einer Familie fühlte, was ich seit langem entbehrte. Plötzlich füllten sich meine Augen mit Tränen – ich hatte das Gefühl, ich wäre nach Hause gekommen. Von da an war der sonntägliche Kirchenbesuch für mich unverzichtbar.
Im Dezember wurde ich getauft und betrat offiziell den Weg des Glaubens. In einem Gottesdienst las der Pastor die Verse 21 und 22 aus Kapitel 18 des Matthäusevangeliums vor: „Da trat Petrus zu ihm und sprach: HERR, wie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist’s genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“ Als ich das hörte, dachte ich bei mir: „Wie können die Vergebung und Geduld des Herrn Jesu so groß sein? Er vergibt den Menschen siebzigmal siebenmal. Wenn die Menschen es Ihm gleichtun könnten, gäbe es keinen Streit, sondern nur Liebe und Herzlichkeit!“ Die Worte des Herrn berührten mich tief und ich gelobte, im Einklang mit Seinen Lehren zu handeln.
Zwei oder drei Jahre später betraute mich mein Chef mit der Leitung einer Baustelle. Daraufhin verwendete ich meine ganze Energie für die Arbeit und nahm nicht mehr so regelmäßig an Versammlungen teil. Später machte mich ein Freund mit einem Financier namens Herr Li bekannt und wir gründeten zusammen ein Bauunternehmen. Ich war sehr glücklich und entschlossen, mich ganz der Arbeit zu widmen. Der Sog des Geldes hatte mich dann völlig im Griff und ich hörte ganz auf, zu den Versammlungen in die Kirche zu gehen. Ich wollte, dass die Projekte gut ausgeführt wurden, um von anderen Anerkennung für mein Können zu erhalten, und verlangte den Arbeitern daher immer mehr ab. Ich rügte sie jedes Mal, wenn ich sah, dass sie etwas falsch gemacht hatten, oder wenn etwas nicht meinen Ansprüchen genügte. Der Vorarbeiter brach aufgrund meiner Beschimpfungen oft in Tränen aus. Die Arbeiter bekamen es jedes Mal, wenn sie mich sahen, mit der Angst zu tun und versteckten sich sogar vor mir. Selbst Leute, die gute Freunde gewesen waren, behandelten mich kühl und vertrauten sich mir nicht länger an. All das war sehr schmerzlich. Der Herr Jesus lehrt uns, anderen siebzigmal siebenmal zu vergeben und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Ich aber hatte dies nicht im Geringsten in die Praxis umgesetzt, nicht ein einziges Mal. Wie konnte ich Christ sein? Ich wusste, dass ich sündigte, und betete oft zum Herrn, beichtete und bereute. Ich gelobte, mich zu ändern. Doch jedes Mal, wenn irgendetwas geschah, sündigte ich doch gegen meinen Willen. Ich ärgerte mich wirklich sehr.
Im August 2015 stellten wir unsere Geschäfte ein, da das Unternehmen nicht gut lief, und ich blieb zu Hause. Deprimiert und unglücklich trank und spielte ich den ganzen Tag. Wenn meine Frau mir sagte, ich solle mit dem Trinken aufhören, schrie ich sie nur an: „Es ist mein Geld, ich habe es verdient und ich werde es ausgeben, wofür ich will …“ Da sie nichts tun konnte, saß sie nur da und weinte. Jedes Mal, wenn ich meinem Ärger freien Lauf ließ, bereute ich es und hasste mich dafür, doch ich konnte mich einfach nicht im Zaum halten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meinen christlichen Anstand gänzlich verloren; mein Verhalten und Benehmen waren denen eines Ungläubigen gleich.
In meinem Schmerz und meiner Ohnmacht ging ich zurück zur Kirche und nahm wieder an den Versammlungen teil. Während dieser Zeit betete ich ständig zum Herrn Jesus: „O Herr! Ich habe so vieles getan, was ich nicht tun wollte, ich habe so vieles gesagt, was andere verletzte. Ich habe in Sünde gelebt und mich gegen Dich aufgelehnt. Jedes Mal, wenn ich sündige, bereue ich es und hasse mich, doch nie kann ich mich beherrschen! In der Nacht bekenne ich meine Sünden, doch am Tag falle ich in meine alten Verhaltensmuster zurück und sündige erneut. O Herr! Ich flehe Dich an, mich zu retten. Was kann ich tun, um mich von der Sünde zu befreien?“
Am Neujahrstag 2016 setzte ich meinen Fuß auf amerikanische Erde – ich war nach New York gekommen, um Geld zu verdienen. In meiner Freizeit ging ich weiterhin zur Kirche und schloss mich auch einem Gebetskreis an, wo ich mit anderen Brüdern und Schwestern die Bibel las und betete. Dort lernte ich eine Schwester namens Qinglian kennen. Eines Tages rief Schwester Qinglian mich an und sagte, sie habe gute Nachrichten, die sie mir mitteilen wolle. Ich fragte: „Was sind das für gute Nachrichten?“ Sie antwortete: „Eine Missionarin kommt zu Besuch. Willst du kommen und sie reden hören?“ Ich sagte: „Prima! Wo denn?“ Sie legte dann einen Tag fest, an dem wir uns bei ihr zu Hause treffen würden.
Am vereinbarten Tag ging ich zu Schwester Qinglian nach Hause. Mehrere Brüder und Schwestern waren da und nachdem wir uns einander vorgestellt und begrüßt hatten, begannen wir, über die Bibel zu diskutieren. Der gemeinschaftliche Austausch von Schwester Zhao war sehr erleuchtend und wirklich erbaulich für mich. Ich erzählte ihr dann davon, wie ich ständig sündigte und beichtete, und von dem Schmerz darüber, mich nicht von der Sünde befreien zu können, und bat sie um Hilfe. In ihrem gemeinschaftlichen Austausch sagte sie, dass wir ständig sündigten, selbst nachdem wir begonnen hätten, an den Herrn zu glauben, und dass das Problem des ewigen Kreislaufs des Sündigens am Tag und des Beichtens in der Nacht, aus dem wir nie loskommen könnten, nicht nur mir zusetzen würde. Dies war vielmehr ein Problem, das alle Gläubigen gleichermaßen betraf. Schwester Zhao zeigte uns dann ein Video mit Rezitationen der Worte Gottes. Sie lauteten folgendermaßen: „Die Disposition des Menschen sollte verändert werden, beginnend bei der Kenntnis seiner Wesensart und durch Veränderungen in seiner Denkweise, Natur und geistigen Einstellung – durch fundamentale Veränderungen. Nur auf diesem Weg werden echte Veränderungen bei der Disposition des Menschen erzielt werden. Die verdorbene Disposition des Menschen beruht darauf, dass er von Satan vergiftet und mit Füßen getreten wurde, dass Satan seiner Denkweise, Moral, Einsicht und Vernunft ungeheuren Schaden zugefügt hat. Es liegt exakt daran, dass diese fundamentalen Dinge des Menschen von Satan verdorben wurden und sie völlig anders sind, als Gott sie ursprünglich erschuf, dass der Mensch sich Gott widersetzt und die Wahrheit nicht versteht. So sollten Veränderungen in der Disposition des Menschen mit Veränderungen in seiner Denkweise, seiner Einsicht und seinem Verstand beginnen, die seine Kenntnis von Gott und seine Kenntnis von der Wahrheit verändern werden“ („Eine unveränderte Disposition zu haben, bedeutet, in Feindschaft mit Gott zu sein“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“).
Ich war sehr bewegt und dachte: „Sind diese Worte etwa an mich gerichtet? Ich verachte andere immer, schimpfe mit ihnen wegen diesem und schreie sie wegen jenem an. Mir fehlt es an Moral und Verstand und ich habe die letzte Spur von frommem Anstand verloren.“ Die Worte stachen mir mitten ins Herz. Nie zuvor hatte ich etwas Ähnliches gelesen und nie hatte ich gehört, dass ein Priester eine solche Predigt gehalten hatte. Ich war betrübt darüber, dass ich ständig sündigte, und war doch nicht in der Lage, mich von den Zwängen der Sünde zu befreien. Diese Worte wiesen mir den Weg, die Sünde hinter mir zu lassen, und ich wunderte mich: „Das ist so gut formuliert. Wer könnte es geschrieben haben?“
Schwester Zhao berichtete mir, dass es das Wort Gottes war, dass der Herr Jesus schon ins Fleisch zurückgekehrt war und dass Er derzeit durch Sein Wort in den letzten Tagen das Werk des Richtens und Reinigens der Menschen vollbrachte. Ich konnte meinen Ohren einfach nicht trauen. Welcher Gläubige sehnt sich nicht nach Seiner Wiederkehr? Als ich unversehens diese Neuigkeiten über die Wiederkehr des Herrn vernahm, war ich so aufgeregt, dass ich ein wenig ratlos war. War der Herr wahrhaftig wiedergekehrt? Ich bat sie eifrig, ihren gemeinschaftlichen Austausch fortzusetzen. Schwester Zhao sagte: „Der Herr Jesus ist wahrhaftig wiedergekehrt und Er ist der Allmächtige Gott – der menschgewordene Christus in den letzten Tagen. Er hat alle Wahrheiten zum Ausdruck gebracht, um die Menschheit zu reinigen und zu retten und Er hat angefangen, das Urteilswerk zu vollbringen, beginnend mit dem Haus Gottes. Er wird uns umfassend aus der Domäne Satans erretten, uns, die wir von unserer satanischen Natur gebunden wurden und in Sünde leben, aus der wir uns nicht selbst befreien können. Am Ende werden wir vollständige Rettung erlangen und von Gott gewonnen werden. Im Zeitalter der Gnade vollbrachte der Herr Jesus nur das Erlösungswerk; Er erlöste uns von der Sünde und sprach uns von unseren Sünden frei, damit wir nicht länger unter dem Gesetz verdammt sind. Doch obwohl der Herr uns von unseren Sünden freisprach, vergab Er uns unsere satanische Natur oder unsere satanischen Dispositionen nicht. Arroganz, Gerissenheit, Selbstsucht, Gier, Tücke und andere verderbte Dispositionen sind immer noch im Menschen zu finden. Dies sind Eigenschaften, die tiefer wurzeln und hartnäckiger sind als die Sünde. Genau aus diesem Grund sündigen wir weiterhin gegen unseren Willen, da diese satanische Disposition und die satanische Natur nicht überwunden wurden; und wir begehen sogar Sünden, die schwerer wiegen als ein Verstoß gegen das Gesetz. Was war der Grund dafür, dass die Pharisäer sich damals dem Herrn widersetzten und Ihn verdammten, und sogar so weit gingen, Ihn zu kreuzigen? War der Grund nicht, dass die sündige Natur des Menschen nicht überwunden war? In der Tat haben wir alle ein tiefes Verständnis davon, weil wir selbst der Kontrolle dieser verderbten Dispositionen unterliegen. Daher lügen wir oft, handeln unredlich, sind arrogant und eingebildet und weisen andere auf herablassende Weise zurecht. Wir wissen genau, dass der Herr von uns verlangt, dass wir anderen vergeben und unseren Nächsten wie uns selbst lieben, und doch können wir es nicht in die Praxis umsetzen. Menschen intrigieren gegeneinander, drängen nach Ruhm und Reichtum und sind nicht in der Lage, in Harmonie miteinander auszukommen. In Zeiten von Krankheit, menschengemachten oder Naturkatastrophen geben wir nach wie vor Gott die Schuld und wir leugnen oder verraten Gott sogar. Dies zeigt, dass wir, wenn wir unsere satanische Natur und unsere satanischen Dispositionen nicht überwinden, dem Kreislauf des Sündigens und Beichtens, des Beichtens und Sündigens, nie entkommen können. Aus diesem Grund, um den Menschen umfassend von der Sünde zu erretten, ist es notwendig, dass Gott die Phase Seines Werks des Urteils und der Reinigung vollbringt, um unsere sündige Natur zu überwinden. Dies ist der einzige Weg, wie wir gereinigt und vollständig von Gott gerettet und von Ihm gewonnen werden können. Lasst uns noch ein paar ausgewählte Worte des Allmächtigen Gottes lesen und du wirst es verstehen.“
Schwester Zhao schlug das Buch des Worts Gottes auf und begann zu lesen: „Obwohl der Mensch von seinen Sünden erlöst wurde, und sie ihm vergeben wurden, wird dies nur folgendermaßen erachtet: Gott kann sich an die Verfehlungen des Menschen nicht erinnern und behandelt den Menschen nicht seinen Verfehlungen entsprechend. Wenn der Mensch jedoch im Fleisch lebt und nicht von seinen Sünden befreit worden ist, so kann er nur weiterhin sündigen und endlos die verdorbene, satanische Disposition enthüllen. So ist das Leben, das der Mensch führt: Ein endloser Kreislauf von Sünde und Vergebung. Die meisten Menschen sündigen am Tag, nur um dann am Abend zu beichten. Auch wenn das Sühneopfer auf ewig für den Menschen wirksam ist, könnte es den Menschen nicht von der Sünde zu retten. Nur die Hälfte der Arbeit der Erlösung ist vervollständigt worden, denn der Mensch hat immer noch eine verdorbene Disposition“ („Das Geheimnis der Menschwerdung (4)“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). „Obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete Er nur die Erlösung der ganzen Menschheit, wurde des Menschen Sündopfer und befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen völlig vor dem Einfluss Satans zu retten, verlangte nicht nur von Jesus, die Sünden des Menschen als das Sündopfer auf Sich zu nehmen, sondern verlangte auch von Gott, ein größeres Werk zu tun, um den Menschen völlig von seiner Gesinnung zu befreien, die von Satan verdorben wurde“ (Vorwort zu Das Wort erscheint im Fleisch). „Die Sünden des Menschen wurden durch Gottes Arbeit der Kreuzigung vergeben, aber der Mensch lebte weiterhin in der alten, verdorbenen, satanischen Disposition. Der Mensch muss schlechthin völlig aus der verdorbenen, satanischen Disposition errettet werden, damit die sündhafte Natur des Menschen komplett vertrieben werden kann und nie mehr auftritt. Auf diese Weise kann die Disposition des Menschen geändert werden. Dies setzt voraus, dass der Mensch den Weg der Entwicklung des Lebens, den Lebensweg und die Art und Weise, auf die seine Disposition verändert wird, versteht. Es ist auch notwendig, dass der Mensch in Übereinstimmung mit diesem Weg handelt, damit die Disposition des Menschen schrittweise geändert werden kann; damit er unter dem Leuchten des Lichts leben, alle Dinge im Einklang mit Gottes Willen tun, die verdorbene, satanische Disposition verwerfen und aus Satans Einfluss der Dunkelheit, ausbrechen kann. Dadurch wird er völlig frei von Sünde in Erscheinung treten. Nur dann wird der Mensch die vollständige Erlösung empfangen“ („Das Geheimnis der Menschwerdung (4)“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). Schwester Zhao sagte in ihrem gemeinschaftlichen Austausch: „Da wir nun diese Worte Gottes gelesen haben, verstehen wir, weshalb wir immer von unserer satanischen Natur gebunden sind und uns nie von der Sünde befreien können, nicht wahr? Im Zeitalter der Gnade vollbrachte Gott nur das Erlösungswerk, nicht das endzeitliche Werk des Richtens, Reinigens und der umfassenden Errettung der Menschen. Wie wir auch unsere Sünden bekennen und bereuen, wie wir auch versuchen, uns selbst zu bezwingen, wie wir auch fasten und beten, wir werden nicht in der Lage sein, uns von der Sünde zu befreien. Folglich reicht es nicht aus, das Erlösungswerk des Herrn Jesu zu durchleben, wenn wir uns von den Fesseln und der Kontrolle unserer sündigen Natur losreißen wollen. Wir müssen das Urteilswerk annehmen, das vom wiedergekehrten Herrn Jesus vollbracht wird. Das beruht darauf, dass Gott, indem Er Sein Urteilswerk der letzten Tage vollbringt, viele Aspekte der Wahrheit zum Ausdruck bringt, um des Menschen satanische Natur des Widerstands und Verrats gegen Gott zu richten und bloßzustellen. Er offenbart Gottes gerechte, heilige, unverletzliche Disposition und lässt die Menschheit durch das Gericht und die Züchtigung von Gottes Worten die Wahrheit seiner eigenen tiefen Verderbtheit durch Satan klar erkennen, lässt sie wahrhaftige Kenntnis über Gottes gerechte Disposition, die kein Verletzen durch den Menschen duldet, erlangen und ein gottesfürchtiges Herz entfalten. Auf diese Weise wandelt und reinigt Er die satanische Disposition des Menschen und rettet ihn vor Satans Einfluss. In Gottes majestätischem, zornigem Urteil und Seiner Züchtigung erblicken wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Wie ein zweischneidiges Schwert durchbohrt Gottes Wort unser Herz. Es offenbart unsere satanische Natur des Widerstands und Verrats gegen Gott wie auch unsere verdorbene Disposition im verborgensten Winkel unseres Herzens, in den wir selbst in keiner Weise vordringen können. Es lässt uns erkennen, dass das Wesen unserer Natur voller satanischer Dispositionen wie Arroganz, Hochmut, Selbstsucht, Niedertracht, Unehrlichkeit und Gerissenheit ist, dass wir auch nicht im Geringsten das Abbild eines Menschen besitzen und ganz und gar die Verkörperung Satans sind. Erst dann werfen wir uns vor Gott nieder und beginnen, uns selbst zu hassen und zu verfluchen. Gleichzeitig spüren wir auch, dass das gesamte Wort Gottes die Wahrheit ist, es ist die Offenbarung der Disposition Gottes sowie das, was das Leben Gottes ausmacht. Wir erkennen, dass Gottes gerechte Disposition kein Verletzen duldet und dass Gottes heiliges Wesen nicht besudelt werden wird. Als Ergebnis entwickeln wir ein Herz der Ehrfurcht vor Gott. Wir beginnen, mit aller Kraft nach der Wahrheit zu streben und im Einklang mit dem Wort Gottes zu handeln. Während wir allmählich die Wahrheit verstehen lernen, werden wir ein immer besseres Verständnis unserer eigenen satanischen Natur und Disposition erlangen und immer tiefere Einsicht gewinnen. Auch unser Wissen über Gott wird wachsen. Unsere inneren verderbten Dispositionen werden langsam gereinigt und wir von den Fesseln der Sünde befreit werden. Wir werden die wahre Befreiung erlangen und frei vor Gott leben. Genau dies ist der Erfolg, der durch Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen an der Menschheit errungen wurde. Aus diesem Grund kann man das Werk der ‚Erlösung‘ im Zeitalter der Gnade und das Werk der ‚Befreiung des Menschen von der Sünde‘ in den letzten Tagen als zwei verschiedene Phasen des Werkes betrachten. Bei der ‚Erlösung‘ nahm der Herr Jesus die Sünden des Menschen an seiner Statt auf sich, damit der Mensch der Bestrafung entkommen konnte, die er für seine Sünden erlitten haben sollte. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die Menschen frei von Sünde waren, geschweige denn, dass sie nie wieder sündigen würden oder vollständig gereinigt wären. Bei der ‚Befreiung des Menschen von der Sünde‘ dagegen wird die sündige Natur der Menschheit vollständig bloßgestellt, damit wir leben können, ohne länger auf unsere verderbte Natur zu vertrauen und so einen Wandel in unserer Lebensdisposition vollziehen und vollständig gereinigt werden können. Daher können unsere verderbten Dispositionen nur gründlich überwunden werden, wenn wir Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen annehmen und nur dann können wir uns aus Satans Einfluss befreien und gerettet werden, in das Königreich Gottes geführt werden und Gottes Verheißungen und Segnungen empfangen.“
Als ich das Wort Gottes und den gemeinschaftlichen Austausch der Schwester vernahm, fühlte ich, dass dies vollständig im Einklang mit der Wirklichkeit stand und sehr praktisch war. Ich dachte an die vielen Jahre zurück, während derer ich gläubig gewesen war: Ich log und betrog nicht nur oft, sondern war zudem arrogant und unbeherrscht, gemein, unverschämt und stur. Die Leute, die für mich arbeiteten, hatten Angst vor mir und hielten Abstand zu mir und sogar in meinem eigenen Haus fürchteten sich meine Frau und meine Tochter ein wenig vor mir. Niemand wollte sich mir öffnen und ich fand nicht einmal einen nahen Freund, dem ich mich anvertrauen konnte. Das war qualvoll und ich fühlte mich hilflos. Obwohl ich oft die Bibel las und betete, dem Herrn meine Sünden bekannte und mich selbst sogar verabscheute, tat ich immer wieder dieselben schrecklichen Dinge. Ich war überhaupt nicht in der Lage, mich zu ändern. Leute wie ich, die ständig sündigen und sich dem Herrn widersetzen, benötigen Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen dringend! Der Herr Jesus ist nun wiedergekehrt – Er ist der menschgewordene Allmächtige Gott. Heute habe ich das Glück, Gottes Stimme zu vernehmen und zu erfahren, dass der Herr Jesus zurückgekommen ist, um uns die Wahrheit zu bringen und das Werk des Richtens, Reinigens und Rettens des Menschen zu vollbringen. Ich bin in höchstem Maße vom Glück begünstigt! Die Schwester sah, dass ich von Sehnsucht erfüllt war, und gab mir ein Exemplar des Buches des Worts Gottes mit dem Titel Gottes Schafe hören die Stimme Gottes. Ich nahm es mit Freuden entgegen und gelobte, meinen Glauben an den Allmächtigen Gott wahrhaftig zu praktizieren!
Nachdem ich das Werk des Allmächtigen Gottes in den letzten Tagen angenommen hatte, las ich viele der Worte Gottes. Ich las von den drei Phasen des Werks Gottes, dem Geheimnis der Menschwerdung, der Bedeutung von Gottes Namen und der wahren Geschichte der Heiligen Bibel sowie darüber, wie die Überwinder geschaffen werden, wie das Königreich Christi realisiert wird, wie das Schicksal und der Bestimmungsort eines jeden einzelnen Menschen festgelegt werden wird und von anderen Aspekten der Wahrheit, über die ich allmählich ein gewisses Verständnis erlangte. Außerdem wuchs mein Vertrauen in Gott.
Als ich Gottes Worte las, die so hart über den Menschen urteilen und ihn bloßstellen, war ich zuerst betroffen, mir wurde mulmig zumute und ich hatte meine eigenen Vorstellungen über sie. Ich fand, dass Gottes Worte zu streng waren. Könnte Er nicht ein wenig sanftmütiger sein? Wenn Gott den Menschen auf diese Weise verurteilt, ist dieser dann nicht verdammt? Wie kann er dann wahrlich gerettet werden? Später las ich Folgendes in Gottes Wort: „In den letzten Tagen setzt Christus verschiedene Wahrheiten ein, um den Menschen zu belehren, das Wesen des Menschen zu offenbaren und seine Worte und Taten zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition Gottes und so weiter. Diese Worte richten sich alle an das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden jene Worte, die offenbaren, wie der Mensch Gott verachtet, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung des Satans und eine feindliche Macht gegen Gott ist. Wenn Gott Sein Werk des Gerichts durchführt, verdeutlicht Gott nicht nur einfach die Natur des Menschen mit nur ein paar Worten; Er wirkt anhand von Enthüllung, Umgang und Zurechtstutzen auf lange Sicht. Diese Methoden der Enthüllung, des sich Befassens und Zurückschneidens können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch nicht im Geringsten besitzt. Nur Methoden dieser Art werden als Gericht erachtet. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch gebändigt werden und völlig überzeugt werden, sich Gott zu fügen und darüber hinaus wahre Gotteskenntnis erlangen“ („Christus verrichtet das Urteilswerk anhand der Wahrheit“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). „Wodurch wird Gottes Vervollkommnung des Menschen ausgeführt? Durch Seine gerechte Disposition. Gottes Disposition besteht vornehmlich aus Gerechtigkeit, Zorn, Majestät, Urteil und Fluch, und Seine Vervollkommnung des Menschen geschieht vornehmlich durch Urteil. Einige Personen verstehen dies nicht und fragen, warum Gott nur durch Sein Urteil und Seinen Fluch den Menschen vervollkommnen kann. Sie sagen: ‚Wenn Gott den Menschen verfluchen würde, würde der Mensch dann nicht sterben? Wenn Gott über den Menschen urteilen würde, wäre der Mensch dann nicht verdammt? Wie kann er dann trotzdem vervollkommnet werden?‘ So lauten die Worte von Personen, die Gottes Werk nicht kennen. Was Gott verflucht, ist der Ungehorsam des Menschen, und worüber Er urteilt, sind die Sünden des Menschen. Obgleich Er barsch und ohne das geringste Feingefühl spricht, offenbart Er alles, was im Menschen ist, und durch diese strengen Worte offenbart Er, was das Wesentliche im Menschen ist, wobei Er durch ein derartiges Urteil dem Menschen eine fundierte Kenntnis über die Wesenheit des Fleisches gibt; und somit unterwirft der Mensch sich dem Gehorsam vor Gott. Das Fleisch des Menschen ist von Sünde und von Satan. Es ist ungehorsam und das Objekt von Gottes Züchtigung – und so müssen die Worte von Gottes Urteil über ihn hereinbrechen, und es muss jede Art der Verfeinerung eingesetzt werden, um es dem Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu kennen. Nur dann kann Gottes Werk wirkungsvoll sein“ („Nur durch die Erfahrung schmerzhafter Prüfungen kannst du die Lieblichkeit Gottes kennen“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). Dank der Worte Gottes sah ich ein, dass Gott Sein Urteilswerk in den letzten Tagen ausführt, indem Er die Wahrheit zum Ausdruck bringt, und dass Er die verderbten Dispositionen, die satanische Natur und die bösen Taten des Menschen, die sich gegen Gott richten, streng verurteilt, sie bloßstellt und verdammt. Er tut dies, damit wir die Wahrheit unserer eigenen Verderbtheit klar erkennen, das Wesen unserer verderbten Dispositionen genau verstehen und unsere eigene satanische Natur und die Quelle unserer Verderbtheit kennen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns selbst hassen und dem Fleisch entsagen können. Außerdem können wir Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit nur sehen sowie unsere eigene Schmutzigkeit, Hässlichkeit und Bosheit nur deshalb klar erkennen, weil Gott durch Sein Urteil und Seine Züchtigung Seine gerechte, majestätische und zornige Disposition zeigt. Gott tut dies auch, damit wir unsere eigene satanische Natur und die Wahrheit über unsere Verderbtheit erkennen mögen. Würde Gott den Menschen nicht so streng richten, würde Gott die Verderbtheit des Menschen nicht bloßstellen, indem Er direkt den Kern der Sache trifft, und würde Er nicht Seine gerechte und majestätische Disposition offenbaren, dann wäre es uns Menschen, die zutiefst von Satan verdorben wurden, unmöglich, über uns selbst nachzudenken und uns selbst zu kennen. Wir wären außerstande, die Wahrheit über unsere eigene Verderbtheit und unsere satanische Natur zu erfahren. Wenn dem so wäre, wie würden wir uns dann von unserer sündigen Natur befreien und gereinigt werden? Durch die Wirkung von Gottes strengen Worten können wir sehen, dass sich in ihnen Gottes wahre Liebe zum Menschen und die schmerzvollen Mühen verbergen, die Er auf sich nimmt, um den Menschen zu retten. Je mehr ich von Gottes Worten las, desto stärker fühlte ich, wie wunderbar Gottes Urteilswerk ist. Gottes Werk ist so praktisch! Nur Gottes strenges Urteil kann den Menschen reinigen, wandeln und retten. Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen ist wahrlich was wir benötigen!
Aufgrund meiner arroganten und außerordentlich selbstgerechten Natur belehrte ich andere oft auf herablassende Weise, wenn ich zu ihnen sprach, und ich handelte nur nach meinen eigenen Gesetzen. Mir gefiel es immer, wenn andere auf mich hörten und ich neigte dazu, mich aufzuspielen. Bei Versammlungen hielt ich mehrere Male darüber Gemeinschaft, wie ich bei der Arbeit Probleme in meiner Abteilung gelöst hatte, wie ich Angestellte gerügt hatte, die die Anweisungen nicht befolgt und sich ihnen nicht gebeugt hatten, sowie darüber, wie meine Frau und Tochter taten, was ich von ihnen verlangte. Besonders wenn ich Gemeinschaft über Gottes Worte führte, sagte ich Dinge wie: „Ich glaube, diese Textstelle von Gottes Worten bedeutet das“ und „so denke ich“. Ein Bruder bemerkte, dass ich ständig eine arrogante und selbstgerechte Disposition offenbarte, ohne dass ich mir selbst darüber bewusst war. Er machte mich bei einer Versammlung darauf aufmerksam und sagte, dass es ein Ausdruck von Arroganz, Selbstgerechtigkeit und Unvernunft sei, so zu sprechen und zu handeln. Hätte mich früher irgendjemand so bloßgestellt, noch dazu vor so vielen Leuten, hätte ich mich bestimmt dagegen gewehrt und sofort widersprochen. Doch dieses Mal zog ich es vor, still zu sein, nicht zu streiten oder mich zu rechtfertigen, denn mir kamen die folgenden Worte aus einer Predigt in den Sinn: „Wenn du bei jeder Sache, auf die du triffst, ständig ‚ich glaube‘ sagst, nun ja, dann solltest du dich besser von deinen Meinungen lösen. Ich bitte dich dringend, dich von deinen Meinungen zu lösen und nach der Wahrheit zu suchen. Sieh nach, was Gottes Worte sagen. Deine ‚Meinung‘ ist nicht die Wahrheit! … Du bist zu arrogant und selbstgerecht! Angesichts der Wahrheit kannst du noch nicht einmal deine eigenen Auffassungen und Vorstellungen loslassen oder zurückweisen. Du willst Gott nicht im Geringsten gehorchen! Wer von denen, die wirklich nach der Wahrheit streben und wirklich ein Herz haben, das Gott verehrt, sagt noch ‚ich glaube‘? Dieser Spruch ist bereits beseitigt worden, denn dadurch, dass man ihn sagt, offenbart man seine satanische Disposition“ („Predigten und gemeinschaftlicher Austausch über Gottes Worte ‚Eine echte Beziehung zu Gott aufzubauen ist sehr wichtig‘ (III)“ in „Predigten und gemeinschaftlicher Austausch über den Eintritt in das Leben XIV“). Dieser gemeinschaftliche Austausch erinnerte mich dran, dass mir jedes Mal, wenn ich auf ein Problem stieß, Worte wie „ich denke,“ „ich finde“ und „ich glaube“ auf der Zunge lagen. Immer fing ich mit dem Wörtchen „ich“ an und immer hatte ich zu allem das letzte Wort. Ich glaubte, dass ich die Dinge selbst durchschauen und Probleme bewältigen könnte. Immer brachte ich andere dazu, zu tun, was ich sagte, und mir zu gehorchen. Offenbarte ich dadurch, dass ich stets eine hohe Meinung von mir hatte, nicht eine arrogante Disposition? Der Bruder hatte in all dem recht, als er mich auf meine Disposition hinwies, und ich sollte es annehmen. Die Dinge, von denen ich annahm, dass sie aus meinen Auffassungen und Vorstellungen hervorgingen, kamen von Satan und sie waren gewiss nicht die Wahrheit. Ich dachte daran, wie ich mich immer benahm, als wäre ich die Nummer Eins, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit oder unter Kollegen. Wenn jemand nicht auf mich hörte oder etwas tat, das nicht meinen Ansichten entsprach, wurde ich wütend und wies ihn zurecht. Dass ich solche Verhaltensmuster an den Tag legte, bedeutete, dass es in meinem Herzen keinen Platz für Gott gab, dass ich nicht Gott, sondern vielmehr mich selbst als groß verehrte. So sprach und benahm ich mich für gewöhnlich und bewies damit, was für eine unglaublich arrogante Disposition ich habe!
Später las ich die folgenden Worte Gottes: „Wenn du wirklich die Wahrheit in dir hast, wird der Weg, den du gehst, natürlicherweise der richtige Weg sein. Ohne die Wahrheit ist es leicht, Böses zu tun und du wärest nicht in der Lage, dir selbst zu helfen. Zum Beispiel, wenn du Arroganz und Selbstgefälligkeit hättest, würdest du es unmöglich finden, es zu unterlassen, dich Gott zu widersetzen. Du würdest dich genötigt fühlen, dich Ihm zu widersetzen. Du würdest es nicht absichtlich tun; du würdest es unter der Dominanz deiner arroganten und eingebildeten Natur tun. Deine Arroganz und deine Selbstgefälligkeit brächten dich dazu, auf Gott herabzusehen und Ihn als unbedeutend anzusehen; sie brächten dich dazu, dich selbst zu erhöhen, sie brächten dich dazu, dich ständig zur Schau zu stellen und schließlich brächten sie dich dazu, dich an Gottes Stelle zu setzen und für dich selbst Zeugnis abzulegen. Am Ende würdest du deine eigenen Ideen, dein eigenes Denken und deine eigenen Vorstellungen zu Wahrheiten machen, die angebetet werden, von der, wie viel Böses von Menschen unter der Vorherrschaft ihrer arroganten und selbstgefälligen Natur verübt wird! Um ihr böses Handeln zu unterbinden, muss man zunächst das Problem der eigenen Natur lösen. Ohne eine Veränderung in der Disposition ist es unmöglich, dieses Problem grundlegend zu lösen“ („Nur durch Verfolgen der Wahrheit kannst du Änderungen in deiner Disposition erreichen“ in Aufzeichnungen der Vorträge Christi). Jedes von Gott gesprochene Wort ist die Wahrheit – davon war ich zutiefst überzeugt. Ich dachte daran, wie ich andere früher auf herablassende Weise belehrt hatte, ob auf Baustellen, im Büro oder zu Hause. All dies geschah, weil ich von meiner satanischen, arroganten Natur beherrscht wurde, nicht weil ich ein zorniger Mensch war, einen schlechten Charakter hatte oder es mir an Selbstkontrolle fehlte. Ich glaubte, ich habe Kaliber und Talent und könne jede Menge Geld verdienen, was mich noch arroganter werden ließ und zu meinem Lebensmotto wurde, sodass ich dachte, ich sei besser als andere. Ich sah auf alle anderen herab, stellte mich über alle anderen und kommandierte ständig andere Leute herum. Ich hatte die Quelle meiner Sünde gefunden und erkannt, welche gefahrvollen Folgen es hätte, wenn ich meine satanische und verderbte Disposition nicht überwände. Daher strengte ich mich an, aufzuschauen und viele von Gottes Worten zu lesen, in denen Er die arrogante Natur des Menschen richtete und bloßstellte, und dachte in diesem Zusammenhang über mich selbst nach. Durch Gottes Worte des Urteils und des Offenbarens sowie durch den gemeinschaftlichen Austausch der Brüder und Schwestern in Versammlungen begann ich ein oberflächliches Verständnis meiner eigenen arroganten Natur zu erlangen. Ich erkannte, dass ich in Wirklichkeit nicht besser war als irgendein anderer und dass es Gott gewesen war, der mir meine Fähigkeit und meinen Wohlstand zuteilwerden lassen hatte, sodass es nichts gab, mit dem ich prahlen könnte. Hätte Gott mir nicht Weisheit und Intelligenz zuteilwerden lassen, hätte Gott mich nicht gesegnet, was hätte ich dann tun können, indem ich nur auf mich selbst vertraute? Es gibt so viele begabte Menschen in der Welt – weshalb mühen sie sich ihr Leben lang ab und hetzen sich ab, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen? Ich fand auch den Weg, um meine arrogante Natur im Einklang mit Gottes Worten zu überwinden: Ich musste es eher annehmen, dass die Brüder und Schwestern mich zurechtstutzten und sich mit mir befassten, musste mehr von Gottes Urteil, Züchtigung, Prüfungen und Läuterung annehmen, in Anbetracht von Gottes Worten über mich nachdenken, wahre Selbsterkenntnis und wahren Selbsthass erlangen und nicht mehr gemäß meiner satanischen Disposition sondern gemäß Gottes Worten handeln. Später wurde ich oft gerichtet und gezüchtigt, man stutzte mich oft zurecht und befasste sich mit mir und ich erlitt viele Rückschläge und Misserfolge. Meine Kenntnis über meine satanische Natur und mein verdorbenes Wesen vertiefte sich allmählich und ich erlangte auch ein oberflächliches Verständnis von Gottes Größe, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Je mehr ich von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verstand, desto klarer erkannte ich, wie schmutzig, niedrig, bedeutungslos und erbärmlich ich war. Die Dinge, die ich vorher als wichtig erachtet oder mit denen ich geprahlt hatte, empfand ich nicht einmal mehr als erwähnenswert. Ehe ich mich versah, begann sich meine arrogante Disposition zu wandeln. Wer immer etwas sagte, was richtig war, – ob Brüder und Schwestern, meine Kollegen oder meine Familie – so akzeptierte ich es. Ich sprach nicht länger in herablassender Weise zu anderen, sondern handelte mit Demut, und lebte nicht länger nach meinen eigenen Gesetzen. Wann immer ein Problem aufkam, diskutierte ich mit anderen darüber und handelte gemäß dem Vorschlag dessen, der recht hatte. Nach und nach normalisierten sich meine Beziehungen zu den Menschen um mich herum. Mein Herz war voller Friede und Freude und ich spürte, dass ich endlich ein wenig das Abbild eines Menschen auslebte.
Da ich ständig Gottes Wort las und ein kirchliches Leben führte, fühlte ich mehr und mehr, wie wahrhaft großartig es war, dass ich Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen annehmen durfte. Ich stellte aufrichtig fest, dass ich meine verderbte Disposition unter keinen Umständen selbst überwinden könnte. Erst durch das Urteil und die Züchtigung der Worte Gottes wurde ich allmählich verändert und gereinigt. In der Kirche des Allmächtigen Gottes sehe ich, wie viele Brüder und Schwestern hart daran arbeiten, nach der Wahrheit zu streben und das Urteil und die Züchtigung der Worte des Allmächtigen Gottes anzunehmen. Jedes Mal, wenn jemand Verderbtheit offenbart, weisen die anderen ihn darauf hin und alle helfen einander. Wir denken alle im Licht von Gottes Worten über uns selbst nach und wir streben nach der Wahrheit, um unsere Verderbtheit zu überwinden. Alle praktizieren, ehrliche Menschen und rein und offen zu sein. Wir nehmen jeden gemeinschaftlichen Austausch an, der im Einklang mit der Wahrheit steht, und fügen uns ihm und unsere verderbten Dispositionen wandeln sich mehr und mehr. Die Worte des Allmächtigen Gottes können die Menschen in der Tat reinigen und verändern. Der menschgewordene Gott ist unter uns gekommen, Er selbst bringt Seine Worte zum Ausdruck, um uns zu richten und zu reinigen, und Er führt uns, damit wir die Sünde abstreifen und vollkommen gerettet werden – wir sind so sehr vom Glück begünstigt! Da ich an all die wahren Gläubigen dachte, die ungeduldig auf Seine Wiederkehr warten und sich danach sehnen, die Fesseln der Sünde abzustreifen und gereinigt zu werden, aber dennoch in Schmerzen leben und keinen Weg haben, dem sie folgen können, sprach ich ein Gebet zu Gott und gelobte: „Ich will anderen Menschen das Evangelium Deines Königreichs predigen, damit sie es mir gleichtun können, Deinen Fußstapfen folgen, den Weg der Reinigung betreten und die Rettung vollständig abschließen können!“
Der Artikel stammt aus „Die Kirche des Allmächtigen Gottes“
0 notes
Text
Chapter Three
Am Montag sah Louis Harry wie immer in der Mittagspause in der Cafeteria. Er saß dort mit seinem besten Freund Niall an ihrem Stammplatz, Harry holte sich gerade vorn an der Ausgabe etwas zu Essen. Der letzte vor ihm nahm gerade sein Tablett und balancierte es zu einem der Tische. Harry wollte der Frau an der Theke gerade sagen, was er essen wollte, als er von einem Jungen weg geschubst wurde.
„Weg da, Styles“, brummte dieser nur und er wusste, dass Harry sich nicht wehren würde. Das machte es ihm umso leichter.
„Hier wird nicht gedrängelt“, murrte die rundliche Frau an der Ausgabe gelangweilt. Sie scherte sich eigentlich einen Dreck darum, wer wann was wollte und ob dabei gedrängelt wurde oder nicht.
„Er hat mir nur den Platz freigehalten, stimmt’s, Harry?“ Er drehte sich zu ihm um. Harry sagte nichts, senkte den Kopf und schloss für einen Moment lang die Augen, um sich zu besinnen. Er konnte sich nicht gegen ihn durchsetzen, das wusste er, daher versuchte er es gar nicht erst.
„Warte kurz“, sagte Louis ein paar Tische weiter zu Niall und stand auf. Er ging hinüber zur Ausgabe und zog den Jungen aus Harrys Jahrgang aus der Reihe.
„Stell dich hinten an, du Idiot.“ Harrys Blick begegnete dem von Louis. Der Junge aus seiner Klasse sah zu Louis und dann zu Harry.
„Oh, Styles, holst du jetzt schon deinen großen Bruder aus der Oberstufe?“
„Er ist nicht mein Bruder und jetzt stell dich hinten an.“
Er riss sich aus Louis’ Griff los und ging mit argwöhnischem Blick ans Ende der Schlange.
„Danke, das war echt nett, aber das wäre nicht nötig gewesen, wirklich“, murmelte Harry, während er sich sein Essen geben ließ.
„Er hat nicht das Recht, dich herumzuschubsen und sich vorzudrängeln, und das muss ihm jemand zeigen.“
Dass Louis es damit wahrscheinlich nur noch schlimmer gemacht hatte, traute er sich nicht zu sagen.
„Ich komme auch allein gut klar, Louis.“
„Das sah nicht danach aus.“
„Ich brauche keinen Beschützer“, murmelte Harry leise.
„Willst du dich trotzdem zu uns an den Tisch setzen?“, fragte er und nickte mit dem Kopf in Richtung des Tisches, an dem Niall gerade allein in seinem Essen herum stocherte.
„Nein, lieber nicht.“ Er stellte sein Tablett auf einem leeren Tisch ab und setzte sich. Louis war verwirrt. Harry hatte gestern so nett gewirkt, ganz anders als jetzt. Er war völlig verschlossen, redete kaum und wirkte eingeschüchtert. Vielleicht lag es nur an der Situation, aber Louis hatte das Gefühl, dass Harry nichts mit ihm zu tun haben wollte. Zwar hatte sich Harry vor ihrem gestrigen Gespräch nie anders verhalten, hatte nie mit jemandem geredet, hatte immer allein an dem Tisch in der Mitte gesessen und für sich allein gegessen und war in den Pausen immer abgeschottet von den anderen gewesen, aber Louis hatte gedacht, sie hätten jetzt einen Draht zueinander. Aber da hatte er sich wohl geirrt. Gestern hatte Louis zum ersten mal den Eindruck gehabt, Harry wäre wie jeder andere, aber das war wohl doch nicht der Fall. Er wollte schlichtweg keine Freunde haben, so wirkte es zumindest. Jeder an der Schule wusste, dass mit Harry etwas nicht stimmte, aber niemand hatte ihn je darauf angesprochen. Es schien immer, als lebte er in seiner eigenen Welt, manchmal sah er ganz abwesend aus.
Louis erwischte sich während der Mittagspause noch ein paarmal dabei, wie er über seine Schulter hinweg zu Harry blickte, wie er allein dort saß und aß. Niemand setzte sich zu ihm an den Tisch, so wie fast immer. Und wenn es doch mal geschah, dann räumte Harry sein Tablett auf, selbst wenn er noch nicht mit dem Essen fertig war, und ging einfach. Louis musste sich eingestehen, dass er wohl mehr als nur manchmal auf Harry geachtet hatte. Er war eben sonderbar. Während die meisten an der Schule ihn für irre hielten, sah Louis an ihm seit dem gestrigen Abend eine neue Seite. Er war nicht irre, eher sonderbar. Er war eben nicht wie alle. Er versteckte sich, isolierte sich. Es war nicht so, dass er schüchtern war, er antwortete auch nicht, wenn man ihn etwas fragte. Er war einfach in seiner eigenen kleinen Welt, in der es nur ihn selbst gab.
„Er ist ein Freak, wieso hast du ihm geholfen?“, Niall holte seinen besten Freund in die Realität zurück, denn er starrte den Lockenkopf, der allein am Tisch saß, schon eine ganze Weile lang an.
„Er ist kein Freak.“ Louis schüttelte den Kopf.
„Als ob du davon eine Ahnung hättest.“ Niall schnaubte.
Louis spielte kurz mit dem Gedanken, ihm von ihrer kurzen Unterhaltung gestern Abend zu erzählen, entschied sich aber doch dagegen.
„Ich glaube, er ist eigentlich ganz normal“, sagte er stattdessen.
„Er ist nicht normal. Die ganze Mittelstufe weiß es und du auch.“ Niall sprach mit vollem Mund. Es klang ekelhaft und sah auch so aus, aber Lou war die Marotten seines besten Freundes bereits gewohnt.
Louis beließ es dabei. Es brachte ja doch nichts, darüber zu diskutieren. Niall hatte wahrscheinlich sowieso recht, denn Harry hatte sich heute von einer wieder neuen Seite gezeigt, die er nicht gekannt hatte.
Es war nicht so, als wollte Harry keine Freunde haben. Wirklich nicht. Er hätte sich gefreut, hätte er jemanden gehabt, mit dem er sich unterhalten konnte, Spiele spielen und was immer Jugendliche so taten. Harry war sich gar nicht sicher. Fußballspielen, Videospiele und sich über ihre Handys schreiben. Harry hatte aber gar kein Handy. Er konnte auch nicht wirklich gut Fußball spielen, das hatte er schon lange nicht mehr getan. Er konnte auch keine Freunde zu sich einladen, denn er hatte nur eine Matratze. Videospiele hatte er auch nicht, er hatte ja nicht mal eine Konsole. Er konnte auch keine spielen, denn das hatte er noch nie. Keiner dieser Gründe war jedoch der wesentliche Grund dafür, warum er keine Freunde hat und es überhaupt mied, mit allen Menschen zu sprechen. Er hatte Angst. Angst davor, dass es aufkam, dass es jemand erfuhr. Und noch mehr Angst hatte er vor den Folgen, die es mit sich zog. Niemand wollte etwas zu tun haben mit einem Jungen wie Harry. Er hatte keinerlei Durchsetzungsvermögen oder Selbstsicherheit. Er war nur ein Junge, der restlos von seinem Vater ausgenommen wurde. Jeder hätte es als krank, abscheulich oder einfach nur widerlich angesehen. Niemand würde in Harry noch Harry sehen, sondern nur noch das, was ihm sein Vater antat.
Nach der Mittagspause hatte Harry Sport. Er war ziemlich unsportlich und hatte auch dementsprechende Noten. Er war eben nicht so wie die anderen schon seit Jahren in einem Fußball-, Basketball- oder Handballverein oder schwamm oder machte sonst irgendwie Sport. Harry durfte eigentlich gar nicht vor die Tür und er tat es auch nicht. Um sich selbst zu schützen.
Auf dem Weg von den Umkleidekabinen zu den Sporthallen erhaschte Harry einen kurzen Blick auf Louis und war verwirrt. Er ging in die selbe Sporthalle wie die anderen auch.
Der Lehrer machte eine Ankündigung, um die allgemeine Verwirrung von Harrys Klasse aufzuklären. „Wegen des kurzfristigen Ausfalls von Mr. Goldfield über einen wahrscheinlich längeren Zeitraum, werden die elften Klassen vorübergehend mit den zehnten Klassen gemeinsam Sport haben. Das bedeutet, wir haben eine größere Klasse und ich habe weniger Zeit euch alle zu benoten. Also lasst uns keine Zeit verlieren und baut die Geräte auf.“
„Ich hab gehört, Goldfield hat sich am Knie verletzt. Irgendwas mit der Kniescheibe“, schnappte Harry auf dem Weg in den Geräteschuppen auf. Das kam ihm gerade noch recht. Harry war unfreundlich zu Louis gewesen und wurde nun mit mehreren Monaten des gemeinsamen Unterrichts mit eben jenem bestraft. Das konnte ja noch witzig werden.
Harry stellte sich beim Geräteturnen wie immer recht ungeschickt an im Gegensatz zu seinen Mitschülern. Er war eben ein Schwächling und kaum imstande dazu, seinen eigenen Körper hochzustemmen. Meistens war er schon nach der Aufwärmrunde erschöpft und total verschwitzt. Ihm war klar, dass seine Mitschüler ihn oft dafür belächelten, aber was sollte er schon dagegen tun? Heute tat ihm noch dazu der Rücken höllisch weh, weil er mit der Matratze auf dem Boden geschlafen hatte.
„Hey … uhm … ich weiß einen Trick, dann tust du dir vielleicht etwas leichter“, quatschte Louis Harry von hinten an. Harry schloss die Augen. Das hatte ihm jetzt gerade noch gefehlt. Ich brauche keine Hilfe, schon gar nicht von dir. Harry beschloss, einfach gar nicht mit ihm zu reden. So wurde er die meisten Leute schnell wieder los. Klar, es war unhöflich, aber für Harry war es schwer, sich mit Leuten zu unterhalten. Sie verstanden ihn eben nicht und er sie genauso wenig. Es war als kämen sie von zwei verschiedenen Welten. Keiner von ihnen hatte sich je mit Harrys Problemen herumschlagen müssen, Harry wiederum hatte nie ihr Leben gelebt.
„Sorry, falls ich dir vorhin irgendwie den Eindruck vermittelt habe, du könntest nicht für dich selbst handeln. Ich wollte nur … na ja, ich hatte eben das Gefühl, du kommst nicht klar. Wie auch immer. Ich lass es ab jetzt. Du brauchst meine Hilfe nicht.“ Eigentlich brauchte Harry sie sehr dringend und das wusste er auch, nur ging es eben nicht. Harry und Louis konnten keine Freunde sein, das würden sie auch nie. Sie waren einfach zu verschieden. Harry kam eben von einem ganz anderen Stern. Sie würden sich niemals verstehen, wären nicht einmal auf einer Wellenlänge oder würden einander vertrauen. Louis vielleicht Harry, aber nicht umgekehrt. Harry konnte niemandem vertrauen. Es war nicht so, als hätte jemand sein Vertrauen missbraucht, aber er fürchtete sich davor, das jemand etwas nicht für sich behalten konnte. Etwas ganz Bestimmtes.
„Wie auch immer, ich wollte dich fragen, ob du später schon was vorhast. Hast du?“ Harry war verblüfft, das tatsächlich jemand etwas mit ihm zu tun haben wollte, schließlich hatte er nicht wirklich den besten Ruf an der Schule. Hin und wieder hörte er Mitschüler über ihn reden, manchmal sogar, wenn er in der Nähe war.
„Keine Ahnung, warum du denkst, du müsstest dich mit mir anfreunden“, keuchte der Jüngere.
„Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie du es ablehnen würde, mit jemandem abzuhängen, wenn er es auch noch angeboten bekommt“, erwiderte Louis spitz.
„Jemand wie ich?“
„Jemand, der immer allein ist und keinen einzigen an der ganzen Schule hat, mit dem er sich überhaupt unterhalten kann. Du bist nicht wirklich jemand, der sich vor Freunden kaum retten kann. Ich wollte nur nett sein, aber wenn du nicht abhängen willst.“ Er zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht, worauf du es abgesehen hast, aber von mir aus. Ich muss um sieben zuhause sein, vorher kannst du mir ja erzählen, was du überhaupt von mir willst.“ Harry wollte sich wirklich nicht so anstellen, er wusste gar nicht, was in ihn gefahren war, so stur und unhöflich zu sein. Er wollte schon lange wieder einen Freund haben.
Nach dem Geräteturnen blieb ihnen noch etwas Zeit, um eine Runde Zombieball zu spielen. Die Regeln waren simpel; Es gab keine Mannschaften, jeder spielte gegen jeden. Es gab drei Bälle, wer getroffen wurde, wurde zum Zombie und hatte damit verloren. Der letzte übrige „Mensch“ hatte dann gewonnen. Harry hasste dieses Spiel. Er fühlte sich dabei wie ein herum gescheuchtes Schaf, das von drei Seiten attackiert wurde. Noch dazu überragten ihn die meisten Elftklässler mit einem ganzen Kopf und kamen so wesentlich leichter an fliegende Bälle heran. Aus dem Nichts traf Harry ein unerwartet harter Ball am Rücken und er fiel um wie ein Sack Kartoffeln. Es tat so weh, dass Harry mehrmals nach Luft schnappte, als er dort auf dem Boden lag. Bei seinem Sturz hatte er sich auch noch das Knie auf dem Boden angeschlagen. Verdammt. Louis kam auf ihn zu gerannt und half ihm auf die Beine. Harry musste die Zähne zusammen beißen und nickte nur auf die Frage, ob alles okay sei. Er schleppte sich etwas humpelnd zu der Bank am Rand der Halle, wo auch die anderen Zombies saßen. Er hielt sich so unauffällig wie möglich den Rücken und rieb über die schmerzende Stelle. Er hätte schwören können, dass der Treffer ihn kurz ohnmächtig hatte werden lassen.
Harry war froh, als sie nach der Runde endlich in die Umkleiden durften. Er war aber nur so lange froh, bis er mitbekam, wie sich alle über seinen legendären Sturz lustig machten. Er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr ihn das verletzte, zog sich schneller um als alle anderen und verließ die Umkleidekabine sofort. Harry hatte sich noch nie über jemanden lustig gemacht, womit hatte er es also verdient, dass alle über ihn lachten? Er begann sich zu fragen, ob es der Grund war, aus dem Louis ihn zu sich eingeladen hatte. Weil er sich insgeheim auch über ihn lustig machte und nur herausfinden wollte, ob er wirklich so komisch war, wie alle es von ihm dachten. Und dass er dann seinen Freunden von dem dummen Zehntklässler erzählen konnte, der doch ernsthaft glaubte, er wollte eine Freundschaft mit ihm. Damit hätte er sich noch mehr über ihn lustig machen können. Harry ritt sich so sehr in diese Logik hinein, dass es für ihn gar keinen anderen Grund gab, warum Louis eigentlich mit ihm „abhängen“ wollen könnte. Er setzte sich auf eine Bank auf dem Pausenhof und wartete darauf, dass Louis die Sporthalle verließ. Wegen seines neuen Zweitjobs konnte sein Vater ihn nicht von der Schule abholen. Eigentlich ging er immer zu Fuß nachhause oder fuhr ein paar Stationen mit dem Bus. Früher hatte sein Dad ihn immer morgens zur Schule gebracht und nachmittags abgeholt, jetzt konnte er ihn nur noch morgens bei der Schule absetzen, dann schlief er ein paar Stunden und ging zu seinem Zweitjob. Er tat echt alles, damit sie das Haus behalten konnten, in dem Harry aufgewachsen war. Wenn es mit dem Geld nicht mehr hinreichte, würde Harry wohl auch einen Minijob annehmen müssen. Das Haus war viel zu groß für sie beide allein, aber die verbanden beide viele Erinnerungen damit und sie wussten beide, dass sie es nicht kampflos aufgeben könnten. Die Küche, in der Harrys Mutter immer fröhlich zu ihrer Rockmusik tanzend gekocht hatte, das Wohnzimmer, wo sie immer gemeinsam am Wochenende ferngesehen hatten, das große Schlafzimmer von Harrys Eltern im ersten Stock, wo er hin und wieder zu ihnen unter die Decke gekrochen hatte. Das Badezimmer, von dem Harry noch von Kinderfotos gesehen hatte, wie seine Eltern ihn als Baby im Waschbecken gebadet hatten. Das Atelier, wo Harrys Mutter oft stundenlang mit Gemälden aller Art beschäftigt gewesen war. Auch Harry hatte dort als kleiner Junge schon die ein oder andere Leinwand bemalt. Harrys Schlafzimmer, wo seine Mom ihm abends vorgesungen oder vorgelesen hatte, wo sie unter dem Bett immer ganz gründlich nach Monstern gesucht hatte, wo Harry den ganzen Tag mit Spielkameraden verbracht hatte. Der Garten, wo seine Mutter im Frühjahr immer etliche verschiedene Blumen und Samen gepflanzt hatte. Wo sie im Sommer immer gegrillt hatten. Wo sie im Herbst in dem fallenden, bunten Laub getanzt hatten. Wo sie im Winter immer einen Schneemann gebaut hatten.
Nun ja, sie bauten nun keine Schneemänner mehr, tanzten fröhlich im Laub, grillten oder pflanzten Blumen und Gemüse. Am Esstisch in der Küche standen nun nur noch zwei Stühle statt dreien. Das Atelier war nur noch als Abstellkammer für Harrys Besitztümer gut genug. Die riesige Sammlung von Moms Rock-CDs war im Keller verschwunden und auch sonst alles, was an sie erinnerte. Harry durfte gar nicht in den Keller. Sein Vater meinte es nur gut. Er sagte immer, das würde er sowieso nicht verkraften.
#onedirection#1D#fanfic#1d fanfcition#larry#larrystylinson#louistomlinson#harrystyles#niallhoran#german#deutsch#fanfiktion#child abuse#sad#lovestory
1 note
·
View note
Text
Vorhang auf! / Applaus für den Weltuntergang
Die Welt ist eine Bühne – und wir sind die Schauspieler darauf.
So habe ich gelebt. Als wäre die Welt nur eine Fassade, nur ein Ort des Spiels. Und das Leben ist die fiktive Handlung. Das Drama. Der Grund, weshalb manche Menschen im Publikum saßen und andere kein Interesse hatte, Zuhause blieben.
Mein Theater war nie gut besucht. Bis heute weiß ich nicht, ob das im Nachhinein besser für mich war. Wahrscheinlich. Denn ohne Publikum kein Schauspiel.
Es existiert einfach kein Schauspiel, wenn es kein beobachtendes Publikum gibt. Wo kein Beobachter, da keine Handlung. Dieser Gedanke trieb mich in den Wahnsinn. Meine Ängste vor der Zukunft und den Menschen veranlassten mich in die Tiefen der Philosophie zu springen, ohne genaue Richtung, ohne Luft holen zu wollen. Einfach nur abtauchen und nie wieder hochkommen.
Vor vier Jahren fing es an, dass ich mich fragte: wo zur Hölle ist die Grenze zwischen hier und dort? Wo besteht die Verbindung zwischen mir und allen anderen Menschen? Gab es eine? Und wenn ja – warum kam niemand auf mich zu? Warum scheiterte ich daran, mich anderen zu nähern?
Das Beziehungsaus war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das Glas war schon immer voll, und je tiefer ich mich in den Gedanken hineinsteigerte diese Welt sei nicht real, umso realer erschien mir die Idee, ich sei nur ein Statist. Eine Figur im Hintergrund, der keine größere Rolle beigemessen wurde. Nur ein Platz füllendes Objekt, welches maximal zur Ablenkung von der Haupthandlung eingesetzt wurde.
Nur was war die Haupthandlung?
Ich musste es wissen! Ich verschlang ganze Wikipedia-Einträge über Platon und andere antike Philosophen, ich recherchierte alle möglichen die Wirklichkeit beschreibenden Weltbilder wahnsinniger Männer und Frauen der Moderne und driftete dabei immer weiter von meinen Mitmenschen ab. Wenn ich mit meinen Freunden darüber diskutierte, was nach unserem Tod passierte und ob die Welt möglicherweise nur ein Programm höherer Wesen sei, winkten sie nur mit der Hand vor dem Gesicht, so als hielten sie mich für einen Verschwörungstheoretiker. Aber für mich war das mehr, als nur die verrückte Idee eines Philosophen, der zu viel Zeit mit sich allein verbracht hatte. Für mich war der Gedanke, alles tun zu können, was ich wollte, weniger ein Versprechen der Eltern, um ihre Kinder zu ermutigen, sondern der Beweis für die Nichtigkeit des Lebens. Dass alles irgendwann zu Null werden würde.
Das einzige, was mich daran hinderte Straftaten zu begehen war die Angst mit der Überschreitung der Grenzen das Spiel zu beenden.
Das ist schwer zu verstehen für Außenstehende, die keine Ahnungen haben (können!), wie sich jemand fühlt, der allem und jedem misstraut. Ich versuche es aber einmal zu erklären.
Die Welt ist eine Projektion, ein Programm. Ich bin Teil dieses Programms, extra für mich wurde diese Welt kreiert. Ich kann auf alles und jeden reagieren, ich kann tun was ich will. Denn da diese Welt auf meine im Vorhinein bestimmten „Bedürfnisse" abgestimmt ist, ist diese Welt perfekt für mich. Perfekt in dem Sinne, als dass mir ihre „Bedienung" sofort leicht fällt. Das heißt, was immer ich tun wollte, wer immer ich werden wollte – ich könnte es tun und ich könnte es sein. Ich bräuchte nur darauf zu vertrauen, davon fest überzeugt zu sein, dann könnte ich von jetzt auf gleich zehn Jahre älter und der Regierungschef sein. „Ohne" etwas getan zu haben, denn Raum und Zeit sind nur die Fantasien, die mein Verstand erschafft, um aus mir die Überzeugung herauszukitzeln.
Jetzt der Zweifel: wenn ich täte, was ich wollte (stehlen, verletzen, im schlimmsten Fall sogar morden), wenn ich damit auch nur anfinge – dann wäre die Welt sofort zu Ende. Alles würde aufhören zu existieren, die Grenzen würden gesprengt und ich wäre im Nichts oder in der Hölle oder sonst wo, wo ich nicht sein wollte. Das ist widersprüchlich zu dem Gedanken, ich dürfe die Welt formen wie ich wollte. Doch eben genau das machte mich so sehr traurig. Ich vertraute dieser Welt nicht. Ich vertraute dem Schöpfer der Welt ebenso wenig wie meiner Familie, meinen Freunden, den Nachbarn, den Tyrannen, den armen Kindern in 3.-Welt-Ländern. Mein Misstrauen reichte bis in die kleinsten Ecken der Realität, alles war vorgetäuscht und gelogen und im Hintergrund lachte man über meinen Versuch zu ergründen, was vielleicht doch echt war.
Es war der Horror, wie man ihn aus hanebüchenen Filmen kennt.
Der Zweifel an der Realität.
Ich wurde so kalt und hart im Innern, auch wenn die Glut in mir nie erlosch, was mich wohl immer von tatsächlich Depressiven unterschied. Aber allein die Vorstellung, nicht mehr die Chance zu bekommen zu tun, was ich nebst grenzüberschreitenden Straftaten und Realität zerreißenden Dingen tun wollte, hielt mich hier.
Ich glaube ich weiß heute, wieso in meinen Träumen und in meinem Kopf, wenn ich die Augen schloss, schwebte.
Früher schwebte ich immer wenige Zentimeter bis etliche Meter über dem Boden; Traumfiguren rissen mich manchmal auf die Oberfläche zurück, wenn ich danach verlangte oder sie mich angreifen wollten.
Ich betrachtete die Welt immer von oben herab, distanziert, nicht dazu gehörig. Vorsichtig wartend, was als nächstes passierte und ja darauf vorbereitet.
Ich fragte mich immer, ob es möglich war, dass ein Flugzeug über unserem Haus abstürzen und damit unsere Leben auslöschen könnte. Oder ob aus dem Nichts ein Meteorit unsere Erde treffen und alle Lebewesen und Bauten der Menschheit ausradieren könnte. Wenn das möglich wäre, wenn Zufälle und Katastrophen passieren konnten, wäre ich nicht „allmächtig" über mein Leben.
Dieser Gedanke hielt mich vor drei Jahren fast jede Nacht wach und trieb mich in den Wahnsinn. Ich hielt es für durchaus möglich, dass solche Katastrophen jeden Moment möglich sein würden und wollte viele Nächte nicht schlafen. Aus Angst nicht das getan zu haben, was ich noch tun wollte. Dennoch fing ich irgendwann an, mir vorzustellen wie es wäre, wenn plötzlich ein Meteorit meine Stadt traf, oder zumindest nahe genug einschlug, damit der Feuersturm alles niederwalzte. Niemand würde lange Schmerzen haben, es wäre so heiß, dass wir nahezu augenblicklich in Ohnmacht fallen und wenige Sekunden später ohnehin verglüht wären.
Das wäre das Ende gewesen und alles, was ich kannte wäre wieder nichts.
Ein Spektakel, dachte ich. Ein pompöses Ende und ich sehnte mich so sehr danach. So sehr, dass ich mir vorstellte, ich werfe einen Stein gen Erde und sitze klatschend in meinem Flugobjekt Kilometer weit über dem Boden und genieße den Anblick.
0 notes
Text
shifter 2
„O-okay wo zur Hölle ist die Toilette!“, schnaufte Eunsook und platzierte ihren Koffer auf ihrem Fuß woraufhin sie ein kehliges Geräusch des Schmerzen ausstieß und das Gesicht noch mehr verzog. Ihre Brille auf der Nase war verrutscht, das schwarze, wirre Haar mit weißen Strähnen durchzogen und ihre Nase schon wieder verbrecherisch schwarz. Unter dem Rande des weißen T-Shirts lugte die Spitze eines plüschigen Schwanzes heraus.
„Du stress-shiftest schon wieder“, murmelte Yunhee, die sich das Haar über die Schulter warf und ihren Koffer durch den Flur schob. Sie war bereits darauf vorbereitet, dass aus dem Raum zu ihrer rechten jemand herauskam: sie roch nebst dem Geruch von frisch renovierter Wohnung den eines anderen Menschen und etwas anderem. Sie sollte nicht enttäuscht werden, aus der Küche stolperte ein Mädchen ebenso groß wie Eunsook mit großen Augen und wirrem Haar, sie strahlte übers ganze Gesicht doch ihren Augen lag eine gewisse Unsicherheit bei.
„H-Hallo zusammen! Die Toilette ist da drüben- OH! Bist du auch..?“, unterbrach sie sich und ihre Augen wurden wenn möglich noch größer und das Braun ihrer Iris griff noch mehr von dem weiß an und ihre Nase wurde ein wenig breiter, glänzender. Durch die wirren, honigbraunen Strähnen der kinnlangen, halb gelockten Pracht schoben sich zwei hellbraune, Löffelförmige Ohren. Innen weiß und mit leicht schwarzer Spitze starrte Yunhee sie einige Sekunden stirnrunzelnd an und versuchte sie einem Tier zuzuorden.
Eunsook lachte währenddessen verlegen (und immer noch mit leicht verzogenem Gesicht, da sie nach eigener Aussage schon seit dem letzten verfickten Jahrhundert auf Klo musste ) und fuhr sich fahrig durch ihre sich langsam wieder zurück färbenden Strähnen, auch das plüschige Weiß des Schwanzes kroch wieder zurück unter das laberige T-Shirt.
„Jaah, das sind wir und du anscheinend auch? Was bist du?“, fragte Eunsook ohne falsche Scheu und bugsierte ihren Koffer mehr hart als sanft weiter in den Flur, sah neugierig zu ihrer neuen Mitbewohnerin auf. Diese strahlte und zeigte auf ihre Ohren, die fröhlich wackelten: „Ich bin ein Albrind!“, stieß sie stolz hervor und blinzelte mit langen, dichten Wimpern bevor ihr Lächeln etwas verrutschte und ihre Wangen sich rot färbten. Rasch ging sie in eine tiefe Verbeugung und murmelte: „'tschuldigt! Park Jisuk, 20 Jahre alt! Ich studier Sprachen!“
Süß, dachte Yunhee und betrachtete die Kälbchenohren und nickte sich innerlich selbst zu. Wenn sie Zeit ihres Lebens mit einem Polarfuchs gelebt hatte konnte sie den und ein Kälbchen ertragen; das andere Mädchen schien nett zu sein.
„Süß!“, rief Eunsook aus und ihre Augen wurden im Kontrast etwas schmaler und das Schwarz ihrer Pupille weitete sich als sie die Hände ausstreckte um die Ohren zu berühren – doch das andere Mädchen machte einen heftigen Satz zurück und streckte die Hände abwehrend aus, die Augen riesig und ein dünner Schwanz zuckte auf der Höhe ihrer Kniekehlen nervös umher. „Ah, bitte nicht – die sind empfindlich! Was bist'n du, du fühlst dich nicht so aggro an, aber irgendwie..“, murmelte Jisuk mit zusammengekniffenen Augen und Eunsook schwoll stolz die Brust und ihre weißen, überaus plüschigen Ohren stoben aus dem schwarz-weiß ihrer Haare während sie beinahe ausrief: „Ich bin ein Polarfuchs! Wie meine Mama! Und Yunhee-ah hier-“
„-ist immer noch ein Jahr älter und ebenfalls Shifter. Bist du schon lange hier? Haben wir drei Schlüssel?“, wandte sie sich an Jisuk mit einem schiefen Seitenblick auf Eunsook, die wortwörtlich den Schwanz einzog und die Toilette aufsuchte.
Den Rest des Tages verbrachten die drei Mädchen damit die Stadt unsicher zu machen um den WG-Kühlschrank aufzustocken und sich ein wenig kennenzulernen. Sowohl der Fuchs als auch der Panda klickten mit dem Kälbchen sofort und am Abend saßen sie alle zu dritt auf Yunhee's Bett und checkten die neueste Folge eines Dramas, dass die drei (also Yunhee und Jisuk, Eunsook eher halbherzig) verfolgten.
Als sie im Bad standen und sich die Zähne putzten wandte Jisuk sich plötzlich an Yunhee: „Du, Unnie, wie ist das eigentlich mit der Partnerwahl für die Einweisung..Wie war das bei dir?“
Eunsook blickte mit dem Mund voller Schaum alarmiert von Jisuk zu Yunhee und wieder zurück während Yunhee träge die Schulter zuckte und sich mit dem Abschminktuch über die Augen fuhr.
„Nicht sehr spektakulär. Zwar zwingen sie uns mehr oder weniger einen Partner auf, den man auch während der Kennenlernstunde einmal sieht und mit dem man plaudert. Ob man danach noch mit ihm oder ihr zu tun haben will, das wird einem selbst überlassen. Mein Partner war ein ziemlich ruhiger, irgendwie schräger Typ? Ich hab seine Nummer bekommen, mich aber nie gemeldet. Zur Not hat man ja noch die Vertrauenslehrer“, schloss die Älteste mit einem erneuten Schulterzucken.
Als Eunsook einen Hustenkrampf der zweiten Art bekam und das Badezimmer mit weißen Zahnpastasprenkeln übersäte warf Yunhee ihr einen bösen, Jisuk ihr einen besorgten Blick zu.
„Wir kriegen Partner zugewiesen? Für was denn bitte?“, keuchte sie mit hochrotem Gesicht, ihr Schwanz zuckte nervös gegen die Beine der beiden anderen. Yunhee sah kurz auf Eunsook's Hinterkopf über dem Waschbecken, dann wieder auf ihr eigenes Spiegelbild, dass sie stirnrunzelnd musterte.
„Naja, für's shiften? Haben deine Eltern dir das nicht gesagt? Man kriegt einen älteren zugewiesen, meist aus derselben Klasse und demselben Semester, falls man Probleme hat“, half Jisuk Eunsook halb belustigt, halb verwirrt nach und Eunsook richtete sich schlagartig auf.
„Ich brauch' keine Hilfe beim Shiften!“, schnarrte sie, die Stimme bereits merkwürdig heiser und kehlig, der Mund bereits länglich, die Lippen schwarz und ledrig wie die Nase. Jisuk quiekte und ihre Ohren und Augen shifteten von null auf hundert während Yunhee die Augen verdrehte und Eunsook eine kleine Hand vor die Schnauze presste, sie förmlich wieder in Eunsook's Kopf presste. Die ihre hellen Augen weg blinzelte, die Pupille weitete sich wieder und sie nuschelte gegen Yunhee's Handfläche: „Ich hab doch dich!“
„Ja, aber nicht immer. Die Uni macht's halt so, vielleicht sind wir ja sogar Partner“, fügte Yunhee halbherzig hinzu und Eunsook warf ihr einen äußerst zweifelnden Blick zu, die Ältere verdrehte die Augen.
„Wird schon schiefgehen!“, schloss sie zwischen Amüsement und Leiden denn auf der einen Seite war der Gedanke an Eunsook, die sich mit einem anderen Shifter auseinander setzte, urkomisch. Auf der anderen Seite würde ihr vielleicht auch jemand zugewiesen werden und darauf hatte sie absolut keine Lust. Sie hatte sich zwar sehr gut unter Kontrolle aber kein Interesse dieses Wissen weiterzugeben und wusste auch nicht wirklich, wie sie etwas, das ihr so einfach wie Atmen fiel, anderen beibringen konnte.
„Wird mit Sicherheit schiefgehen!“, rief Eunsook ihr noch hinterher und Jisuk giggelte während Yunhee grinsend die Augen verdrehte und die Tür zu ihrem Zimmer schloss.
_
„Oh holy shit!“, wisperte Jisuk und krallte eine Hand in Eunsook's Oberarm, die aufkeuchte und versuchte, die dicken, schon leicht verhornten Nägel ihrer Mitbewohnerin von ihrer Haut zu entfernen.
Die beiden Mädchen saßen mit gefühlt hunderten von anderen Neulingen in einem Vorlesungssaal vor dessen Tafel sich drei ihrer Lehrer aufgestellt hatten. Einer sah aus als habe er Zeit seines Lebens täglich einen Löffel Weisheit gefuttert, die ihm nicht nur in den Kopf sondern auch durch die Kopfhaut nach außen gesickert war; sein Gesicht war von Furchen durchzogen doch die Falten um Augen und Mund erinnerten an ein lachendes Mondgesicht und hätte Eunsook raten müssen so hätte sie auf Schildkröte getippt.
Der große, drahtige Lehrer daneben hätte genauso gut Schauspieler oder Model werden können und die Dominanz, die seine ganze Erscheinung ausstrahlte, schwappte in Wellen durch den Raum und das Mädchen spürte die schwächeren shifter darauf antworten und sie bekam Kopfschmerzen. Jisuk neben ihr machte sich so klein es bei ihrer großen Statur irgendwie ging, doch ihre Augen lagen nach wie vor riesig und hell auf dem dritten Lehrer. Er tat dem zweiten nichts Gutes indem er auf andere Art und Weise ebenso gut aber weniger entspannt aussah. Während der zweite ein entspanntes Lächeln zur Schau trug, seine Augen aber wachsam durch den Saal wanderten, war der Dritte steif und lächelte nicht, sah abwesend aus dem Fenster oder auf den Boden vor sich. Trotzdem sagte die Art und Weise, wie er stand und wie die Sehnen in seinem Kiefer sprangen, als er diese zusammenbiss, dass er ebenso dominant wie der mittlere war.
„Meine lieben Frischlinge!“, begann Gandalf der Weise, der sich umdrehte und seinen Namen mit geübter aber kritzeliger Schrift auf die Tafel brachte. Er hieß nicht Gandalf sondern Sung Dong Il, Kreidestaub an der Hose abklopfend wandte er sich wieder um und schien jeden einzelnen Studenten anzulächeln:
„Die Meisten von ihnen wissen, warum Sie hier sind und wie es weitergeht. Für die, die es nicht wissen-“, fuhr er fort und Eunsook zog leicht den Kopf auf und meinte das Gewicht seines Blickes auf sich zu spüren,“-es handelt sich bei dieser Extrastunde vor dem eigentlichen Semesterbeginn um die Einweisung unserer Gestaltenwandler. Oder, wie sie im modernen Sprachgebrauch genannt werden, Shifter.“
Eine bedeutungsschwere Stille in die Luft hängend verschränkte er die Hände und ließ sie vor dem Körper sanft gegen das kleine Bäuchlein fallen. Dann fuhr er ebenso gewichtig fort: „Jedem neuen Studenten geben wir die Möglichkeit nicht nur bei den für das spezifische Semester Lehrern Hilfe zu ersuchen sondern sich auch an einen älteren Studenten zu wenden. Dafür arrangieren wir ein Treffen bei dem sie den für sie eingetragenen Älteren kennenlernen werden.“
Die Stille, die daraufhin folgte, war unterbrochen von dem Summen und Wispern vieler Stimmen, die durch die Reihen strichen bis der mittlere Lehrer an die Tafel trat und etwas langsamer und ungelenker, aber ebenso schmierig Lee Joon Gi kritzelte.
Die Hände einige Male gegeneinander schlagend ging er zurück zwischen die beiden anderen und presste die Lippen in einem verkniffenen Grinsen aufeinander, die scharfen Augen wanderten durch die Reihen und wo der Blick den der Schüler fand war es augenblicklich still.
„Diese Möglichkeit soll nicht nur ihren Alltag vereinfachen sondern auch ihr Studienverhalten. Studieren kann eine äußerst anstrengende, nervenzehrende Tätigkeit sein und Schwierigkeiten mit ihrem animalischen Part wäre nur ein Minus in ihren und unseren Büchern. Bis jetzt hatten wir fast ausnahmslos gute Erfahrungen mit dieser Methode, ich empfehle sie wärmstens!“, schloss der junge Professor und Eunsook presste eine Hand auf ihre Brust als das Lächeln des Lehrers in einem Mundwinkel hängen blieb.
Gutaussehende Lehrer sollten illegal sein, das Einzige, was Eunsook beim Lehrer stören würde, wäre dieser Mann als ihr Professor. Nun drehte sich auch der dritte, ernste gen Tafel und schrieb mit rascher, aber sauberer Schrift seinen Namen an: Park Hae Jin.
Als er sich wieder umdrehte verschränkte er die Arme vor der Brust und durchbohrte sie quasi mit ihren Blicken, Eunsook hörte Jinsuk neben sich schwer einatmen. Sie warf ihrer Freundin einen befremdlichen Blick zu, ihre Mundwinkel zuckten.
„Als Aufsichtslehrer ist es meine Aufgabe Sie daran zu erinnern, dass sie ihren Älteren etwas Respekt entgegenzubringen haben. Wenn wir also gleich gehen werden und Sie ihre Partner zugewiesen bekommen-“, begann er, wurde aber durch eine neue Flut von aufgeregtem Flüstern unterbrochen. Seine Kiefer knallten wieder aufeinander und zwischen seinen Brauen grub sich eine kleine Falte in die Haut, sofort war es im Raum so still, dass man wahrscheinlich eine Stecknadel hören könnte.
„..Sie werden gleich ihre Partner zugewiesen bekommen, die sich – wenn möglich – in ihrem Profil befinden und mit ihrer Klasse kompatibel sind. Alle Schüler, die ich nenne, können sich jederzeit bei mir melden sollte es Probleme geben.“
Und Professor Park begann Namen vorzulesen und langsam aber sicher minimierte sich die Zahl der Schüler. Eunsook kam nicht umhin zu bemerken dass die Schüler insgesamt alle ein eher selbstbewusstes Gefühl an den Tag legten. Als Professor Park die Liste an Professor Sung weitergab und unter anderem auch Jisuk die Treppe herunter stolpern musste war Eunsook sich sicher, dass sie in ihre Klassen einsortiert wurden. Erschrocken zuckte sie zusammen als Professor Lee ausrief „Und der Rest schließt sich bitte mir an!“
Mit einigen anderen zusammen schlurfte sie die Treppen herunter. Sie folgten mit zuckenden Augenbrauen und einem verbissenen, amüsiertem Grinsen dem wackelnden, dunkelbraunen Schwanz eines Labrador-Shifters (der entweder nicht bemerkte, wie präsent seine Form mit den dazugehörigen Ohren war oder es ihm schlichtweghin egal war) und wandte sich zur Seite als sie einen Jungen wispern hörte: „Taetae, komm' ma' runter!“, den Dialekt schwer auf der Zunge. Sie linste verstohlen zu ihrer Linken wo ein etwas kleinerer Junge mit schmalen Augen und einem verschmitzten Ausdruck auf dem weichen Gesicht die kleine Hand gegen den schlaksigen Arm des Labradors schlug.
Eunsook kicherte und der Kleine mit den pfirsichfarbenen Haaren warf ihr ein beschämtes Grinsen zu und als das Mädchen sich wieder umdrehte sahen zwei riesige, dunkle Augen sie neugierig an, ewig lange Wimpern warfen Schatten auf rosige Wangen und die Nase glänzte als der Labrador breit grinste und selbst wenn Eunsook die Ohren und den Schwanz noch nicht gesehen hätte so wäre sie sich spätestens jetzt zu 99.9% sicher, was dieser Junge für eine Tierform haben musste. Sie grinste ebenso breit zurück und ein tiefes, kehliges Geräusch entsprang dem Hundeshifter, was das Mädchen kichern ließ.
„Ah, erst einen Tag hier und schon lacht er sich wieder Freunde an.. Kannst du das glauben, Jeonggukie..“
Jeonggukie glaubte anscheinend an Weniges, erst Recht nicht an Gott, der Größe seiner Augen und der darin schillernden Panik zu schließen. Besorgt beugte sich Eunsook zu dem Pfirsichjungen herunter, der diese Geste mit einem verurteilendem Seitenblick ächtete, und zeigte kurz auf den schwarzhaarigen Jungen namens Jeongguk, der gerade zu Taetae, dem Labrador, aufschloss und sich einen der schlaksigen, wilden Arme auf die breite Schulter legen ließ.
„Geht's ihm gut?“, fragte sie skeptisch, Pfirsichjunge zog fragend die Brauen hoch und starrte sie einige Sekunden an, folgte dann ihrem Fingerwink und sein ganzes Gesicht verwandelte sich in die Sonne, eingetaucht in Zuckerguss, als er breit grinste und seine Augen sich in süße Halbmonde verwandelten: „Ahh, Jeonggukie? Jaja, dem geht’s immer gut – der sieht aber auch immer so geschockt aus, keine Sorge! Park Jimin!“, stellte er sich dann abrupt vor, Eunsook griff blinzelt nach der kleinen, warmen Hand und schüttelte sie.
„Oh okay. Cool. Kim Eunsook. Freut mich“, grinste sie verlegen und Jimin warf ihr finger guns zu bevor er wieder zu den beiden größeren aufschloss und seine nackten Arme um ihre Schultern schloss. „Chim chim~“, gurrte Taetae, dessen tiefe Stimme sich unschön brach sodass Eunsook grinsend den Kopf schüttelte.
Schließlich blieben die Professoren vor der Mensa stehen und die Studenten füllten langsam den Raum, in dem bereits die älteren Studenten an allen Tischen verteilt saßen und schwatzten. Es wurde augenblicklich still als Professor Park eine Hand hob, in der er seine Namensliste hielt, und die Shifter unter seinen Fittichen liefen brav hinter ihm her. „Ich werde jetzt erneut eure Namen vorlesen und den dazugehörigen Oberstufler, die sich dann bitte bei mir melden“, verkündete er.
„Das ist wie in Harry Potter“, murmelte Jisuk, die relativ weit hinten in ihrem Pulk stand, sodass Eunsook sie noch hörte. „Nicht Slytherin!“, flüsterte Eunsook übertrieben laut und gespielt verzweifelt, was das Kälbchen zum Lachen brachte. Als Professor Park sich räusperte wandte sie sich augenblicklich mit roten Wangen wieder um, die Augen unnatürlich groß und aufmerksam. Eunsook verdrehte grinsend die Augen, Jimin neben ihr schnaubte belustigt. Sie imitierte seine Geste mit den vor der Brust verschränkten Armen und sie warteten geduldig.
Schließlich waren die ersten beiden Gruppen verteilt und der allgemeine Lärmpegel stieg wieder, als die einzelnen Studenten sich kennenlernten. Dann hob Professor Lee seinen Zettel und las einen Namen nach dem anderen vor. Der Knoten in Eunsook's Bauch waberte und wurde härter, entwirrte sich wieder etwas, verkrampfte sich wieder. Sie wollte unbedingt Yunhee als Aufpasserchen haben und wenn sie dafür tauschen musste!
„Park Jimin“, rief Professor Lee über den nun schon ungemütlichen Lärmpegel und der Junge gab ein resigniertes Schnauben aus der Nase von sich, der Arm des Labradors glitt von seiner Schulter, der etwas zur Seite gegen Eunsook stolperte und sie entschuldigend angrinste. Obwohl sie nervös war und genervt hätte sein müssen, beim Anblick des zwischen die Beine geklemmten Schwanzes konnte sie das nicht wirklich und grinste nur verkniffen zurück.
„Lee Yunhee“, rief Professor Lee da und plötzlich stand Yunhee neben Jimin, ein paar knappe Zentimeter kleiner, der Pfirsichjunge grinste zu ihr herunter und deutete eine Verbeugung an und Yunhee grinste verkniffen, blinzelte zweimal und strich sich das Haar hinter das Ohr.
Und Eunsook stand die Luke offen und sie hatte die Handfläche gen Himmel ausgestreckt und konnte nicht fassen, wie das Schicksal mal wieder so ungerecht zu ihr hatte sein können!
„Kim Eunsook! Und.. mal sehen.. Ah, Kim Seokjin!“
„Ahhh, Jin!“, hörte Eunsook entfernt durch die Alarmglocken in ihrem Kopf mehrstimmig schrillen und als sie sich umwandte stand einer der größten, bestaussehenden Menschen vor ihr; die dunklen Brauen wanderten unter helles Haar, die Schultern breit und die Augen blitzen kurz golden auf als er durch die Nase schnaubte. „Ach wirklich? Ich? Mit so einer kleinen Maus?“, fragte er spitz und Eunsook blinzelte gegen die geballerte Ladung seiner Pheromone an – sie war stark. Irgendwas stimmte hier nicht. Hilfesuchend wandte sie sich an Professor Lee, einen Handrücken vor die Nase gepresst: „Professor.. I-Ich glaube, hier stimmt e-etwas nicht“, stotterte sie und biss sich automatisch auf die Zunge.
Sie stotterte normalerweise nicht. Gott, der Kerl war ganz furchtbar! Und der schwere Blick ihres Professors half da auch nicht wirklich. Für einige Sekunden schien Professor Lee sich in ihren Kopf zu wühlen und dann wurden die scharfen Augen eine Spur weicher und er sah auf seinen Zettel und schüttelte den Kopf: „Tut mir Leid, so steht es hier. Wir machen die Auslese nicht nur basierend auf Klassentyp sondern Persönlichkeit und dem Einstellungstest, der spezifisch auf Gestaltenwandler ausgerichtet ist. Viel Spaß Ihnen“, schloss er mit einem süffisanten Grinsen und Eunsook fühlte sich kurz so, als müsse sie ertrinken.
Sie sah auf Jeongguk, der ihre großen Augen mit derselben Art von Terror für den Bruchteil einer Sekunde erwiderte als Professor Lee auf ihn zukam, dann wieder auf ihren Senior. Der auf sie herab grinste, die Augen wieder ein unheimliches Gold linste er über seinen edlen Nasenrücken auf sie herunter und beugte sich dann ein wenig vor:
„Das dürfte interessant werden!“
Eunsook hoffte inständig das Gegenteil und bekreuzigte sich innerlich dreimal.
part 3
#nikooktaetab shifter#2#TEEHEE that was fun!!!! getting to knwo them is always fun funFUNFUFNFUFNFUUUUUN! KAAAAZOUUUUUU!#'wait..wHOOHOO aRRRRe yoU??'
1 note
·
View note
Text
Aladdin und die Wunderlampe
Aus den Geschichten von Tausendundeiner Nacht
In einer großen Stadt Chinas lebte ein armer Schneider namens Mustafa. - Durch sein Gewerbe verdiente er kaum so viel, dass er mit seiner Frau und seinem Sohne leben konnte. Dieser Sohn, Aladdin mit Namen, war ein Tunichtgut. Der Vater hatte nicht viel Zeit und Geld auf seine Erziehung verwenden können, und der Sohn hatte auch nichts gelernt. Er war vielmehr immer halsstarrig, boshaft und ungehorsam geblieben. Seit seiner Kindheit hatte er am liebsten mit andern Gassenjungen auf den Straßen und Plätzen der Stadt herumgetollt.
Nun wollte ihn der Vater in der eigenen Werkstatt das Schneiderhandwerk lehren. Aber der Sohn war nicht mehr zu bessern. Kaum kehrte der alte Meister seinem Sohn den Rücken, flugs war dieser aus der Stube hinaus. Und er kam den ganzen Tag nicht wieder. Scheltworte und Drohungen nützten nichts. Auch Schläge vermochten den flatterhaften Sinn des Jungen nicht zu ändern. Schließlich musste ihn der Vater zu seinem großen Bedauern dem liederlichen Leben überlassen. Da grämte sich der alte Schneider so sehr, dass er krank wurde und nach einigen Monaten starb.
Aladdins Mutter sah, dass sie von ihrem Sohn keine Hilfe zu erwarten habe. Also schloss sie den Laden und machte das wenige Handwerkszeug des Gatten zu Geld. Davon und vom Ertrag des Baumwollspinnens hoffte sie, mit dem Sohn leben zu können.
Dieser ging jetzt ungehemmt seinen Neigungen nach. Er kümmerte sich nicht im geringsten um die Ermahnungen seiner Mutter. Ja, er stieß sogar Drohungen gegen sie aus. ohne Unterlass spielte er mit Jungen seines Alters. Nach Hause ging er nur mehr zur Essenszeit. Sonst ließ er sich den lieben langen Tag nicht blicken. So trieb er es, bis er fünfzehn Jahre alt geworden war. Und er dachte keinen Augenblick daran, was aus ihm werden sollte.
Während Aladdin eines Tages wie gewohnt mit den Gassenbuben spielte, ging ein Fremder vorüber. Er blieb stehen und sah dem Spiel zu; besonders Aladdin betrachtete er aufmerksam. Der Fremde war ein afrikanischer Zauberer. Er konnte Berge aufeinandertürmen und verstand sich auch auf die Sternkunde. Erst vor zwei Tagen hatte er seine Heimat Afrika verlassen. Nun sah er Aladdin eine Weile genau zu. Dabei erkundigte er sich unauffällig bei einem andern Knaben nach dessen Namen und Familienverhältnissen.
Dann trat er auf Aladdin zu und sagte: "Mein Sohn, ist dein Vater nicht der Schneider Mustafa?" "Ja, Herr", erwiderte Aladdin, "aber er ist schon lange tot." Bei diesen Worten fiel der Fremde dem Jungen um den Hals. Er umarmte und küsste ihn wiederholt. Tränen flossen über seine Wangen. "Warum weint Ihr, Herr?" fragte Aladdin. "Und woher kennt Ihr meinen Vater?"
Traurig erwiderte der Afrikaner: "Wie sollte ich nicht weinen! Dein Vater war ja mein Bruder. Ich bin daher dein Oheim. Einige Jahre schon bin ich auf der Reise. Jetzt, da ich hoffte, ihn wiederzusehen, muss ich erfahren, dass er tot ist. Dies schmerzt mich unendlich. Der einzige Trost ist mir, in deinem Gesicht seine Züge zu erkennen." Dann fragte er Aladdin nach der Wohnung seiner Mutter und drückte dem Jungen einen Beutel voll Kleingeld in die Hand.
Dazu sagte er: "Nun geh gleich zu deiner Mutter. Grüße sie von mir. Und sag ihr, ich werde sie morgen besuchen, wenn es meine Zeit erlaubt. Ich möchte das Haus sehen, in dem mein lieber Bruder gelebt hat und wo er gestorben ist." Aladdin, den der Fremde eben zu seinem Neffen gemacht hatte, lief mit dem Geld stracks nach Hause. Er rief seiner Mutter zu: "Liebe Mutter, sag mir doch, ob ich einen Oheim habe!"
"Nein", erwiderte die Mutter, "du hast keinen Oheim, weder väterlicherseits noch von meiner Seite." "Und doch", meinte Aladdin, "hat eben jetzt ein Mann zu mir gesagt, dass er mein Oheim sei. Er weinte über den Tod meines Vaters, der sein Bruder gewesen wäre. Dabei fiel er mir um den Hals und küsste mich. Er hat mir auch dieses Geld gegeben." Nun wies Aladdin die Handvoll Geld vor. "Auch hat er versprochen, dass er morgen zu dir kommen werde. Er möchte Vaters Haus und Wohnung sehen. Inzwischen soll ich viele Grüße an dich ausrichten."
"Mein Sohn", entgegnete die Mutter, "es ist wahr, dein Vater hatte einen Bruder. Aber der ist schon lange tot. Und von einem andern Bruder habe ich nie gehört." Damit endete das Gespräch zwischen Mutter und Sohn.
Am andern Tag kam der Zauberer wieder zu den spielenden Knaben. Er trat zu Aladdin und umarmte und küsste ihn wie am Vortag. Dazu gab er ihm zwei Goldstücke mit den Worten: "Mein Sohn, bring dieses Geld deiner Mutter. Sag ihr, ich werde am Abend zu ihr kommen; sie soll um das Geld etwas für das Nachtmahl einkaufen. Denn ich möchte bei euch speisen. Zeig mir jetzt das Haus, in dem ihr wohnt. Ich will sicher sein, am Abend hinzufinden"
Der Junge zeigte ihm das Haus, und der Zauberer verließ ihn.
Aladdin lief nach Hause. Er gab seiner Mütter die zwei Goldstücke und richtete die Botschaft des Oheims aus. Die Mutter ging sofort auf den Markt und kaufte allerlei Vorräte. Da es am Nötigsten mangelte, entlieh sie von der Nachbarin das Tischgeschirr. Dann bereitete sie das Abendessen.
Am Abend, als alles fertig war, sagte sie zu dem Jungen: "Nun geh und suche den Oheim! Führ ihn her, vielleicht weiß er den Weg nicht!" Aladdin wollte soeben gehen, als es an die Tür klopfte. Er öffnete und erkannte den Fremden. Ein Diener folgte ihm mit Früchten und Weinflaschen; nachdem er diese niedergestellt hatte, entfernte er sich. Der Zauberer begrüßte Aladdins Mutter und sprach: "Nun zeig mir die Stelle, wo mein Bruder bei seiner Arbeit saß!" Sie zeigte ihm den Platz. Der Zauberer aber warf sich zu Boden. Er küsste die Steile unter Tränen und rief aus: "Mein armer Bruder, wie unglücklich bin ich, dich nicht mehr am Leben zu treffen! Wie gerne möchte ich dich umarmen und dir in die Augen blicken!"
Aladdins Mutter musste nun glauben, dass er wirklich der Bruder ihres Gatten sei. Sie lud ihn ein, sich auf ihres Mannes Platz zu setzen. Aber er lehnte es ab. Er bat, sich gegenüber setzen zu dürfen; so könne er sich wenigstens einbilden, der Bruder sitze noch dort. Da drang sie nicht weiter in ihn und ließ ihn Platz nehmen, wo er wollte.
Nun begann er zu plaudern und sagte: "Liebe Schwägerin, wundere dich nicht, dass du mich nie gesehen und nie von mir gehört hast. Es sind jetzt genau vierzig Jahre, seit ich das Land verließ. Ich bin weit in der Welt herumgekommen. Ich habe Indien, Persien und Afrika gesehen. Ich bin in den schönsten Städten dieser Länder gewesen. Lange Jahre habe ich mich auch im Westen aufgehalten. Dann aber erwachte die Sehnsucht nach der Heimat in mir, und sie hat mich nie mehr verlassen. Wo der Mensch geboren ist, dorthin zieht es ihn immer wieder. Ich dachte an meinen Bruder. Da ergriff mich heißes Verlangen, ihn wiederzusehen. Ich sagte mir auch, dass ich reich sei; aber mein Bruder müsse vielleicht in Armut sein Leben fristen, und ich könnte ihm helfen!
Daher machte ich mich auf die weite Reise. Frage nicht, was für Mühen und Beschwerden ich unterwegs ertrug! Nur die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem Bruder hielt mich aufrecht. Darum war mein Schmerz unsäglich, als ich von seinem Tod erfuhr. Als ich nun auf der Straße deinen Sohn sah, fiel mir sofort die Ähnlichkeit mit meinem Bruder auf. Mein Herz zog mich zu ihm. Darum sprach ich ihn an. Und ich freute mich, doch wenigstens einen Sohn meines Bruders gefunden zu haben."
Als der Zauberer sah, wie sehr seine Worte Aladdins Mutter ergriffen, lenkte er ab.
Er wandte sich schnell an Aladdin: "Mein Sohn, wie heißt du?"
"Aladdin", sagte dieser.
"Nun, Aladdin", fuhr der Zauberer fort, "hast du ein Handwerk oder eine andere Fertigkeit gelernt?"
Bei dieser Frage wurde Aladdin verlegen. Beschämt senkte er den Kopf.
Seine Mutter aber rief: "Nichts hat er gelernt. Er ist ein Taugenichts. Den ganzen Tag strolcht er auf den Gassen herum und verbringt mit seinesgleichen unnütz die Zeit. Sein Vater hat sich alle Mühe gegeben, ihn ein Handwerk lernen zu lassen. Er wollte einen anständigen Menschen aus ihm machen. Aber alle Mühe war vergebens. Er folgte ihm nicht, war eigensinnig und boshaft. Der Kummer um ihn hat meinen Mann unter die Erde gebracht. Ich bringe mich mit Baumwollspinnen mühselig durchs Leben. Er aber streicht trotz meiner Reden und Mahnungen auf den Straßen herum. Er schämt sich nicht, mit fünfzehn Jahren noch mit den Kindern zu spielen. Und was aus ihm werden soll, ist ihm gleichgültig. Ich kann ihn nicht mehr erhalten. Ich bin eine alte Frau, die selbst mit ihrem knappen Verdienst nicht auskommt. Demnächst werde ich ihm die Tür verschließen und ihn nicht mehr hereinlassen. Er soll sehen, wo er unterkommt und wie er sich fortbringt."
Der Zauberer hatte den Jungen während dieser Klagen seiner Mutter unverwandt angeblickt. Als sie geendet hatte, sagte er zu ihm: "Was
du treibst, ist nicht gut, mein lieber Neffe. Du solltest schon verständig genug sein, an einen Erwerb zu denken. Deine Mutter kann dich nicht ewig erhalten. Denk nach, ob dir nicht doch ein Gewerbe zusagt. Wenn dir das Handwerk deines Vaters nicht gefällt, dann such dir ein anderes! In dieser Stadt sind sicher viele Handwerker, die dich gerne in die Lehre nähmen. Aber wenn du gar keine Lust zum Handwerk hast, dann will ich dir einen Kaufladen einrichten. Ich will ihn mit den feinsten Stoffen ausstatten, damit du Handel treiben kannst. Auf diese Art wirst du ein genügendes Einkommen finden und ein geachteter Mann werden.
Dieses Anerbieten lockte Aladdin sehr. Er wusste, dass die Kaufläden immer stark besucht waren. Die Aussicht, ein reicher Handelsherr zu werden, schmeichelte seinem Stolz. Daher erklärte er seinem Oheim, dass ihn dieser Beruf freuen würde. Und er dankte ihm für die Wohltat, die er ihm erweisen wolle.
"Da dir dieses Gewerbe gefällt", sagte der Zauberer, "werde ich dich morgen in die Stadt mitnehmen. Ich werde dir feine Kleider kaufen, wie es sich für einen Kaufmann schickt. Und übermorgen wollen wir einen Laden suchen, wie ich dir versprochen habe."
Bisher hatte Aladdins Mutter nicht recht geglaubt, dass der Mann ihr Schwager sei. Nun zweifelte sie nicht mehr daran. Ein fremder Mann würde ihrem Sohn nicht so glänzende Versprechungen machen. Sie ermahnte ihn daher, sich nun alle Torheiten aus dem Kopfe zu schlagen. Er solle sich der Güte des Oheims würdig erweisen. Dann trug sie das Abendessen auf. während des Mahles unterhielten sie sich weiter über den Kaufmannsberuf. Schließlich bemerkte der Zauberer, dass die Nacht schon weit fortgeschritten sei. Er verabschiedete sich von Mutter und Sohn und suchte seine Herberge auf.
Am nächsten Morgen holte der Zauberer den Jungen zum verabredeten Gang in die Stadt ab. Er führte ihn zu einem großen Handelshaus. Dort gab es Kleider aus den besten Stoffen für Personen jeden Alters und Standes.
Der Zauberer verlangte mehrere der schönsten Gewänder zur Auswahl. Dann sagte er zu Aladdin: "Lieber Neffe, wähl dir aus, was dir am besten gefällt!"
Aladdin war über die Freigebigkeit des Oheims hocherfreut. Er suchte sich das schönste Gewand aus. Und der Oheim bezahlte den Kaufmann bar, ohne zu handeln.
Nachdem Aladdin von Kopf bis Fuß prächtig gekleidet war, dankte er seinem Oheim, küsste ihm die Hand und bat ihn, sich auch ferner seiner anzunehmen. Der Zauberer versprach, ihm bei seinem Erwerb behilflich zu sein. Er führte ihn zunächst in die Straße, wo sich die reichsten Kaufläden mit den feinsten Stoffen befanden.
Hier sagte er: "Auch du wirst bald ein Kaufmann sein. Darum ist es vorteilhaft, dass du diese Kaufleute besuchst. Sie sollen dich kennenlernen."
Der Zauberer zeigte Aladdin auch die schönsten und prächtigsten Moscheen. Schließlich geleitete er ihn durch den Palast des Sultans, soweit man dort freien Zutritt hatte. Nach diesem langen Spaziergang nahm er ihn mit in sein Absteigquartier. Dort machte er ihn mit einigen Kaufleuten bekannt und stellte ihn als seinen Neffen vor. Sie nahmen ein reichliches Mahl ein, und Aladdin sprach den guten Gerichten ausgiebig zu.
Gegen Abend geleitete der Zauberer seinen Neffen zum Hause seiner Mutter zurück. Diese war außer sich vor Staunen, als sie den Sohn so fein gekleidet sah. Sie wünschte den Segen des Himmels über den großzügigen Schwager herab.
"Lieber Schwager", sagte sie, "ich weiß nicht, wie ich dir für deine Großmut danken soll. Mein Sohn wäre ganz nichtswürdig, wenn er sich jetzt nicht deiner Fürsorge würdig erweisen wollte. Ich danke dir von ganzem Herzen. Der Herr möge dich durch ein langes und glückliches Leben belohnen. Ich hoffe, dass auch mein Sohn dankbar deinen Rat und deine Wohltaten anerkennen wird."
Hierauf erwiderte der Zauberer: "Aladdin ist ein guter Junge. Er stammt von trefflichen Eltern. Wir werden schon einen tüchtigen Menschen aus ihm machen. Übrigens tut es mir leid, dass ich ihm nicht schon morgen einen Laden kaufen kann. Aber morgen ist Freitag, da werden die Läden geschlossen sein. Die Kaufleute werden die Stadt verlassen und sich in den Gärten aufhalten. Wir müssen daher bis Samstag warten. Doch komme ich morgen trotzdem zu euch. Ich will Aladdin mit mir nehmen und ihm die Gärten und Plätze vor der Stadt zeigen. Dort werden wir auch viele Kaufleute mit ihren Familien antreffen; so kann ich ihn gleich bekannt machen. Er muss ja jetzt auch den Verkehr mit Erwachsenen lernen."
Nach diesen Worten entfernte sich der Zauberer.
Am folgenden Tag stand Aladdin sehr zeitig auf. Vor Freude hatte er nicht mehr schlafen können und sich den Morgen herbeigewünscht. Er zog nun seinen neuen Anzug an. Dann erwartete er ungeduldig den Oheim. Wiederholt öffnete er die Tür und blickte nach ihm aus. Als er ihn von ferne kommen sah, verabschiedete sich Aladdin von seiner Mutter und eilte ihm freudestrahlend entgegen.
Der Zauberer begrüßte ihn freundlich. "Da bist du ja, Junge", sagte er. "Heute will ich dir Dinge zeigen, die du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen hast."
Sie gingen zusammen vor die Stadt und besahen die prunkvollen Häuser und Gärten. Bei jedem besonders schönen Schloss oder Garten blieb der Zauberer stehen. Und jedes Mal fragte er den Jungen, ob sie ihm gefielen.
Aladdin hatte noch nie so schöne Bauten und Plätze gesehen. Vergnügt gab er zur Antwort: "Oheim, alles ist wunderbar. Ich kann mich gar nicht Sattsehen."
So schritten sie immer weiter, bis sie müde wurden. Um ein wenig auszuruhen, betraten sie einen großen, herrlichen Garten und setzten sich nieder. Der Zauberer zog einen Beutel aus der Tasche. Diesem entnahm er Früchte und Esswaren. Sie aßen und plauderten und waren lustig und guter Dinge. Dann setzten sie ihren Weg fort und gingen weiter an den Gärten vorbei ins Freie.
Aladdin hatte noch nie einen so langen Marsch gemacht. Als er sich allmählich müde fühlte, fragte er: "Lieber Oheim, wohin gehen wir denn? Wir haben die Gärten schon weit hinter uns. Wenn wir noch länger so fortgehen, weiß ich nicht, ob ich für den Rückweg stark genug sein werde. Ich bin nämlich schon sehr müde."
"Nur Mut", entgegnete der Oheim. "Wir haben nicht mehr weit, mein Junge. Ich will dir nur noch einen Garten zeigen, der alle bisherigen an Pracht übertrifft." So sprach er freundlich auf Aladdin ein. Auch erzählte er ihm Geschichten, um den Weg zu verkürzen.
Endlich kamen sie in ein schmales Tal zwischen zwei nicht allzuhohen Bergen. Das war die Stätte, deretwegen der Zauberer aus Afrika bis hierher gereist war.
"Nun sind wir an Ort und Stelle", sagte er zu Aladdin. "Ich werde dir hier wunderbare Dinge zeigen, die noch kein Mensch gesehen hat. Du wirst mir zu höchstem Dank verpflichtet sein. Nun wirst du etwas erblicken, was allen Menschen unbekannt ist. Wenn du dich ausgeruht hast, sammle dürres Holz Wir brauchen auch Reisig, damit wir Feuer machen können."
Als Aladdin das hörte, konnte er seine Neugierde kaum mehr bezähmen. Er sprang im Walde hin und her und sammelte einen großen Haufen von Holz und trockenen Reisern.
Schließlich sagte der Oheim: "Nun ist es genug, mein Sohn." Er entzündete den Haufen, und dieser brannte hellauf. Dann warfen Räucherwerk hinein. Dicker Rauch stieg empor. Durch Zauberworte zog der Zauberer den Rauch bald auf diese, bald auf jene Seite.
Plötzlich wurde es finster. Es donnerte und blitzte, und die Erde bebte. Vor Aladdin und dem Zauberer tat sich ein Spalt in der Erde auf, und eine Steinplatte kam zum Vorschein. Diese maß viermal einen Fuß und war etwa halb so dick; daran war ein Messingring befestigt. Aladdin erschrak und machte Miene davonzulaufen. Da wurde der Zauberer zornig. Er packte ihn heftig beim Arm und gab ihm eine Ohrfeige. Der Junge fiel der Länge nach hin und begann heftig zu weinen.
"Oheim", schluchzte er, "was habe ich getan, dass du mich schlägst?"
Da suchte ihn der Zauberer zu beruhigen. Er sagte: "Ich vertrete jetzt Vaterstelle an dir und meine es nur gut. Du brauchst dich auch nicht zu fürchten. Aber du musst mir in allem gehorchen, wenn du Nutzen von meinem Tun haben willst."
Aladdin fasste sich und hörte zu weinen auf.
Der Zauberer aber fuhr fort: "Du hast gesehen, was ich durch das Räucherwerk und meine Zauberworte bewirkte. Unter dem Stein, den du vor dir siehst, liegt ein verborgener Schatz. Er ist für dich bestimmt und wird dich reicher als den mächtigsten König machen. Aber nur du darfst den Ring an der Platte berühren. Nur du darfst den Stein auf heben. Selbst mir ist es verboten, an den Stein zu rühren. Auch darf ich keinen Fuß in das Schatzgewölbe setzen, wenn es geöffnet ist. Deshalb musst du ausführen, was ich dir sagen werde, du darfst nicht das Geringste versäumen. Achte genau auf meine Weisungen! Es ist für dich und für mich von größter Wichtigkeit!"
Mit Staunen lauschte Aladdin den Worten seines Oheims. Er freute sich nun unbändig, dass er reicher werden sollte als ein König. Schrecken und Schmerz waren vergessen. Und er sagte zum Zauberer: "Lieber Oheim, sag mir, was ich tun soll. Ich will alles genau ausführen."
"Gut, mein Sohn", erwiderte der Zauberer und umarmte ihn. "Ich freue mich, dass du vernünftig bist. Jetzt fass diesen Ring und hebe den Stein in die Höhe!"
"Aber Oheim", entgegnete Aladdin, "dieser Stein wird mir zu schwer sein. Ich kann ihn nicht heben. Hilf mir dabei!"
"Nein", versetzte der Zauberer, "das darf ich nicht. Wollte ich dir dabei helfen, wäre alle unsere Mühe vergebens; wir brächten den Stein nicht empor. Fass den Ring nur an! Sprich dazu den Namen deines Vaters und Großvaters und zieh daran! Der Stein wird sich heben, ohne dass du sein Gewicht spürst."
Da tat Aladdin, wie ihn der Zauberer geheißen. Er hob den Stein mühelos in die Höhe und legte ihn beiseite.
Kaum war die Platte gehoben, sah Aladdin Stufen vor sich, die in die Tiefe führten.
"Lieber Neffe", sagte der Zauberer, "nun höre, was ich dir sagen werde! Steig diese Stufen hinunter, bis du auf dem Grunde der Höhle bist! Dort wirst du eine offene Tür finden; sie führt in eine gewölbte Halle. Diese ist in drei aneinanderstoßende Säle geteilt. In jedem Saal wirst du links und rechts vier große, bronzene Vasen finden, die mit Gold und Silber angefüllt sind. Hüte dich, etwas davon zu berühren oder an dich zu nehmen! Hebe dein Kleid in die Höhe und schließ es eng um den Leib, damit du nirgends anstreifst; du müsstest sonst auf der Stelle sterben. Geh ohne stehenzubleiben durch alle drei Räume! Im letzten Saal wirst du eine Tür finden; sie führt in einen schönen, großen Garten mit vielen fruchtbeladenen Bäumen. Wenn du in diesem Garten geradeaus gehst, wirst du auf eine Treppe von fünfzig Stufen stoßen. Auf dieser steig zu einer Terrasse empor, und dort sieh dich um! Du wirst eine Nische finden, in der eine brennende Lampe steht. Diese Lampe nimm, lösch sie aus und schütte das Öl weg! Dann stecke sie in dein Gewand und bring sie zu mir. Das Öl wird auf deinem Kleid keine Flecken hinterlassen. Wenn es dich verlangt, von den Früchten im Garten zu kosten, so iss, soviel dein Herz begehrt. Solange du die Lampe bei dir hast, gehört dies alles dir." Nach diesen Worten steckte der Zauberer seinen Sigelring an Aladdins Finger. Dabei sagte er: "Mein Sohn, dieser Ring wird dich vor jeder Not und Gefahr schützen. Steig nun hinab! Aber befolge alles genau, was ich dir gesagt habe! Wenn du zurückkommst, werden wir unser Leben lang reiche Leute sein."
Aladdin sprang leichtfüßig die Stufen hinunter. Vorsichtig durchschritt er die drei Säle. Er schürzte sein Gewand und presste es eng an den Körper; er wollte ja nirgends anstreifen und so in Lebensgefahr kommen. Er fand den Ausgang in den Garten und eilte schließlich die Treppe hinauf auf die Terrasse. Dort sah er die Lampe stehen. Er löschte sie aus und schüttete das Öl weg. Sodann steckte er sie zu sich und machte sich auf den Rückweg. Im Garten bewunderte er die Früchte an den Bäumen; sie leuchteten in den verschiedensten Farben.
Aber alle Früchte waren kostbare Edelsteine. Die weißen waren Perlen. Andere leuchteten hell und durchsichtig wie Kristall; das waren Diamanten. Die dunkelroten Früchte waren Rubine, die grünen Smaragde, die blauen Türkise ; und so ging es fort. Alle waren rein und vollkommen. Kein König konnte solche Kostbarkeiten sein eigen nennen. Aber Aladdin kannte den Wert der Steine nicht; er hielt sie für buntes Glas. Ihm wären wirkliche Trauben und Äpfel lieber gewesen. Doch gefielen ihm die Buntheit und der Glanz der Steine. So pflückte er einige ab und steckte sie in die Taschen seines Gewandes. Auch füllte er zwei Beutel, die er bei sich trug, und legte einige Steine in die Falten seines dicken Seidengürtels. Schließlich steckte er noch mehrere zwischen Kleid und Hemd.
Ohne es zu wissen, hatte sich Aladdin mit Reichtümern beladen. Rasch eilte er nun durch die drei Säle zurück; er wollte den Oheim nicht zu lange warten lassen. Eilig stieg er die Stufen zum Ausgang empor.
Dort erwartete ihn der Zauberer schon mit Ungeduld.
Die letzte Stufe war etwas höher als die übrigen. Darum rief ihm Aladdin zu: "Oheim, da bin ich! Hilf mir die letzte Stufe hinauf!"
"Mein Sohn", sagte der Zauberer, "gib mir die Lampe! Sie könnte dir hinderlich sein."
"Nein", rief der Junge, "sie hindert mich nicht! Hilf mir zuerst heraus, dann geb' ich dir die Lampe."
So stritten sie hin und her. Der Zauberer wurde immer ungeduldiger. Aber Aladdin konnte die Lampe nicht erreichen. Sie steckte ja unter den Edelsteinen, die er zwischen Kleid und Hemd verborgen hatte. Nun geriet der Zauberer in fürchterliche Wut. Er meinte nämlich, der Junge wolle die Lampe für sich allein behalten. Murmelnd warf er etwas von dem Räucherwerk ins Feuer. Kaum hatte er zwei Zauberworte gesprochen, schloss sich die Platte über dem Eingang, Erde häufte sich darüber, und alles sah aus wie zuvor.
Der afrikanische Zauberer stammte tatsächlich aus dem feinsten Afrika. Vierzig Jahre lang hatte er alle Geheimwissenschaften studiert und sich dabei alle Arten von Zauberei und Beschwörungsformeln an geeignet. Dabei hatte er entdeckt, dass es irgendwo in der Welt eine Wunderlampe gab, die ihren Besitzer zum reichsten und mächtigsten Mann der Erde machen konnte. Er hatte auch herausgebracht, wo sich diese Lampe befand, nämlich an einem unterirdischen Ort in der Nähe von Aladdins Heimatstadt. Darum also war der Zauberer vom äußersten Ende Afrikas bis in diese Stadt gekommen. Aber nicht er selbst durfte diese Lampe holen. Ein anderer musste in das Gewölbe hinabsteigen und ihm die Lampe bringen. Deshalb hatte er sich an Aladdin gewandt. Sobald die Lampe in seinem Besitz war, wollte er den armen Jungen in die unterirdische Höhle einschließen. Die Lampe sollte ihm ganz allein gehören.
Aber nun war sein schlauer Plan vereitelt. Aladdin hatte ihm die Lampe nicht ausgefolgt. So fürchtete der Zauberer, ein Fremder könne hinter das Geheimnis kommen. Daher hatte er den Jungen mit der Lampe unter der Erde eingeschlossen.
Er selbst aber kehrte sogleich nach Afrika zurück. Er machte einen Umweg um die Stadt, damit es den Leuten nicht auffalle, dass er ohne Aladdin von seinem Ausflug zurückkam.
Der Zauberer war also fort. Wie erging es nun unserem Aladdin? Zu Tode erschrocken stand er in der Finsternis. Er rief laut nach seinem Oheim und versicherte immer wieder, dass er die Lampe sogleich hergeben wolle. Tränen liefen über seine Wangen. Aber all sein Rufen und Klagen war vergeblich. Nichts rührte sich. Kein Laut drang an sein Ohr. Er tappte umher, ohne eine Tür zu finden. Der Zauberer hatte nämlich durch sein Machtwort auch alle Türen ins Innere der Halle verschlossen. Verzweifelt setzte sich der Junge auf die kalten Stufen nieder. Er hatte keine Hoffnung, je wieder das Tageslicht zu sehen.
Gewiss würde er hier umkommen. Zwei Tage und zwei Nächte saß Aladdin in dieser unheimlichen Finsternis. Er hatte weder Speise noch Trank. Am dritten Tag ergab er sich in den Willen Gottes.
Mit gefalteten Händen betete er zu Allah: "Es gibt keine Macht und Kraft als in Dir allein, all mächtiger Gott." So flehte er in seiner Not. Ohne zu denken, rieb er dabei an dem Ring des
Zauberers, der noch immer an seinem Finger steckte. Da stand auf einmal ein Geist von gewaltiger Größe vor ihm. Er ragte mit dem Kopf bis zur Decke des Gewölbes und war furchtbar anzusehen.
Dieser Geist sprach: "Ich bin dein Diener. Was verlangst du von mir? Ich bin bereit zu gehorchen. Ich bin der Diener aller, die diesen Ring meines Herrn am Finger tragen. Ich und alle übrigen Diener des Ringes werden dir gehorchen."
Aladdin war sehr erschrocken, aber er fasste sich schnell. Mutig und ohne zu stocken antwortete er: "Wer du auch sein magst, bring mich sofort an die Oberfläche der Erde!"
Kaum hatte er den Wunsch aus gesprochen, stand er schon draußen im Freien. Er befand sich gerade dort, wohin ihn der Zauberer geführt hatte. Das helle Tageslicht schien ihm ins Gesicht; er war wie geblendet. Verwundert betrachtete er die Erde. Er konnte sich nicht erklären, wie er herausgekommen war. Schon glaubte er, an einer andern Stelle im Wald zu sein. Aber ganz in der Nähe entdeckte er die Spuren des verbrannten Reisighaufens ; und hinter den Gärten, durch die sie gekommen waren, lag die Stadt. Er erkannte auch den Weg, auf dem er mit dem falschen Oheim hierher gegangen war. Nun dankte er Gott für seine wunderbare Rettung. Dann wanderte er in die Stadt zurück. Am Abend langte er todmüde im Hause seiner Mutter an. Schwäche überfiel ihn, und er sank ohnmächtig zu Boden; er hatte ja drei Tage nichts zu sich genommen. Seine Mutter hatte schon die Hoffnung aufgegeben, ihn wiederzusehen. Nun war sie glücklich, dass er am Leben war. Zwar er schrak sie sehr, als er ohnmächtig wurde, aber scharfe Essenzen brachten ihn bald wieder zu sich und belebten ihn.
Seine ersten Worte waren: "Liebe Mutter, gib mir zu essen! Ich habe drei Tage keinen einzigen Bissen genossen.
Rasch brachte die Mutter herbei, was sie vorrätig hatte. Sie sagte:
"Da, mein lieber Sohn, iss und trink. Aber sei nicht zu hastig und heiß hungrig und sprich jetzt nicht. Später wirst du Zeit genug haben, mir deine Erlebnisse zu schildern."
Aladdin folgte dem Rat der Mutter. Er aß langsam und trank nur in kleinen Schlucken. Als er satt war, lehnte er sich im Diwan zurück. Stockend begann er zu erzählen.
"Weißt du, liebe Mutter", sagte er, "dieser fremde Mann war gar nicht mein Oheim. Er machte uns zwar große Versprechungen und beschenkte mich reich. Aber er war ein Zauberer, ein Bösewicht und Betrüger. Schließlich wollte er mich sogar ums Leben bringen. Ich wäre jetzt tot, einsam im Finstern verhungert, wenn nicht Allah mich durch ein Wunder gerettet hätte. Höre nur, Mutter, wie er es angefangen hat!"
Und nun erzählte Aladdin alles, was er erlebt hatte. Er sprach von dem einsamen Tal und den Zauberworten über dem Feuer. Er schilderte, wie sich die Erde geöffnet hatte. Und er vergaß auch die Ohrfeige und den Zauberring nicht. Er beschrieb die unterirdischen Säle und die herrlichen Gärten, und wie er die Lampe gefunden und zu sich gesteckt hatte. Dabei holte er die Lampe aus seinem Gewand und zeigte sie der Mutter. Auch die glitzernden Steine zog er hervor. Die Mutter ahnte so wie ihr Sohn nichts von ihrem Wert. Sie legte die Edelsteine beiseite, und Aladdin steckte die zwei vollen Beutel hinter den Polster des Diwans. Dann setzte er die Erzählung fort. Er berichtete, wie er in der Höhle begraben gewesen sei. Die Tränen kamen ihm in die Augen, als er von seiner Verzweiflung sprach. Aber die Güte des Allmächtigen hatte ihn nach dem Drehen des Ringes wieder ans Tageslicht gebracht.
Aladdin schlief bis weit in den nächsten Tag hinein. Schließlich hatte er die ganze Zeit in der Höhle ja kein Auge zugemacht.
Als er erwachte, waren seine ersten Worte: "Mutter, ich habe Hunger. Bring mir zu essen!" "Mein lieber Sohn", sagte die Mutter, "ich habe nicht einmal ein Stückchen Brot im Haus. Was ich hatte, hast du gestern gegessen. Du musst dich gedulden. Ich habe noch Baumwollgarn; das werde ich in der Stadt verkaufen. Dafür kann ich dann Brot und etwas zum Mittagessen besorgen.
"Liebe Mutter", entgegnete der Sohn, "behalte die Baumwolle. Gib mir lieber die Lampe, die ich aus der Höhle mitgebracht habe. Ich werde in die Stadt gehen und sie verkaufen. Ich glaube, wir werden für die Lampe mehr bekommen als für das Garn. Vielleicht können wir dafür außer Frühstück und Mittagmahl auch noch das Abendessen kaufen."
Aladdins Mutter brachte die Lampe herbei und sagte: "Da hast du sie! Aber sie ist sehr schmutzig. Ich werde sie vorher blank putzen, damit sie wie neu aussieht."
Sie nahm Wasser und Sand und begann die Lampe zu reiben. Kaum hatte sie begonnen, erschien ein riesiger Geist vor ihr.
Er sprach mit Donnerstimme: "Was willst du von mir? Ich bin dein Diener und der Diener aller, die diese Lampe in der Hand haben. Ich und alle übrigen Diener der Lampe werden dir gehorchen."
Darüber erschrak Aladdins Mutter sehr. Sie war nicht imstande, zu reden, so furchtbar war der Geist anzusehen; eine Ohnmacht umfing ihre Sinne. Aladdin aber hatte schon in der Höhle eine ähnliche Erscheinung gehabt. Ohne sich lang zu besinnen, griff er nach der Lampe.
Er rief laut: "Diener der Lampe, ich habe Hunger. Bring mir etwas zu essen!"
Der Geist verschwand, erschien aber sofort wieder. Auf einer großen silbernen Tasse brachte er zwölf verdeckte Schüsseln aus Silber; sie waren mit den köstlichsten Speisen gefüllt. Ferner stellte er zwei Flaschen Wein und zwei silberne Becher auf den Tisch. Das Brot war weiß wie Schnee. Nachdem er alles vor Aladdin hingelegt hatte, verschwand er wieder.
Noch immer lag Aladdins Mutter in Ohnmacht. Eben wollte sich der Sohn um die Mutter bemühen, da erwachte sie von selbst durch den Duft der Speisen.
"Mutter", rief Aladdin, "steh auf!. Schau diese köstlichen Speisen an. Wir wollen sie sogleich essen, damit sie nicht kalt werden. Das wird dir wieder Kraft geben und meinen Hunger stillen."
Als die Mutter die gedeckte Tafel sah, rief sie erstaunt: "Welcher Wohltäter hat uns denn das gebracht? Sollte vielleicht gar der Sultan von unserer Armut gehört haben?"
"Liebe Mutter", erwiderte der Sohn, "frag nicht lange, sondern iss und stärke dich. Du hast es nötig. Zum Reden haben wir später noch Zeit."
Sie setzten sich an den Tisch und speisten mit bestem Appetit. Beide waren noch nie an einer so wohlgedeckten Tafel gesessen.
Während des ganzen Mahles hörte Aladdins Mutter nicht auf, das prunkvolle Tafelzeug zu bewundern. Sie hatte ebenso wenig eine Ahnung von dem wahren Wert dieser Dinge wie ihr Sohn. Ob sie aus Silber oder aus einem andern Metall seien, wusste sie nicht. So kostbare Sachen hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Zur Mittagszeit saßen sie noch immer beim Essen. So groß war ihr Appetit und so vorzüglich schmeckten die Speisen, dass sie gleich Frühstück und Mittagessen in einem nahmen. Es blieb noch so viel, dass es für ein Abendessen und für den nächsten Tag ausreichte.
Als sie satt waren, hob die Mutter die übriggebliebenen Speisen auf. Dann setzte sie sich zu ihrem Sohn auf den Diwan. Aladdin erzählte ihr, was sich während ihrer Ohnmacht zugetragen hatte.
Die Mutter wunderte sich sehr über die Erscheinung und sagte:
"Du sprichst von Geistern. Aber keiner meiner Bekannten hat jemals einen Geist gesehen. Auch mir ist bisher keiner erschienen. Warum hat sich dieser furchtbare Geist gerade an mich gewendet? Warum fragte er nicht dich? Dir ist er doch in der Schatzhöhle schon einmal erschienen."'
"Liebe Mutter"' erwiderte der Sohn, "dieser Geist ist ein anderer als jener, der mir in der Höhle erschienen ist. Sie haben zwar einige Ähnlichkeit miteinander; aber der eine sagte, er sei ein Sklave des Ringes, und der andere nannte sich einen Sklaven der Lampe, die du in der Hand hieltest."
"Wie", rief die Mutter, "diese Lampe ist die Ursache, dass der hässliche Geist sich an mich wandte? Dann nimm sie und schaffe sie mir aus den Augen! Versteck oder verkauf sie oder wirf sie weg! Ich mag sie nicht mehr anrühren. Wenn mir dieser Geist nochmals erschiene, stürbe ich vor Schrecken. Ich bitte dich, gib auch den Zauberring weg! Unterlass überhaupt jeden Verkehr mit den Geistern. Sie sind der Teufel aus der Hölle, wie der Prophet uns gelehrt hat."
"Nein, Mutter", erwiderte Aladdin, "jetzt werde ich die Lampe nicht mehr verkaufen. Siehst du denn nicht, welche Wohltat sie uns erwiesen hat? Sie hat uns zu essen gegeben, als wir hungrig waren. Und sie wird uns in Zukunft immer den Lebensunterhalt verschaffen. Denk nur an den afrikanischen Zauberer! Er hat die weite, beschwerliche Reise hierher unternommen, nur um die Wunderlampe zu gewinnen. Er wollte nichts von dem Gold in den unterirdischen Sälen. Er wusste, dass diese Lampe mehr wert ist als alles Gold und Silber der Welt. Wir kennen nun die geheime Kraft der Wunderlampe. Wir wollen sie sorgsam hüten und aufbewahren. Vor allem werden wir sie so benützen, dass die Nachbarn nichts merken. Sie sollen nicht neidisch und eifersüchtig werden. Ich will dir die Lampe gerne aus den Augen schaffen; du sollst keine Angst vor dem Geist haben. Ich bewahre sie dort auf, wo ich sie gleich zur Hand habe, wenn ich sie brauche. Den Ring aber, Mutter, kann ich auch nicht wegwerfen oder verkaufen. Bedenke, dass er mir in der Schatzhöhle das Leben gerettet hat! Wer weiß, wie oft ich noch in Gefahren kommen werde! Dann kann mich immer dieser Ring befreien."
Das musste auch Aladdins Mutter zugeben. Sie sagte: "Mein Sohn, tu was du willst. Ich aber möchte die Lampe nicht mehr sehen und mit Geistern nie mehr zu tun haben."
Am folgenden Tag verzehrten sie die restlichen Speisen. Aladdin aber wollte nicht warten, bis ihn wieder der Hunger bedrängte. Darum nahm er eine silberne Schüssel, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Unterwegs begegnete ihm ein Händler. Dem zeigte er die Schüssel. Er fragte ihn, ob er sie kaufen wolle.
Der Händler nahm die Schüssel und untersuchte sie von allen Seiten. Er überzeugte sich davon, dass sie aus reinem Silber war. Nun fragte er den Jungen, was sie kosten solle. Aladdin aber kannte den wahren Wert der Schüssel nicht. Er hatte noch nie mit derlei Waren gehandelt. Darum sagte er, dass er sich ganz auf die Ehrlichkeit verlasse. Dadurch geriet der schlaue Händler einigermaßen in Verlegenheit. Er zögerte mit seinem Angebot; schließlich wusste er ja nicht, ob Aladdin den wirklichen Wert kenne. Endlich holte er aus seiner Tasche ein Goldstück hervor. Das war nicht viel mehr als der fünfzigste Teil des Wertes der Schüssel. Aladdin nahm das Goldstück und ging eilig weg. Verblüfft sah ihm der Händler nach. Nun ärgerte er sich, dass er nicht noch weniger geboten hatte. Der Junge hatte offensichtlich keine Ahnung vom Wert der Schüssel gehabt. Schon wollte er ihm nacheilen und einen Teil des Geldes zurückverlangen. Aber Aladdin lief so schnell, dass er ihn kaum eingeholt hätte.
Aladdin ging geradewegs in einen Bäckerladen. Dort ließ er das Goldstück wechseln und kaufte einen Vorrat an Brot. Brot und Wechselgeld gab er seiner Mutter. Und sie ging auf den Markt und kaufte Lebensmittel für einige Tage.
So lebten sie eine Zeitlang. Sooft der Erlös für eine Schüssel aufgebraucht war, trug Aladdin eine andere zum Händler. Dieser kaufte alle zwölf Schüsseln. Für die erste Schüssel hatte er ein Goldstück gegeben. Nun wagte er nicht, für die folgenden weniger zu bieten. Der Handel war zu vorteilhaft für ihn.
Als das letzte Geld ausgegeben war, griff Aladdin zu der Tasse. Diese war zehnmal so schwer als eine Schüssel. Er wollte sie einem Kaufmann anbieten, aber das Stück war zu schwer; er konnte es nicht wegtragen. Darum holte er den Händler in das Haus seiner Mutter. Dieser prüfte das Gewicht der Tasse und zahlte ihm auf der Stelle zehn Goldstücke. Damit war Aladdin zufrieden.
Solange diese zehn Goldstücke ausreichten, bestritten sie davon die täglichen Ausgaben. Aladdin war den Müßiggang gewohnt. Aber seit dem Abenteuer mit dem Zauberer spielte er nicht mehr mit den Jungen in den Straßen. Er vertrieb sich die Zeit mit Spaziergängen oder unterhielt sich mit Erwachsenen, denen er begegnete. Häufig blieb er auch bei den größeren Kaufläden stehen. Dabei lauschte er den Gesprächen angesehener und erfahrener Männer. Auf diese Weise eignete er sich all mählich eine gewisse Weltkenntnis an.
Als von den zehn Goldstücken nichts mehr übrig war, nahm Aladdin seine Zuflucht zur Lampe. Er rieb sie an der Stelle, wo seine Mutter sie gerieben hatte. Sofort stieg derselbe Geist vor ihm empor.
Da Aladdin die Lampe weniger fest als seine Mutter gerieben hatte, sprach der Geist in milderem Ton: "Was willst du von mir? Ich bin dein Diener und der Diener aller, die diese Lampe in der Hand haben. Ich und alle übrigen Diener der Wunderlampe werden dir gehorchen."
Aladdin sagte: "Ich habe Hunger. Bring mir etwas zu essen!"
Der Geist verschwand. Nach einigen Augenblicken erschien er wie der mit ähnlichem Tafelzeug wie das erste Mal. Die Schüsseln waren voll der köstlichsten Speisen. Der Geist stellte seine Last vor Aladdin hin und verschwand.
Aladdins Mutter hatte dem Geiste nicht begegnen wollen. Darum war sie hinausgegangen, als ihr Sohn nach der Lampe gegriffen hatte. Jetzt kam sie zur Tür herein und war starr vor Staunen. Wieder war der Tisch mit silbernen Schüsseln voll duftender Speisen gedeckt. Sie setzten sich zu Tisch und schmausten. Nach der Mahlzeit war noch genug für die nächsten Tage vorhanden.
Als sie ihre Vorräte aufgezehrt hatten, wollte Aladdin wieder zum Händler gehen. Er nahm eine der silbernen Schüsseln, um sie zu verkaufen. Unterwegs kam er an dem Laden eines ehrlichen Goldschmiedes vorbei. Dieser bemerkte den Jungen und rief ihn in seinen Laden.
"Mein Sohn", sagte er zu Aladdin, "was hast du da? Ich habe dich schon oft mit einer Ware vorübergehen und mit einem Händler verhandeln sehen. Zurück gingst du immer mit leeren Händen. Ich glaube, du hast ihm die Gegenstände verkauft. Wahrscheinlich willst du jetzt wieder etwas loswerden. Nun weißt du vielleicht nicht, dass dieser Händler ein argerer Betrüger ist als alle andern Händler. Niemand, der ihn kennt, will etwas mit ihm zu tun haben. Hast du etwas zu verkaufen, so zeig es mir. Wenn du es hergeben willst, zahle ich dir den Preis, den die Ware wert ist. Ich will dich nicht beschwindeln, so wahr mir Allah gnädig sein soll!"
Nun zeigte Aladdin dem Goldschmied die Schüssel. Er gestand ihm auch, dass er dem Händler schon zwölf solcher Schüsseln verkauft habe. "Für jede habe ich ein Goldstück erhalten."
Da rief der Goldschmied: "Der Spitzbub hat dich betrogen! Diese Schüssel hier ist aus reinem Silber." Dann nahm er die Waage, um die Schüssel abzuwiegen. Er sagte, dass sie fünfzig Goldstücke wert sei. Diesen Preis bot er auch und zahlte ihn bar auf die Hand. Aladdin nahm das Geld und dankte dem Goldschmied für seinen guten Rat.
Sooft Aladdin nun eine Schüssel verkaufen wollte, wandte er sich an den Goldschmied. Er brachte ihm auch die Tasse und erhielt jedes Mal den vollen Wert.
Aladdin und seine Mutter waren jetzt wohlhabende Leute, denn sie hatten ja an der Lampe eine nie versiegende Geldquelle. Dennoch trieben sie keinen Aufwand und blieben mäßig und bescheiden. Die Mutter beschäftigte sich immer noch mit Baumwollspinnen; von dem Ertrag kaufte sie ihre Kleider. Bei dieser einfachen Lebensweise reichte das Geld jedes Mal für lange Zeit.
Während dieser Zeit verkehrte Aladdin im Kreise angesehener Kaufleute. Sie handelten mit Kleidern, feinen Stoffen und Juwelen. Und er unterhielt sich mit ihnen über Waren und Preise. Auf diese Weise erweiterten sich seine kaufmännischen Kenntnisse. Allmählich wurde er gewandt im Umgang mit besseren Leuten. Bei den Goldschmieden lernte er alle Edelsteine kennen und ihren Wert schätzen. So kam er zu der Einsicht, dass seine bunten Früchte aus dem unterirdischen Garten kostbare Juwelen waren. Aber nirgends bemerkte er Steine, die den seinen an Größe und Reinheit gleichkamen. Bald begriff er, dass die beiden Beutel hinter dem Diwanpolster einen unvergleichlichen Schatz bargen. Aladdin war klug genug, niemandem etwas davon zu sagen. Auch seine Mutter weihte er nicht ein. Diesem Stillschweigen verdankte er sein Glück.
Eines Tages befand er sich auf dem Weg zum Basar der Goldschmiede. Da hörte er einen Befehl des Sultans ausrufen. Es hieß, jedermann solle seinen Laden und sein Haus verschließen. Niemand dürfe sich bei Todesstrafe im Freien blicken lassen. Prinzessin Badrulbudur, die Tochter des Sultans, wolle sich ins Bad begeben.
Als Aladdin diesen Befehl hörte, überkam ihn das verlangen, die Prinzessin unverschleiert zu sehen. Aladdin hatte gehört, dass sie von unvergleichlicher Schönheit sei. Er versteckte sich also hinter der Tür des Bades. Dort musste er sie sehen können, ohne selbst gesehen zu werden.
Er brauchte nicht lange zu warten. Bald erschien die Prinzessin in Begleitung vieler Frauen und Dienerinnen. Er betrachtete sie durch eine Ritze in der Tür. Beim Eingang des Bades nahm sie den Schleier ab. Aladdin konnte ihr gerade ins Gesicht blicken. Ihr Antlitz war jugendlich frisch und von strahlender Schönheit.
Aladdin hatte bisher keine Frau außer seiner Mutter unverschleiert gesehen; und sie war nicht mehr jung und von Sorgen verhärmt. Wohl hatte er gehört, dass es Frauen von hervorragender Schönheit gäbe. Aber es ist ein Unterschied, von Schönheit zu hören oder sie selber zu schauen.
Nachdem Aladdin die Prinzessin gesehen hatte, verwirrten sich seine Gedanken und Gefühle. Verzaubert starrte er ihr nach. Sein Herz war erfüllt von Liebe und Verlangen nach dem reizenden Mädchen.
Endlich kam er wieder zur Besinnung und beschloss, nach Hause zu gehen. Daheim angelangt, konnte er seine Unruhe und Verwirrung nicht verbergen. Schließlich fragte ihn seine Mutter erstaunt, ob ihm etwas Unangenehmes zugestoßen oder ob er krank sei. Aber Aladdin gab keine Antwort. Er warf sich auf den Diwan, und seine Gedanken kreisten unablässig um die Prinzessin.
Die Mutter bereitete unterdessen das Abendessen. Schweigend setzte sich Aladdin zu Tisch, genoss aber nur wenig. Da setzte sich die Mutter neben ihn und versuchte, ihn auszufragen. Aber sie konnte ihm kein einziges Wort entlocken.
Aladdin verbrachte eine unruhige Nacht. Am nächsten Morgen brach er endlich das Stillschweigen und sagte: "Du hast wohl gemeint, ich sei krank, Mutter, und das hat dir Kummer gemacht. Ich war aber nicht krank und bin es auch jetzt nicht. Ich kann dir nicht sagen, was ich empfinde; vielleicht ist mein Zustand noch schlimmer als eine Krankheit. Aber ich werde dir erzählen, was gestern geschah; dann kannst du mir vielleicht einen Rat geben. Du wirst nicht davon gehört haben, dass sich die Prinzessin Badrulbudur gestern ins Bad begeben hat. Ich hörte es von den Ausrufern, als ich in der Stadt spazieren ging. Man verkündete nämlich, alle Leute sollten die Läden schließen; und bei Todesstrafe dürfe keiner auf der Straße verweilen, damit die Prinzessin freien Durchgang zum Bad habe. Da packte mich die Neugier. Ich wollte die Prinzessin mit unverschleiertem Gesicht sehen. Darum versteckte ich mich hinter der Tür zum Bade. Und wirklich: an der Tür nahm sie den Schleier ab. Ich hatte das Glück, ihr Antlitz zu sehen. Das ist der Grund meiner Unruhe und meines Schweigens. Als ich ihr Gesicht und ihre herrliche Gestalt sah, ergriff mich heiße Liebe zu ihr. Meine Sehnsucht nach ihr wird immer größer. Ich finde keine Ruhe mehr, wenn ich die Prinzessin nicht für mich gewinne. Darum bin ich fest entschlossen, sie vom Sultan zur Frau zu erbitten."
Aladdins Mutter hatte aufmerksam zugehört. Aber als ihr Sohn von seinen Heiratsabsichten sprach, musste sie laut auflachen. Er wollte fort fahren, aber sie ließ ihn gar nicht zu Wort kommen und sagte: "Mein Lieber, was fällt dir ein? Bist du wahnsinnig geworden, dass du solche Reden führst?"
"Nein, Mutter", entgegnete Aladdin, "mein Verstand war nie so hell wie jetzt. Ich habe deine Einwürfe vorausgesehen. Aber alle deine Worte werden meinen Entschluss nicht ändern. Ich sage dir nochmals, dass ich um die Hand der schönen Prinzessin anhalten werde."
"Ach, mein Sohn", sagte die Mutter, "ich bitte dich, rede nicht solchen Unsinn! Selbst wenn du deinen Entschluss ausführen wolltest, wer sollte denn deine Bitte dem Sultan vortragen? Wer sollte denn für dich um die Prinzessin anhalten?"
"Kein anderer als du", entgegnete Aladdin. "Ich wünsche, liebe Mutter, dass du meine Werbung vorbringst."
"Ich?" rief die Mutter. "Ich werde mich hüten, so etwas zu unternehmen. Wie kannst du überhaupt an die Tochter des Sultans denken? Vergiss doch nicht, dass du nur der Sohn eines armen Schneiders bist! Ihr Vater gibt sie nicht einmal Prinzen oder Sultans Söhnen zur Ehe. Wie kannst dann du es wagen, die Tochter des Sultans als Frau zu begehren!"
"Liebe Mutter", antwortete Aladdin, "ich sagte dir schon, dass ich alle diese Vorstellungen vorausgeahnt habe. Ich weiß auch, was du noch einwenden wirst. Das alles habe ich bedacht. Trotzdem werden deine Reden meinen Entschluss nicht zum Wanken bringen. Ich flehe dich an, tu mir den Gefallen! Wenn du mich lieb hast, geh zum Sultan und wirb für mich. Du wirst mir dadurch zum zweiten Mal das Leben schenken. , Wird die Prinzessin nicht meine Frau, so will ich nicht länger leben."
Aladdins Mutter geriet durch diese Hartnäckigkeit ihres Sohnes in größte Verlegenheit. Sie wollte ihm ja gern seinen Wunsch erfüllen; aber diesen Plan hielt sie für närrisch und undurchführbar.
Daher sprach sie zu ihm: "Mein Sohn, ich bin deine Mutter und liebe dich von Herzen. Soweit ich es vermag, will ich dir jeden vernünftigen Wunsch erfüllen. Wenn du es wünschst, werde ich dir eine Frau aus unserem Stande suchen. Ich würde auch um die Tochter eines unserer Nachbarn anhalten. Freilich müsstest du auch da etwas Vermögen und Einkommen besitzen oder ein Gewerbe erlernt haben. Jedermann fragt zuerst, wie der Freier seine Frau und später seine Familie erhalten werde. Du aber hast nichts und bist nichts. Wie kannst du es dann wagen, deine Augen zur Tochter des Sultans zu erheben! Überlege dir das! Wie kommst du auf den Gedanken, ich solle beim Sultan für dich freien? Selbst wenn ich so unverschämt wäre, wie bekäme ich Zutritt? An wen sollte ich mich wenden, dass er mich vorstellt? Und wollte ich den Zweck meiner Vorsprache angeben, würde man mich für eine Närrin halten und verjagen! Und gelänge es mir wirklich, bis zum Sultan zu kommen, was sollte ich dann sagen? Hast du dich um dein Land verdient gemacht? Bist du der Gnade des Sultans überhaupt würdig? Wie also kann ich mit einem solchen Ansinnen vor ihm erscheinen? Der Anblick seiner Macht und der königliche Prunk allein würden mir schon die Rede verschlagen. Ich zitterte bereits, wenn ich von deinem Vater etwas erbitten musste. Wie könnte ich nun gar vor diesem hohen Herrn etwas vorbringen? Dann fällt mir noch etwas ein: Wer den Sultan um eine Gnade bitten will, der muss ein Geschenk mitbringen. Aber was für ein Geschenk hast du ihm anzubieten? Wenn du nun gar seine Tochter zur Frau verlangst, welches Geschenk könnte diese Bitte unterstützen?"
Aladdin hörte alle Einwände seiner Mutter ruhig an. Er überlegte Punkt für Punkt. Dann sagte er: "Liebe Mutter, du hast recht. Ich hätte alles das bedenken sollen. Mein Verlangen war verwegen und unbesonnen. Ich hätte vorher daran denken müssen, dir Zutritt und günstige Aufnahme beim Sultan zu verschaffen. Verzeih mir! Die Liebe zur Prinzessin hat meine Gedanken verwirrt. Aber ich liebe sie so sehr, dass ich sie unbedingt heiraten werde. Ich danke dir, dass du mich an das Geschenk erinnert hast. Du hast daran gezweifelt, dass ich ein würdiges Geschenk für diesen Anlass besitze. Allein ich habe eines, das wert ist, dem Sultan überreicht zu werden; es ist ein Geschenk, um das ihn Fürsten und Könige beneiden werden. Du weißt, Mutter, ich habe aus dem unterirdischen Garten buntfarbige Steine mitgebracht. Wir meinten, diese Steine seien aus Glas. Es sind aber kostbare Edelsteine von höchster Schönheit; ihresgleichen gibt es in keinem Lande der Welt. In den Läden der Goldschmiede habe ich viele herrliche Edelsteine gesehen; aber sie alle halten den Vergleich mit meinen Steinen nicht aus. Und doch werden sie zu unbeschreiblich hohen Preisen verkauft. Wie hoch muss dann erst der Wert meiner Steine sein! Du hast eine hohe Porzellanvase, Mutter. Gib sie mir, wir wollen sie mit Edelsteinen füllen. Dann magst du die strahlende Pracht bewundern. Ich glaube, auch der Sultan hat so etwas noch nie gesehen."
Die Mutter brachte die Vase herbei. Aladdin nahm die Steine aus den Beuteln und legte sie schön geordnet hinein. Da strahlte und blitzte es aus der Vase, dass Mutter und Sohn geblendet die Augen schließen mussten. Solchen Glanz und solches Feuer hatten sie noch nie an den Steinen bemerkt; freilich hatten sie diese bisher nur bei Lampenlicht gesehen. Nun aber lockte der helle Sonnenschein sprühende Funken hervor.
Nachdem sie die Schönheit des Geschenkes eine Weile bewundert hatten, sagte Aladdin: "Glaubst du nun, Mutter, dass dies ein passendes Geschenk für den Sultan ist? Jetzt kannst du den Gang zu Hofe wagen. Mit diesem Geschenk wirst du sicher gnädig empfangen werden."
Aladdins Mutter war von dem Wert des Geschenkes nicht so überzeugt wie ihr Sohn. Trotzdem hoffte sie, es werde wohl Gnade finden. Aber als sie der Bitte ihres Sohnes gedachte, wurde sie abermals unsicher. Er und die Prinzessin!
"Lieber Sohn", sagte sie, "dieses Geschenk ist prächtig und wert voll. Es wird seine Wirkung tun und mir gnädige Aufnahme beim Sultan verschaffen. Aber ich werde nicht den Mut haben, deine Werbung um des Sultans Tochter vorzubringen; da wird mein Mund stumm bleiben. So wird nicht nur mein Gang vergeblich sein, sondern auch das Geschenk; und ich werde dir bestürzt verkünden müssen, dass deine Hoffnung vergeblich war. Sollte ich aber doch imstande sein, deinen Wunsch auszusprechen, wird uns der Sultan für Narren halten und mich mit Schimpf und Schande davonjagen oder uns beide bestrafen."
Aladdins Mutter führte noch mehr Gründe an, die gegen einen Empfang beim Sultan sprachen. Aber das Bild der Prinzessin war zu tief in seinem Herzen verankert. Er wollte seinen Plan, sie zu seiner Frau zu machen, nicht aufgeben. Darum drängte und bat er seine Mutter, bis sie aus Furcht vor seiner Unbesonnenheit nachgab.
An diesem Tag aber war es für die Anmeldung beim Sultan zu spät. So wurde die Sache auf den nächsten Tag verschoben. Bis dahin sprachen Mutter und Sohn nur vom morgigen Gang zu Hofe. Aladdin schärfte ihr neuerlich ein, was sie tun und sagen solle.
Die Mutter aber fragte ihn noch: "Mein Sohn, wenn mich der Sultan wirklich anhört, was soll ich sagen, wenn er nach deinem Besitz und Vermögen fragt?"
"Liebe Mutter", erwiderte Aladdin, "wenn es zum Äußersten kommt, muss uns die Lampe helfen. Sie sorgt seit einigen Jahren für unsern Unterhalt. Ich hoffe, dass sie mich auch in dieser Not nicht im Stich lassen wird."
Hierauf wusste Aladdins Mutter nichts zu entgegnen. Sie dachte, die Lampe habe wirklich bisher Wunder vollbracht; nun könne man auch noch Größeres von ihr erhoffen.
Aladdin erriet die Gedanken seiner Mutter. Er sagte zu ihr: "Liebe Mutter, sprecht zu keinem Menschen von der Lampe! Sie ist unser größter Schatz. Der glückliche Ausgang unseres Beginnens wird ganz von ihr abhängen."
Erst tief in der Nacht suchten sie ihr Lager auf. Aber schon vor Tagesanbruch weckte Aladdin die Mutter wieder. Er bestürmte sie, sich rasch anzukleiden und zum Tor des Palastes zu eilen. Dann könne sie zugleich mit dem Großwesir und den übrigen Großen des Reiches den Palast betreten und ihnen in die Ratsversammlung folgen. Dieser pflegte der Sultan stets beizuwohnen.
Aladdins Mutter tat alles, was ihr Sohn wünschte. Sie hüllte die Porzellanvase in feines, weißes Linnen. Darüber band sie ein gröberes Tuch, um das leichter forttragen zu können. Endlich machte sie sich zur großen Freude Aladdins auf den Weg zum Palast des Sultans.
Soeben betrat der Großwesir mit allen Würdenträgern des Hofes den Palast. Eine große Menge von Bittstellern schloss sich ihnen an. Die Mutter folgte dem Zuge und gelangte so in den großen Prunksaal; dort hielt der Sultan die Versammlung ab. Sie stellte sich gerade dem Thron des Sultans gegenüber au£ Die Großen des Reiches waren rechts und links von ihm versammelt. Dann wurden dem Sultan die Rechtsfälle vor getragen. Man rief die Parteien in der Reihenfolge, in der sie ihre Gesuche eingebracht hatten. Viele Angelegenheiten wurden verlesen, beraten und entschieden, bis die Versammlung wieder geschlossen wurde. Schließlich erhob sich der Sultan und ging in seine Gemächer zurück. Der Großwesir und alle übrigen Mitglieder des Staatsrates entfernten sich. Auch die Parteien, die Gesuche vorgelegt hatten, gingen nach Hause. Manche waren vergnügt über den Ausgang ihres Rechtsfalles, andere wieder unzufrieden über das gefällte Urteil. Einige hofften, ein andermal mit ihrer Sache vorzukommen.
Als Aladdins Mutter sah, dass sich der Sultan zurückzog, ging sie gleichfalls nach Hause. Als ihr Sohn sie mit dem Geschenk zurückkamen sah, erschrak er; er konnte sich nicht erklären, was das bedeuten solle. Er fürchtete, seine Sendung sei misslungen, und er getraute sich gar nicht, die Mutter zu fragen.
Die Mutter, die noch niemals bei einer Ratsversammlung gewesen war, begann treuherzig zu erzählen: "Gott sei Dank, dass ich heute im Sultanspalast war. Wenn ich auch heute noch nicht mit dem Sultan gesprochen habe, so hoffe ich doch, morgen mit ihm zu reden. Heute habe ich den Sultan gesehen. Ich stand ihm gerade gegenüber. Ich bin überzeugt, dass er auch mich bemerkt hat. Aber er war sehr beschäftigt mit den Leuten, die rechts und links von ihm saßen. Er tat mir leid, als ich sah, mit wie viel Mühe und Geduld er sie anhörte. Das dauerte sehr lange. Zuletzt mag es ihm schon langweilig geworden sein, weil er auf einmal aufstand und wegging. Es waren zwar noch viele Leute da, die mit ihm sprechen wollten. Aber ich war sehr froh darüber, denn auch mir wurde die Sache schon langweilig. Außerdem war ich sehr müde vom langen Stehen. Es ist also nichts verloren. Ich werde dir zuliebe morgen wieder hingehen. Vielleicht hat der Sultan dann mehr Zeit."
Aladdin hat die Entscheidung ungeduldig erwartet. Aber gegen die Entschuldigung seiner Mutter konnte er nichts vorbringen; er musste sich bis zum nächsten Tag gedulden. Das eine hatte er wenigstens schon erreicht, dass die Mutter den gefürchteten Gang angetreten und den Anblick des Sultans ertragen hatte, ohne vor Angst von Sinnen zu kommen. Er hoffte, dass sie morgen in einem günstigen Augenblick ihr Anliegen vorbringen werde.
Am nächsten Morgen eilte sie mit ihrem Geschenk wieder zeitlich zum Palast des Sultans. Das Tor aber war verschlossen. Von andern Leuten erfuhr sie, dass nur jeden zweiten Tag Ratssitzung sei. Also ging sie wieder heim und brachte ihrem Sohn diese Nachricht. Aladdin musste sich wieder mit Geduld wappnen.
Sechsmal ging die Mutter in die Ratsversammlung. Jedes Mal stellte sie sich dem Sultan gegenüber auf. Aber nie fand sie den Mut, vor zu treten oder ein Wort zu sagen. Sie wäre wahrscheinlich noch hundertmal vergebens hingegangen, wenn nicht der Sultan selbst auf sie aufmerksam geworden wäre.
Als er nach der Sitzung in seine Gemächer zurückgekehrt war, sagte er zu seinem Großwesir: "Wesir, seit einiger Zeit fällt mir bei jeder Sitzung eine Frau auf. Immer steht sie mir gerade gegenüber. Sie trägt etwas in der Hand, das in Leinwand gehüllt ist. Vom Anfang bis zum Ende der Sitzung bleibt sie dort stehen. Aber sie sagt nie ein Wort. Weißt du, was für ein Anliegen sie hat?"
Der Großwesir wusste so wenig davon wie der Sultan. Er wollte aber seinem Herrn nicht die Antwort schuldig bleiben; darum sagte er:
"Herr, die Frauen beschweren sich doch oft über die geringfügigsten Dinge. Vielleicht will diese über ihren Mann oder einen ihrer Verwandten Klage führen. Vielleicht aber hat man ihr schlechtes Mehl verkauft oder sonst ein kleines Unrecht zugefügt."
Der Sultan gab sich mit dieser Antwort des Großwesirs nicht zufrieden. Er befahl ihm, die Frau bei der nächsten Sitzung rufen zu lassen. Er wolle sie anhören. Der Großwesir küsste die Hand des Sultans und legte sie auf seinen Kopf. Das bedeutete, dass er bereit sei, sich den Kopf abschlagen zu lassen, wenn er diesen Befehl nicht ausführe.
Am nächsten Sitzungstag ging Aladdins Mutter wieder in die Ratsversammlung. Sie war es ja schon gewohnt. Zwar war bisher jeder Gang vergeblich gewesen; doch aus Liebe zu ihrem Sohn wollte sie alles tun, um endlich zu einem Erfolg zu gelangen. Sie stellte sich wieder dem Sultan gegenüber auf.
Als dieser sie erblickte, war er gerührt über ihre Geduld und Ausdauer. Er sagte zum Großwesir: "Wesir, da steht ja die Frau, von der ich neulich gesprochen habe. Lass sie hierher kommen. Wir wollen sie anhören, damit wir ihr Anliegen erfahren und ihre Sache entscheiden."
Sofort ging der Großwesir und gab der Frau ein Zeichen, näher zutreten. Sie folgte ihm bis an die Stufen des Thrones. Dort tat sie, wie sie es bei andern gesehen hatte: Sie berührte mit ihrer Stirn die Stufen des Thrones.
In dieser Stellung verharrte sie, bis der Sultan zu ihr sprach: "Gute Frau, ich sehe dich schon lange in den Ratssaal kommen. Du bleibst vom Anfang bis zum Ende der Sitzung am Eingang stehen, ohne dass du ein Wort sagst. Nun verrate mir, welche Angelegenheit dich hierher führt!" Wieder warf sich Aladdins Mutter zu Boden. Sie küsste die Stufen des Thrones und flehte den Segen des Himmels über den Sultan herab. Dann stand sie auf und sagte: "Erhabener Herrscher, ich habe ein Anliegen. Aber bevor ich es Euch unterbreite, bitte ich, mir die unglaubliche Kühnheit zu verzeihen. Mein Ansuchen ist so ungewöhnlich, dass ich zittere und bebe. Ich habe große Scheu, Herr, es Euch vorzutragen."
Um ihr Sicherheit und Freiheit im Reden zu geben, befahl der Sultan, ihn mit der Frau und dem Großwesir allein zu lassen. Dann sagte er, sie könne ohne Furcht sprechen.
Aladdins Mutter aber war noch nicht ganz zufrieden. Sie wollte sich auch vor seinem Zorne sicherstellen, den sie bei ihrem seltsamen Antrag befürchten musste.
"Herr", fuhr sie fort, "ich bitte Euch untertänigst, gewährt mir im Voraus gütigst Eure Gnade und Verzeihung. Vielleicht werdet Ihr mein Anliegen töricht oder beleidigend finden." "Was es auch sein mag", erwiderte der Sultan, "ich werde dir verzeihen. Nicht die geringste Strafe soll dich treffen. Sprich ohne Scheu!"
Nun erzählte sie ihm treuherzig, wie ihr Sohn die Prinzessin Badrulbudur gesehen und sich in sie verliebt habe. Sie sprach von den Plänen und Wünschen Aladdins. Sie erwähnte aber auch die Bedenken, die sie dagegen erhoben hatte.
"Aber", fuhr sie fort, "statt auf mich zu hören, bestand er nur umso nachdrücklicher auf seinem Wunsch. Er drohte sogar, sich ein Leid anzutun, wenn ich mich weigerte, für ihn zu werben. Trotzdem hat es mich die größte Überwindung gekostet, Euch mit dieser Sache zu belästigen. Ich bitte Euch vielmals, verzeiht mir mein verwegenes Unternehmen. Verzeiht auch meinem Sohne die Dreistigkeit, an eine so erhabene Verbindung zu denken."
Der Sultan hatte die Rede der Mutter voll Güte angehört. Er äußerte nicht den mindesten Zorn oder Unwillen. Auch schien er die ganze Angelegenheit gar nicht lächerlich zu finden. Bevor er aber eine Antwort erteilte, fragte er sie lächelnd nach ihrem leinenen Bündel. Aladdins Mutter sah nun, dass der Sultan nicht unwillig war, ja sogar lächelte. Da warf sie sich nieder, enthüllte die Vase und überreichte sie dem Sultan.
Geblendet blickte der Sultan auf die Edelsteine. Zuerst war er vor Überraschung keines Wortes mächtig. Er hatte noch nie so viele kostbare Steine beisammen gesehen. Auch waren sie von einer Größe, wie sie ihm bisher noch nie vor Augen gekommen.
Begeistert nahm er die Vase aus den Händen der Frau in Empfang und rief aus: "Wie schön und einzigartig, wie kostbar sind diese Edelsteine!" Er nahm einen Stein nach dem andern in die Hand und pries ihr Feuer und ihre Reinheit.
Dann wandte er sich an den Großwesir, zeigte ihm die Vase und sagte: "Sieh dir diese Steine an! Du wirst gestehen müssen, dass man auf der ganzen Welt nichts Herrlicheres und Vollkommeneres finden kann!" Der Großwesir stimmte in begeisterten Worten zu. Der Sultan aber fuhr fort: "Ja, wer mir solche kostbare Juwelen schenken kann, ist wert, der Gatte meiner Tochter zu werden."
Diese Worte des Sultans versetzten den Großwesir in eine peinliche Unruhe. Erst kürzlich hatte ihm sein Herr angedeutet, dass er die Prinzessin mit seinem Sohn vermählen wolle. Dieses prachtvolle Geschenk kam ihm ungelegen. Nun fürchtete er nicht ohne Grund, der Sultan werde sich anders besinnen. Er flüsterte ihm daher ins Ohr, er möge mit seiner Entscheidung gnädigst noch drei Monate zuwarten. Schließlich habe der Sultan seinem Sohn die Prinzessin früher versprochen. Und bis dahin werde er ein noch weit kostbareres Geschenk darbringen. Der Sultan war zwar überzeugt, dass das unmöglich sei. Aber er geruhte, den Aufschub von drei Monaten zu gewähren.
Er wandte sich also an Aladdins Mutter und sagte zu ihr: "Geh nach Hause, gute Frau! Sag deinem Sohne, dass ich seinen Antrag genehmige!
"Doch muss er sich noch drei Monate gedulden. Es müssen große Vorbereitungen für die Hochzeit getroffen werden. Nach drei Monaten aber magst du wiederkommen."
Strahlend bedankte sich Aladdins Mutter beim Sultan und eilte nach Hause. Ihre Freude war groß. Hatte sie doch gefürchtet, der Sultan werde sie gar nicht anhören. Nun brachte sie ihrem Sohn die günstige Botschaft. Er sah die Mutter früher als sonst und ohne Bündel heimkehren. Als sie lächelnd das Zimmer betrat, wurde ihm froh und leicht zumute. Er schloss daraus auf einen guten Bescheid.
"Liebe Mutter", fragte er, "bringst du mir gute Kunde? Hat sich der Sultan gnädig erwiesen und das Geschenk angenommen? Was hat er zu deiner Werbung gesagt?"
Die Mutter legte den Schleier ab und setzte sich zu ihrem Sohn auf den Diwan. Dann begann sie: "Ich möchte dich nicht lange im Ungewissen lassen. Darum will ich dir gleich sagen, dass du Ursache hast, dich zu freuen. Der Sultan hat mir versprochen, dass seine Tochter deine Frau werden soll."
Dann schilderte sie ihm, wie alles gekommen war. Sie berichtete, mit welchen Worten sie die Werbung eingeleitet hätte. Schließlich wieder holte sie genau, was der Sultan zu dem Geschenk gesagt hatte. Es war ihr aber nicht entgangen, dass der Großwesir mit dem Bescheid des Sultans nicht ganz einverstanden war. Er hatte den Herrscher an scheinend bereden wollen, sie abzuweisen.
Freudig und voll froher Hoffnung verbrachte Aladdin die nächsten Tage. Er dünkte sich reicher und glücklicher als alle Menschen. Seiner Mutter aber war er unendlich dankbar. Die drei Monate Wartezeit er schienen ihm wie eine Ewigkeit. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als mit Geduld zu warten. Das Wort des Sultans schien ihm eine sichere Gewähr, das Ziel seiner Sehnsucht zu erreichen. Trotzdem zählte er die Stunden, Tage und Wochen.
Zwei Monate der angesetzten Frist waren schon verstrichen, als seine Mutter eines Abends kein Öl für die Lampe hatte. Sie ging also, um Öl einzukaufen. Zu ihrer Verwunderung war die Stadt festlich beleuchtet.
Die Bewohner hatten ihre Häuser mit Blumen und Kränzen geschmückt; einer suchte den andern an Glanz und Pracht zu übertreffen. In den Straßen bewegte sich eine festlich gekleidete Menge. Aus allen Gesichtern strahlten hellste Freude und Fröhlichkeit. Hofbeamte ritten auf reich geschmückten Pferden in feierlichem Aufzug durch die Stadt. Überall gab es brennende Fackeln und Lichter. Schließlich kam sie zum Ölhändler. Ihn fragte sie, was dieses festliche Treiben bedeute.
"Woher kommst du denn, liebe Frau?" erwiderte der Ölhändler. "Weißt du denn wirklich nicht, dass heute die Prinzessin Badrulbudur mit dem Sohn des Großwesirs vermählt wird? Gleich wird sie aus dem Bade kommen. Alle diese Herren hier haben sich versammelt, um ihr das Ehrengeleit zum Palaste zu geben. Dort wird die Feierlichkeit vor sich gehen."
Aladdins Mutter wollte gar nichts mehr hören. Bestürzt lief sie nach Hause. Sie traf ihren Sohn in ruhiger Stimmung an. Auf eine so schlimme Nachricht war er ja nicht gefasst.
"Mein Sohn", rief sie noch unter der Tür, "es ist alles verloren! Der Sultan wird sein Wort nicht halten." "Warum sollte er es nicht halten?" entgegnete Aladdin. "Wer hat dir denn das gesagt?" "Noch heute", versetzte die Mutter, "wird die Prinzessin den Sohn des Großwesirs heiraten. Die ganze Stadt ist festlich geschmückt. Alle Leute sprechen davon." Sie berichtete ihm alles, was sie gesehen und gehört hatte. Nun konnte er an der Wahrheit nicht mehr zweifeln.
Aladdin war von dieser Nachricht wie vom Blitz getroffen. Aber er fasste sich rasch. Sein erster Gedanke war die Lampe. Sie musste jetzt helfen.
Ohne mit einem Wort den Sultan oder den Großwesir zu schmähen, sagte er nur: "Liebe Mutter, ich glaube, der Sohn des Großwesirs wird nicht so glücklich sein, wie er hofft. Doch reden wir nicht weiter darüber. Bring uns lieber das Abendessen! Dann will ich ein wenig in die Kammer gehen. Es wird schon alles gut werden."
Aladdins Mutter ahnte, was ihr Sohn vorhatte. Er würde wohl die Wunderlampe gebrauchen, um die Heirat der Prinzessin zu hinter treiben. Und sie täuschte sich nicht. Nach dem Abendessen ging Aladdin in sein Zimmer und verschloss die Tür hinter sich. Dann holte er die Lampe hervor und rieb sie.
Augenblicklich zeigte sich der Geist und sprach zu ihm: "Was verlangst du? Ich bin dein Diener und der Diener aller, die diese Lampe in der Hand haben. Ich und alle übrigen Diener der Lampe werden dir gehorchen."
Da sagte Aladdin: "Höre, du hast mir bisher auf meinen Wunsch immer zu essen gebracht. Diesmal habe ich einen andern Auftrag für dich. Der Sultan hat mir die Hand seiner Tochter versprochen. Nun hält er sein Wort nicht. Noch vor Ablauf der Frist von drei Monaten vermählt er sie mit dem Sohn des Großwesirs. Nun befehle ich dir als treuem Diener der Lampe, die Neuvermählten zu entführen und hierher zu bringen."
"Mein Gebieter", erwiderte der Geist, "ich werde diesen Befehl ausführen. Hast du noch einen Wunsch?"
"Für den Augenblick keinen", sagte Aladdin. Da verschwand der Geist.
Aladdin aber begab sich zu seiner Mutter zurück. Ruhig verbrachte er den Abend. Er unterhielt sich mit ihr über die Vermählung der Prinzessin. Aber er sprach so, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Nach einiger Zeit ging er in seine Kammer, ohne sich jedoch zu Bett zu begeben. Er erwartete die Rückkehr des Geistes und den Vollzug seines Befehles.
Es dauerte gar nicht lange, da brachte auch schon der Geist die beiden Neuvermählten. Zu ihrem großen Erstaunen setzte er sie mitten im Zimmer Aladdins nieder. Aladdin hatte diesen Augenblick voll Ungeduld erwartet. Nun sagte er hocherfreut zu dem Geist:
"Nimm diesen jungen Ehemann und trag ihn hinaus in ein anderes Gemach! Morgen früh bei Tagesanbruch komm wieder zu mir!"
Augenblicklich trug der Geist den Sohn des Großwesirs fort. In einer kleinen Kammer legte er ihn nieder. Dort hauchte er ihn an; dadurch wurde er betäubt und konnte sich die ganze Nacht nicht rühren. Aladdin war glücklich, die Prinzessin so nahe zu sehen. Aber er wahrte ehrerbietigste Zurückhaltung und sagte nur in zärtlichem Ton: ,Fürchtet Euch nicht, erlauchte Prinzessin! Ihr seid in Sicherheit: Nichts soll Euch zuleide geschehen. Wie groß auch meine Liebe zu Euch ist, nie werde ich die Schranken der Ehrfurcht überschreiten, die ich Euch schulde."
Die Prinzessin war wie betäubt von dem unerwarten, rätselhaften Ereignis. Sie hörte kaum auf die Reden Aladdins. Auch war sie so verstört, dass sie kein Wort hervorbrachte. Aladdin aber war zufrieden mit dem Gang der Ereignisse. Er suchte sein Lager auf und war bald in ruhigen Schlummer versunken. Nicht so die Prinzessin. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich in einer so engen, düsteren Kammer befand. In ihrem ganzen Leben hatte sie keine schlimmere Nacht verbracht. Noch ärger erging es dem Sohn des Großwesirs, der sich in seinem finsteren Loch nicht einmal rühren konnte.
Am nächsten Morgen brauchte Aladdin nicht erst die Lampe zu reiben, um den Geist zu rufen. Zeitlich am Morgen stand dieser an seinem Lager und sagte: "Mein Herr und Gebieter, hier bin ich! Befiehl, und ich werde mit Freuden gehorchen."
"Geh", sagte Aladdin, "und hole den Sohn des Großwesirs von dem Ort, wohin du ihn gebracht hast. Dann trag ihn und die Prinzessin wieder in den Palast des Sultans zurück!"
Sogleich nahm der Geist die beiden auf. Er trug sie in dasselbe Gemach des Schlosses zurück, aus dem er sie entführt hatte.
Der Geist war aber weder der Prinzessin noch ihrem Gatten sichtbar. Sie wären wahrscheinlich zu Tode erschrocken, hätten sie seine schreckliche Gestalt gesehen. Auch von dem Gespräche zwischen Aladdin und dem Geist hatten sie nichts gehört. Sie merkten nur, dass sie von einem Ort zum andern getragen wurden; das allein genügte, um ihnen den größten Schrecken einzujagen.
Kaum hatte der Geist die beiden in ihr Zimmer gebracht, öffnete sich schon die Tür. Der Sultan trat herein, um guten Morgen zu wünschen und nach ihrem Befinden zu fragen. Nun hatte der Sohn des Großwesirs die ganze Nacht in der Kälte gelegen; kaum hatte er sich jetzt in seinem Bett erwärmt, musste er wieder heraus. So unbehaglich ihm auch zumute war, er musste sich in seine Kleider werfen. Der Sultan trat zum Bett seiner Tochter, küsste sie auf die Stirn und fragte, wie es ihr gehe. Sie aber gab keine Antwort. Als er sie aufmerksamer betrachtete, sah er in ihrer Miene tiefe Schwermut; traurig blickte sie ihn an. Aber sie antwortete nicht auf seine Fragen.
Der Sultan war überzeugt, dass dieses Schweigen eine tiefe Ursache haben müsse. Deshalb begab er sich in das Zimmer seiner Gemahlin und teilte ihr mit, wie ihn die Prinzessin empfangen habe.
"Herr", sagte die Sultanin, "das braucht Euch nicht zu wundern. Nach der Hochzeit sind alle jungen Frauen zurückhaltend. Wartet nur, in ein paar Tagen wird sich dies ändern, und dann wird sie ihren Vater empfangen, wie es sich gebührt. Doch will ich gleich zu ihr gehen; ich müsste mich sehr täuschen, wenn sie mich ebenso empfinge wie Euch."
Die Sultanin begab sich also in das Zimmer der Prinzessin. Sie war sehr erstaunt, als auch ihr Morgengruß nicht erwidert wurde. Ihre Tochter sah sehr niedergeschlagen aus. Etwas Besonderes musste sich ereignet haben, sonst könnte sie nicht so verstört sein. Aber was?
"Liebe Tochter", begann sie, "warum sprichst du kein Wort? Warum erwiderst du meine Zärtlichkeit nicht? Sag mir, was sich ereignet hat. Lass mich nicht so lang in dieser peinlichen Ungewissheit:"
Da hob die Prinzessin ihr Haupt und seufzte tief: "Ach, liebe Mutter, seid nicht böse, wenn ich Euch nicht geziemend empfangen habe. Aber in dieser Nacht sind so seltsame Dinge geschehen. Mein Geist kann sie noch immer nicht fassen. Ich habe Mühe, wieder zu mir selber zu kommen."
Die Prinzessin schilderte nun, was sich in der Nacht ereignet hatte. Sie berichtete, wie sie mit ihrem Gatten in eine armselige Kammer entführt und dann von ihm getrennt worden sei. In der Kammer sei ein fremder junger Mann gewesen. Dieser habe zu ihr gesprochen; aber in ihrer Aufregung habe sie nichts verstanden. Dann sei der Jüngling zu Bett gegangen und ruhig eingeschlafen. Sie aber habe dort die schlimmste Nacht ihres Lebens verbracht. Am Morgen seien sie und ihr Gemahl wieder ins Schloss zurückgebracht worden.
"Kaum waren wir hier", fuhr sie fort, "trat schon mein Vater ins Zimmer. Ich aber war noch nicht imstande, eine Antwort auf seine Fragen zu geben. Sicherlich zürnt er mir nun, weil ich die Ehre seines Besuches nicht gebührend gewürdigt habe. Doch wird er meinen traurigen Zustand verstehen, wenn er von meinem schrecklichen Abenteuer erfährt. Ich hoffe, dass er mir dann verzeihen wird."
Die Sultanin hörte die Erzählung ihrer Tochter ruhig an. Aber sie fand sie so unglaubwürdig, dass sie entgegnete: "Liebe Tochter, du hast gut daran getan, nichts von all dem deinem Vater zu erzählen. Sag auch keinem andern Menschen ein Sterbenswort davon! Man würde dir nicht glauben, dich sogar für eine Närrin halten."
"Mutter", antwortete die Prinzessin, "ich bin nicht wahnsinnig, sondern bei klarem Verstand. Ich habe das alles wirklich erlebt. Fragt nur meinen Gemahl; er wird Euch dasselbe erzählen."
Dann begab sie sich in das Zimmer des Sultans. Sie sagte ihm, ihre Tochter habe in der Nacht böse Träume gehabt. Deshalb sei sie am Morgen noch sehr beunruhigt gewesen; jetzt aber sei alles wieder gut. Dann ließ sie den Sohn des Großwesirs rufen. Ihn fragte sie, was an den Worten seines jungen Weibes Wahres sei. Der Sohn des Großwesirs fürchtete, durch diese Geschichte seine Gattin zu verlieren; darum erklärte er, er wisse von nichts. Da war die Sultanin überzeugt, dass ihre Tochter nur geträumt habe.
Die Lustbarkeiten dauerten den ganzen Tag. Es wurde getanzt und gesungen, und unaufhörlich erklang fröhliche Musik. Die Sultanin wich ihrer Tochter nicht von der Seite. Sie bemühte sich eifrig, die Prinzessin zu allerlei Vergnügungen aufzumuntern; dadurch sollte sie ihren Kummer vergessen. Aber die Erlebnisse der Nacht waren zu groß gewesen. Sie hatte für nichts anderes Sinn.
Aladdin war auch in die Stadt gegangen, um sich die Festlichkeiten anzusehen. Die Leute redeten über das Glück und die Ehre, die dem Sohn des Großwesirs zuteil geworden sei. Als Aladdin das hörte, musste er lächeln. Er dachte bei sich: Ihr wisst ja nicht, wie es ihm heute Nacht ergangen ist; sonst würdet ihr ihn wohl nicht beneiden. Als die Zeit vorgerückt war, ging er nach Hause. Dort holte er die Lampe hervor und rieb sie. Sogleich erschien der Geist und bot ihm seine Dienste an. Aladdin beauftragte ihn, das junge Paar so wie gestern hierherzubringen.
Der Geist zögerte nicht und verschwand. Und nun ereignete sich das gleiche wie in der vergangenen Nacht. Der Sohn des Großwesirs lag wieder furchterstarrt allein in seinem kalten Raum; und die Prinzessin versuchte vergebens, in der engen, dumpfen Kammer zu schlafen. Nur Aladdin schlummerte ruhig und fest. Am Morgen nahm der Geist die Prinzessin und ihren Gemahl und trug sie in das Schloss zurück.
Neugierig hatte der Sultan den nächsten Tag erwartet. Ob ihm seine Tochter wieder einen so kühlen Empfang bereiten würde? Am frühen Morgen trat er in ihr Gemach, um sie zu begrüßen.
Eben war der Sohn des Großwesirs zähneklappernd ins Bett gestiegen. Aber als er den Sultan kommen hörte, sprang er eilig heraus. Verbittert stürzte er in sein Ankleidezimmer.
Die Prinzessin blickte traurig vor sich hin. Aber sie gab keine Antwort. Der Sultan bemerkte, dass sie noch verstörter war als das erste Mal. Nun zweifelte er nicht mehr, dass ihr etwas Außerordentliches zugestoßen sein müsse. Er war erbittert darüber, dass sie ihn keines Wortes würdigte. Darum riss er den Säbel aus der Scheide.
"Gesteh, was du mir verbirgst", rief er zornentbrannt, "oder ich schlage dir augenblicklich den Kopf ab!"
Daraufhin berichtete die Prinzessin dem Sultan alles, was vorgegangen war. Sie erzählte mit so rührenden Worten, dass ihn tiefes Mitleid mit seiner Tochter ergriff. Sie schloss mit den Worten: "Mein Vater, ich hoffe, Ihr glaubt mir! Aber wenn Ihr an der Wahrheit meiner Erzählung zweifelt, so fragt meinen Gatten. Er wird Euch alles bestätigen."
Der Sultan war tief bekümmert über diesen Bericht seiner Tochter. Er sagte: "Liebe Tochter, warum hast du mir diese seltsame Geschichte nicht schon gestern erzählt? Ich wollte nur dein Glück, als ich dich verheiratete. Nun aber bist du so unglücklich. Doch verscheuche die düsteren Gedanken und fasse Mut! Du sollst von nun an gut bewacht werden und keine solche Nacht mehr durchmachen müssen."
Hierauf kehrte der Sultan in seine Gemächer zurück. Sofort ließ er den Großwesir rufen.
"Wesir", sprach er zu ihm, "wie geht es deinem Sohn? Hast du ihn schon gesprochen? Was erzählt er von den beiden letzten Nächten?"
Der Großwesir antwortete, er habe ihn noch nicht gesehen. Nun teilte ihm der Sultan mit, was die Prinzessin ihm soeben erzählt hatte.
"Und ich zweifle nicht", setzte er fort, "dass meine Tochter die Wahrheit gesagt hat. Doch wäre es mir lieb, wenn dein Sohn es bestätigte. Geh also zu ihm und frag ihn, wie sich die Sache verhält!"
Der Großwesir suchte sogleich seinen Sohn auf. Er teilte ihm den Befehl des Sultans mit und forderte, er solle die volle Wahrheit sagen und nichts verheimlichen.
"Mein Vater", rief der Jüngling, "ich brauche nichts zu verhehlen! Alles, was die Prinzessin gesagt hat, ist wahr. Dabei hat sie gar nicht alles erzählt. Wie es mir ergangen ist, weiß sie ja nicht. Seit meiner Vermählung habe ich zwei schreckliche Nächte verbracht; mir fehlen die Worte, sie eingehend zu schildern. Aber es war unheimlich, viermal emporgehoben und an einen andern Ort getragen zu werden. Ich begreife jetzt noch nicht, wie das möglich war. Aber der Ort, wo ich mich aufhalten musste, war scheußlich. Der Raum war kalt, finster und übelriechend. Die Zähne klapperten mir vor Kälte. Bei aller Liebe zur Prinzessin und trotz der hohen Ehre möchte ich lieber sterben, als mich noch länger einer solchen Behandlung auszusetzen. Sicher denkt die Prinzessin ebenso wie ich. Darum, lieber Vater, erwirke beim Sultan, dass unsere Ehe für ungültig erklärt wird."
Als der Großwesir den verzweifelten Bericht seines Sohnes gehört hatte, begab er sich zum Sultan. Er meldete, dass die Erzählung der Prinzessin auf Wahrheit beruhe. Deshalb bat er um die Erlaubnis, dass sein Sohn den Palast verlassen und nach Hause zurückkehren dürfe. Die Prinzessin solle seinetwegen nicht einen Augenblick länger der Angst vor einer abermaligen Entführung ausgesetzt sein.
Der Sultan hatte selbst schon die Auflösung der Ehe erwogen. Darum gab er dem Wesir ohne weiteres seine Einwilligung. Sofort erging der Befehl, die Feiern im ganzen Land einzustellen. In kurzer Zeit hörten alle Festlichkeiten auf.
Alle Leute wunderten sich darüber. Verschiedene Gerüchte wurden in der Stadt laut, allein niemand wusste etwas Bestimmtes. Man hatte nur den Großwesir und seinen Sohn traurig aus dem Palast kommen sehen. Der einzige, der das Geheimnis genau kannte, war Aladdin. Aber er sagte nichts und lachte sich ins Fäustchen. Nun hatte er keinen Nebenbuhler mehr zu fürchten. Und er bedurfte auch nicht mehr der Hilfe des Geistes.
Der Sultan dachte schon lange nicht mehr an das Versprechen, das er Aladdin gegeben hatte. Auch der Großwesir hatte die Angelegenheit längst vergessen. Daher kamen sie beide nicht auf die Idee, dass Aladdin an der Zauberei Anteil haben könne.
Aladdin ließ die drei Monate Frist, die der Sultan ursprünglich gesetzt hatte, verstreichen. Dann schickte er sogleich seine Mutter in den Palast. Sie sollte vom Sultan die Erfüllung seines Versprechens erbitten.
Im Ratssaal stellte sie sich so wie früher dem Sultan gegenüber auf. Kaum hatte er sie erblickt, da erinnerte er sich schon an sein Versprechen.
"Da ist ja die Frau wieder", sagte er zum Großwesir, "die uns vor einigen Monaten das schöne Geschenk gebracht hat. Bring sie gleich zu mir. Deinen Bericht kannst du später fortsetzen."
Der Großwesir führte die Frau vor den Sultan. Aladdins Mutter warf sich vor den Stufen des Thrones nieder. Sie wünschte dem Sultan Macht, Glück und langes Leben. Als sie sich wieder erhoben hatte, fragte der Sultan nach ihren Wünschen.
"Großmächtiger König", antwortete sie, "die drei Monate sind um. Nach dieser Frist wolltet Ihr Euer Versprechen einlösen. Ich komme nun abermals im Namen meines Sohnes Aladdin vor Euren Thron. Und ich bitte Euch, Eure Tochter Badrulbudur mit meinem Sohne zu vermählen."
Der Sultan hatte gehofft, dass nach drei Monaten von einer Ehe mit diesem Aladdin keine Rede mehr sein würde. Er sah ja, dass die Mutter Aladdins dem niedersten Volke angehörte. Also hielt er eine Verbindung seiner Tochter mit dem Sohn dieser Frau nicht für angemessen. Ratlos blickte er jetzt den Großwesir an.
"Was meinst du?" fragte er ihn. "Ich habe dieser Frau mein Wort gegeben. Aber jeder kann sehen, dass es arme Leute sind. Sie passen nicht in die Kreise der Vornehmen. Außerdem kenne ich den Sohn dieser Frau gar nicht."
Der Großwesir hatte das Unglück seines Sohnes noch nicht überwunden. Er gönnte die Prinzessin keinem anderen. Am allerwenigsten aber sollte sie dieser armselige Bursche aus dem untersten Volk besitzen. Er zögerte nicht, seinem Herrn seine Meinung zu sagen.
"Herr", entgegnete er, "es gibt ein Mittel, diesen Fremdling von uns fernzuhalten. Ihr könnt Eure Tochter nicht einem Kerl geben, von dem man nicht weiß, wer er ist. Aladdin selbst wird sich darüber nicht beklagen dürfen. Ihr braucht nur einen sehr hohen Preis für die Prinzessin festzusetzen. Dazu werden seine Reichtümer nicht ausreichen. Das wird ein gutes Mittel sein, ihn von seiner frechen Bewerbung abzubringen."
Der Sultan billigte den Rat des Großwesirs. Aber er dachte noch eine Weile darüber nach.
"Gute Frau", sagte er dann, "bringe deinem Sohn folgende Botschaft: Ich werde mein Versprechen halten; er soll meine Tochter zur Frau bekommen. Aber er muss eine entsprechende Brautgabe beschaffen. Ich verlange von ihm vierzig große Becken aus gediegenem Gold. Sie sollen von oben bis unten mit solchen kostbaren Edelsteinen angefüllt sein, wie du mir schon einmal gebracht hast. Ferner verlange ich vierzig schwarze Sklaven, die sie tragen. Und vierzig junge weiße Sklaven, von schönstem Wuchs und prächtiger Kleidung, sollen sie begleiten. Wenn dein Sohn diese Bedingungen erfüllte, werde ich gern bereit sein, ihn mit meiner Tochter zu vermählen."
Aladdins Mutter bezeigte dem Sultan ihre Verehrung. Dann machte sie sich auf den Heimweg. Unterwegs zerbrach sie sich den Kopf, wo Aladdin all diese Schätze hernehmen sollte. Die Edelsteine könnte er vielleicht in der Schatzhöhle von den Bäumen pflücken. Aber die vielen Sklaven, wo sollte er die hernehmen! Und sie glaubte, dass Aladdin nun von seinem Ziele weiter denn je entfernt sei. Unter diesen Gedanken war sie zu Hause angelangt.
"Mein Sohn", sagte sie zu Aladdin, "denk nicht mehr an eine Ehe mit der Prinzessin Badrulbudur. Ich kam in den Palast und wurde zum Sultan gerufen; und ich erinnerte ihn an sein Versprechen. Da unter hielt er sich eine ganze Weile leise mit dem Großwesir. Dieser ist sicher dein Feind. Er hat den Sultan nämlich auf den Gedanken gebracht, dir unerfüllbare Bedingungen zu stellen. Du sollst sogleich hören, wie sie lauten."
Nun erzählte sie ihm ausführlich, was der Sultan als Brautgabe für die Prinzessin wünsche.
"Mein Sohn", sagte sie abschließend, "der Sultan erwartet deine Antwort. Ich glaube, er wird lange warten müssen."
Aber Aladdin sagte lächelnd: "Nicht so lange, Mutter, wie du viel leicht glaubst. Der Sultan irrt. Seine Forderungen sind nicht so unerfüllbar, wie er meint. Ich dachte, er würde einen weit höheren Preis für die Prinzessin verlangen. Was er fordert, ist für mich eine Kleinigkeit. Ich würde noch tausendmal mehr geben, um die Prinzessin zu besitzen. Geh jetzt, besorg ein Mittagessen und laß mich nur machen!"
Die Mutter ging also einkaufen. Aladdin aber holte die Lampe und rieb sie. Sogleich erschien der Geist und bot seine Dienste an.
Aladdin sprach: "Der Sultan ist bereit, mir seine Tochter zur Frau zu geben. Nur verlangt er vorher von mir vierzig schwere Becken aus gediegenem Gold. Sie sollen bis zum Rand mit solchen Früchten gefüllt sein, wie ich sie im Garten der Höhle pflückte. Vierzig schwarze Sklaven sollen diese Becken tragen. Ebenso viele weiße Sklaven in prächtigen Gewändern sollen sie begleiten. Geh und bring mir alles sofort! Noch ehe die Sitzung zu Ende ist, will ich die Sklaven in den Ratssaal senden!"
"Ich höre und gehorche, mein Gebieter", entgegnete der Geist und verschwand.
Schon nach kurzer Zeit stand er wieder vor Aladdin. Vierzig schwarze Sklaven begleiteten ihn. Jeder von ihnen trug ein schweres Becken von gediegenem Gold auf dem Kopf, und jedes war mit Diamanten, Rubinen, Smaragden und Perlen von erlesener Schönheit angefüllt und mit gewirktem Goldstoff bedeckt. Im Hofe des kleinen Häuschens aber standen vierzig weiße Sklaven von prächtigem Wuchs. Sie waren mit kostbaren Gewändern angetan und sollten die Geschenkträger zum Sultan geleiten.
Der Geist sagte zu Aladdin: "Herr, hier ist alles, was du verlangst. Hast du noch weitere Befehle für mich?"
Aladdin erwiderte, dass er zufrieden sei. Da verschwand der Geist auf der Stelle.
Als Aladdins Mutter vom Markt zurückkam, wunderte sie sich außer ordentlich. Das ganze Haus und der Garten waren voll von schwarzen und weißen Sklaven. Da bemerkte sie die Kostbarkeiten. Nun wusste sie, dass alles der Lampe zu danken war. Gott erhalte sie meinem Sohne immerdar, dachte sie. Sie stellte die Lebensmittel weg und wollte den Schleier ablegen. Der Sohn aber hinderte sie daran.
"Liebe Mutter", sagte er, "wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich will, dass du die Morgengabe sogleich zum Sultan in den Palast bringst. Noch bevor er die Ratsversammlung schließt, sollen seine Forderungen erfüllt sein. Aus meiner Eile soll er erkennen, wie sehr mir an dieser Verbindung mit seiner Tochter gelegen ist."
Ohne eine Antwort der Mutter abzuwarten, öffnete er die Türen weit. Paarweise schritten die Sklaven aus Haus und Garten auf die Straße. Jeder schwarze Sklave, der ein goldenes Becken auf dem Kopf trug, war von einem weißen begleitet. Als die Mutter hinter dem letzten Sklaven das Haus verlassen hatte, verschloss Aladdin die Tür. Ruhig setzte er sich auf das Sofa. Nach diesem Geschenk konnte ihm der Sultan seine Tochter nicht versagen.
Als die achtzig Sklaven zum Sultanspalast zogen, blieben alle Leute stehen und bewunderten das herrliche Schauspiel. Von allen Seiten strömte das Volk herbei. Es bewunderte die kostbar gekleideten Sklaven, und es erfreute sich am Glanz der Steine, die an ihren Gürteln und Turbanen im Sonnenlicht erstrahlten. Der feierliche Zug erregte überall Aufsehen und Bewunderung. Das Gedränge wurde schließlich so groß, dass sich niemand mehr vom Platz rühren konnte.
Endlich langte der erste der achtzig Sklaven am Tor des Palastes an. Die Pförtner hielten ihn für einen König und wollten ihm den Saum des Kleides küssen. Doch der Sklave hielt sie zurück.
"Wir sind nur Sklaven", sprach er feierlich. "Unser Herr wird erscheinen, wenn es an der Zeit ist."
Dann schritten sie in den Schlosshof hinein. Dort war der Hofstaat des Sutans, der an der Sitzung nicht teilnahm, aufgestellt. Man sah prunkvolle Gewänder und herrlichen Schmuck. Aber alles verblich vor dem Glanz, der von den fremden Sklaven ausstrahlte.
Der Sultan hatte bereits von der Ankunft der Sklaven erfahren. Er befahl, sie in den Ratssaal vor seinen Thron zu führen. In schönster Ordnung betraten sie den Saal. Vor dem Thron des Herrschers bildeten sie einen Halbkreis. Nachdem sie die Becken vor sich auf den Teppich gestellt hatten, warfen sie sich zu Boden. Mit der Stirn berührten sie den Teppich und erwiesen dem Sultan ihre Ehrerbietung. Zu gleicher Zeit standen sie alle wieder auf und enthüllten die Becken. Dann blieben sie mit gekreuzten Armen in ehrfürchtiger Haltung stehen.
Indessen nahte Aladdins Mutter dem Thron. Demütig warf sie sich zu Füßen des Sultans.
"Erhabener Herr", sagte sie, "mein Sohn schätzt die Prinzessin über alles. Er schätzt sie weit höher, als er mit diesem Geschenk bezeigen kann. Doch hofft er, dass Ihr es huldvoll entgegennehmen werdet. Es soll die Bedingungen erfüllen, die Ihr ihm vorgeschrieben habt."
Der Sultan war von der Kostbarkeit und der Pracht der Geschenke überwältigt und geblendet von der Schönheit und dem Glanz der Edelsteine. Vor Staunen verstand er nicht einmal die Begrüßungsworte der Mutter Aladdins. Woher konnte der Reichtum in dieser kurzen Spanne Zeit gekommen sein? Es war knapp eine Stunde vergangen, seit er seine Bedingungen gestellt hatte.
"Was sagst du nun, Wesir?" fragte er seinen Berater. "Ist dieser Mann nicht wert, meine Tochter zu heiraten?"
Der Großwesir war von der Pracht der Geschenke noch mehr überrascht als sein Herr. Neid und Eifersucht fraßen an ihm. Ein Fremder sollte nun seinem Sohn den Rang ablaufen und Schwiegersohn des Sultans werden. Am liebsten hätte er die Vermählung der Prinzessin mit Aladdin abermals hintertrieben. Aber er wagte nicht, seine wahre Gesinnung zu äußern.
"Herr", antwortete er dem Sultan, "es gibt keine Kostbarkeiten, die den Wert Eurer Tochter aufwiegen könnten. Aber dieser Mann hat ein kostbares Geschenk gesandt. Daher muss man ihn der Ehre, Euer Schwiegersohn zu werden, für würdig erachten."
Auch die übrigen Herren des Gefolges gaben ihre Zustimmung durch lauten Beifall zu erkennen.
Der Sultan verschob jetzt die Sache nicht länger. Er erkundigte sich nicht einmal, ob sein künftiger Schwiegersohn einer so hohen Stellung gewachsen sei. Der Anblick der gewaltigen Reichtümer war ihm Beweis genug. Er war überzeugt, dass er einen untadeligen Mann vor sich habe. Daher wandte er sich nun an Aladdins Mutter.
"Gute Frau", sagte er, "geh jetzt zu deinem Sohn und sag ihm, dass ich die Morgengabe angenommen habe. Ich stimme der Vermählung meiner Tochter mit ihm zu! Weiter sag ihm, dass ich ihn erwarte. Er wird von mir mit offenen Armen empfangen werden. Noch heute Abend soll die Hochzeit sein."
Da eilte die Mutter freudestrahlend nach Hause zurück, um ihrem Sohn die frohe Botschaft zu überbringen. Der Sultan aber befahl, die Ratsversammlung zu schließen. Dann ließ er die Diener der Prinzessin kommen. Er ordnete an, dass sie die goldenen Gefäße zu seiner Tochter bringen sollten. Sogleich befolgten sie seinen Befehl.
Die achtzig weißen und schwarzen Sklaven mussten sich ins Innere des Palastes begeben. In langer Reihe stellten sie sich vor den Zimmern der Prinzessin auf.. Der Sultan hatte seiner Tochter bereits von ihrer Schönheit und von dem Prunk der Gewänder erzählt. Nun war sie neugierig und wollte sich selbst davon überzeugen. Sie war vom Glanz der Steine entzückt und freute sich über die prächtigen Sklaven; und ihr Vater freute sich mit ihr. Endlich blickte sie wieder heiter in die Welt.
"Liebe Tochter", rief er aus, "ich glaube, dein neuer Gemahl wird dir besser gefallen als der Sohn des Wesirs. Ich flehe zu Gott, dass du viel Freude mit ihm erleben mögest."
Inzwischen war Aladdins Mutter glückstrahlend nach Hause gekommen. Die Freude über die gute Nachricht war deutlich an ihrer Miene abzulesen.
"Mein Sohn", rief sie, "freue dich, du bist am Ziel deiner Wünsche! Der Sultan hat erklärt, dass du würdig seist, der Gatte seiner Tochter zu werden. Dein Geschenk hat er angenommen. Du bist ihm willkommen, und nun erwartet er dich mit Ungeduld. Noch heute soll die Hochzeit sein. Bereite dich auf die Zusammenkunft vor! Du hast schon so viele Wunder vollbracht, dass mir nun nicht mehr bange ist."
Aladdin küsste seiner Mutter die Hand und dankte ihr von Herzen. Dann ging er in die Kammer und rieb an der Lampe. Sogleich stand der Geist vor ihm.
"Ich bin dein Diener", sprach er. "Was wünschest du?"
"Geist", erwiderte Aladdin, "bereite mir sofort ein wohlriechendes Bad. Weiter wünsche ich, dass du mir Kleider besorgst. Sie sollen so reich und prächtig sein, wie sie noch kein König getragen hat."
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, machte der Geist ihn unsichtbar. Er trug Aladdin in ein herrliches Bad, wie es noch kein König gesehen hatte. Es war aus feinstem, buntgestreiftem Marmor erbaut. Köstliche Gemälde schmückten die Wände. Eine Halle war ganz mit Edelsteinen ausgelegt. Hier wurde er entkleidet; aber er sah nicht, wer ihn bediente. Dann führte man ihn in den Baderaum. Dort wurde er mit wohlriechenden Essenzen und Wassern gewaschen. Nach dem Bade fühlte er sich wie ein anderer Mensch. Seine Gesichtsfarbe war rosig und die Haut frisch und weich.
Sodann betrat Aladdin wieder die Halle, in der er die Kleider abgelegt hatte. Aber er fand sie nicht mehr vor; an ihrer Stelle hatte der Geist ein kostbares Gewand hingelegt. Aladdin schien es, etwas Herrlicheres könne es nicht geben. Er kleidete sich mit Hilfe des Geistes an und bewunderte jedes einzelne Stück. Als er fertig war, trug ihn der Geist in seine Kammer zurück. Dort fragte er ihn, ob er noch etwas wünsche.
"Ja", erwiderte Aladdin, "ich möchte, dass du mit auf der Steile ein Pferd herbeiführst. Seine Schönheit und seine Schnelligkeit dürfen von keinem Pferd des Sultans übertroffen werden. Sattel und Zaumzeug müssen zehntausend Goldstücke wert sein. Dann verschaffe mir zwanzig Sklaven. Sie sollen so kostbar gekleidet sein wie die Diener, die ich dem Sultan sandte. Ich brauche sie als mein Gefolge. Ferner schicke noch zwanzig andere, die in zwei Reihen vor mir herziehen sollen. Auch meiner Mutter bring sechs Sklavinnen zu ihrer Bedienung. Sie müssen mindestens so schön gekleidet sein wie die Sklavinnen der Prinzessin Badrulbudur. Jede von ihnen soll ein kostbares Gewand mitbringen, so prächtig, als gehöre es für die Sultanin. Schließlich benötige ich zehn Beutel mit je tausend Goldstücken. Das ist alles, was ich noch brauche. Geh und schaff es eiligst herbei!"
Der Geist verschwand und kam nach kurzer Zeit wieder. Er führte einen prächtigen arabischen Hengst mit kostbarem Sattelzeug. Hinter ihm folgten die vierzig Sklaven. Jeder vierte trug einen Beutel mit Goldstücken. Die sechs Sklavinnen waren mit herrlichen Gewändern beladen; sie alle waren für Aladdins Mutter bestimmt. Von den zehn Beuteln mit Gold ließ Aladdin den Sklaven nur sechs; die übrigen vier gab er seiner Mutter für den Notfall. Aus den sechs Beuteln sollten die Sklaven auf dem Wege zum Palast Gold unter das Volk streuen. Drei von ihnen hatten rechts, drei links vor ihm zu gehen. Seiner Mutter aber übergab er die sechs Sklavinnen mit den prächtigen Gewändern.
Hierauf entließ er den Geist. Einen der Sklaven sandte er in den Palast des Sultans. Durch ihn ließ er anfragen, ob sein Besuch genehm sei. Der Sklave machte sich im Laufschritt auf den Weg. Bald kehrte er mit der Meldung zurück, der Sultan erwarte ihn mit Ungeduld.
Nun schwang sich Aladdin auf sein Pferd. Die Sklaven stellten sich in der anbefohlenen Ordnung auf. Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Er bot einen prächtigen Anblick. Aladdin saß in stolzer Haltung zu Pferd. Niemand hätte erkannt, dass er noch nie ein Pferd geritten hatte. Die Straßen waren im Nu von einer staunenden Volksmenge erfüllt. Beifalls- und Segensrufe ertönten, besonders wenn es rechts und links Goldmünzen regnete. Aber nicht nur der Pöbel drängte sich heran. Auch ehrsame Bürgersleute blieben stehen und winkten Aladdin Beifall, als sie seine Freigebigkeit sahen. Viele erkannten ihn kaum, so sehr hatten sich seine Gesichtszüge verändert. Er strahlte eine Würde und Schönheit aus, als wäre er ein anderer geworden. Dies alles hatte er der Wunderlampe zu danken. Denn dieses unscheinbare Ding konnte jedem Stand und Würde verleihen.
Als Aladdin am Tor des Palastes eintraf wollte er der Sitte gemäß vom Pferde steigen. Aber einer der Würdenträger des Sultans hinderte ihn daran.
"Mein Herr", sagte er, "der Sultan hat befohlen, dass Ihr zu Pferde inzieht. Erst bei der Pforte des Staatssaales sollt Ihr absteigen."
Die Würdenträger gingen alle vor ihm her. Als er dann vom Pferd steigen wollte, hielten sie trotz seines Sträubens die Steigbügel und halfen ihm vom Pferd. Dann schritten sie ihm voran in den Saal. Sie bildeten rechts und links ein Ehrenspalier, während ihn zwei vor die Stufen des Thrones führten.
Als der Sultan Aladdin erblickte, war er überrascht. Eine so königliche Kleidung und würdevolle Haltung hatte er nicht erwartet. Der armselige Aufzug seine'r Mutter war ihm noch allzugut in Erinnerung. Nun erhob er sich vom Thron und ging Aladdin einige Schritte entgegen. Er gestattete nicht, dass sich dieser zu Boden warf. Stattdessen umarmte er ihn herzlich. Dann führte er ihn die Stufen empor. Er hieß ihn an seiner Seite neben dem Großwesir Platz nehmen.
Aladdin sprach Segenswünsche und flehte den Schutz des Himmels über den Herrscher herab.
"Erhabener Herr", fuhr er fort, "Ihr habt mir die Hand Eurer Tochter bewilligt. Und doch bin ich einer Eurer niedrigsten Diener. Verzeiht, dass ich wagte, meine Augen zur Prinzessin zu erheben. Aber die Liebe zu ihr war zu mächtig. Ich wäre gestorben, hättet Ihr sie mir versagt."
"Mein Sohn", antwortete der Sultan, "ich habe versprochen, sie dir zu vermählen. Und ich bereue nicht, mein Wort gehalten zu haben."
Nach diesen Worten gab er ein Zeichen und Musik setzte mit vollen Tönen ein. Gleichzeitig führte der Sultan ihn in einen prunkvollen Saal.
Dort wurde ein köstliches Festmahl aufgetragen. Der Sultan speiste mit Aladdin allein. Während der Unterhaltung bewies Aladdin so viel Verstand, dass der Sultan in seiner guten Meinung noch bestärkt wurde. Nach dem Mahle ließ der Sultan den obersten Richter seiner Hauptstadt rufen und gab ihm den Befehl, sogleich den Ehevertrag zwischen der Prinzessin Badrulbudur und Aladdin zu schließen. Inzwischen unterhielt er sich weiter mit Aladdin in Gegenwart vieler hoher Herren vom Hofe. Wieder Freute er sich über den gründlichen Verstand des Jünglings und bewunderte die Feinheit und Höflichkeit seiner Reden.
Als der Richter den Ehevertrag vollendet hatte, wollte Aladdin sich erheben und fortgehen. Aber der Sultan hielt ihn zurück. Er fragte. ob er nicht heute noch Hochzeit feiern wolle.
"Herr", erwiderte Aladdin, "meine Sehnsucht nach der Prinzessin ist groß. Trotzdem bitte ich Euch um eine kurze Frist. ich will der Prinzessin einen Palast erbauen, der ihrem Rang und ihrer Würde angemessen ist. Dazu erbitte ich mir einen Platz in der Nähe Eures Schlosses. Dann kann ich Euch recht oft meine Aufwartung machen. Der Bau wird in Kürze vollendet sein.
"Mein Sohn", sagte der Sultan, ,such dir eine Stelle aus, die dir gefällt. Der weite Platz hier, meinem Palaste gegenüber, ist für deinen Plan wie geschaffen. Doch beeile dich: Ich möchte dich möglichst bald mit meiner Tochter vermählt sehen."
Nach diesen Worten umarmte der Sultan den jungen Mann. Aladdin verabschiedete sich so formvollendet vom Herrscher, als habe er hier bei Hofe seine Erziehung genossen.
Vor dem Tor stieg er zu Pferd. Im gleichen Aufzug, wie er gekommen war, ritt er nach Hause zurück. Wieder jubelten ihm die Menschen zu und wünschten ihm Glück und Segen. Kaum war er vom Pferde gestiegen, begab er sich in seine Kammer, um mit Hilfe der Lampe den Geist herbeizurufen. Und schon stand dieser vor ihm und bot seine Dienste an.
"Geist", sagte Aladdin, "ich bin mit deinen Diensten bisher zufrieden gewesen. Du hast alle meine Befehle rasch und pünktlich ausgeführt. Heute aber sollst du mir einen besonders wichtigen Dienst erweisen, der noch mehr Sorgfalt und Eifer von dir verlangt. Errichte auf dem freien Platz vor dem Sultansgebäude einen Palast. Er soll ein würdiger Aufenthalt für die Prinzessin Badrulbudur, meine Gemahlin, sein. Die Wahl des Baumaterials und der Einrichtung überlasse ich dir. Doch wünsche ich, dass du auch einen großen Kuppelsaal baust; die Wände müssen mit Gold und Silber ausgelegt sein, und der Saal soll auf jeder Seite sechs Fenster haben; die Gitter schmücke mit Diamanten, Rubinen und Smaragden. Achte darauf, dass die Steine von einer Herrlichkeit und Pracht sind, wie man dergleichen noch nie auf der Welt gesehen hat. Ein Fenster jedoch soll unvergittert bleiben. Ferner wünsche ich, dass sich bei diesem Palast ein Hof, ein Vorhof und ein Garten befinden. Vor allem aber soll auch eine Schatzkammer im Schlosse sein mit einem großen Vorrat an Gold, Silber und Edelsteinen. Speisesäle, Küchen, Vorratshallen mit allem Nötigen dürfen nicht fehlen. Richte mir Stallungen voll der schönsten und feurigsten Pferde ein. Sorge auch dafür, dass Diener und Sklavinnen für den Dienst bei der Prinzessin bereit stehen. Du wirst jetzt begreifen, wie ich es haben will. Geh nun und komm wieder, wenn alles fertig ist!"
Es war bereits Abend, als Aladdin den Geist entließ. Aber die Liebe zur Prinzessin ließ ihn keinen Schlaf finden. Darum erhob er sich zeitig vom Lager. Kaum war er aufgestanden, erschien auch schon der Diener der Lampe.
"Herr", sagte der Geist, "dein Palast ist fertig. Wenn du ihn sehen willst, komm mit mir. Sage mir dann, ob du zufrieden bist!"
Und er nahm den Jüngling und trug ihn zu dem neuerbauten Palast.
Aladdin fand alles über Erwarten gelungen und freute sich über den herrlichen Bau, Der Geist führte ihn im ganzen Schloss herum, er zeigte ihm alle Räume; und überall fand Aladdin Reichtum, Schönheit und Pracht. Diener und Sklaven sah er, alle reich und sauber gekleidet. Sodann zeigte ihm der Geist die Schatzkammer. Sie war bis zum Gewölbe mit Gold- und Silbersachen, gemünztem Gold und Edelsteinen angefüllt. Bei diesem Anblick lachte Aladdin das Herz im Leibe. In der Küche waren die Köche eifrig am Werk, jeder mit goldenem und silbernem Küchengerät ausgerüstet. Die Schränke waren mit den herrlichsten Gewändern und Stoffen angefüllt. Hierauf führte ihn der Geist in die Ställe. Dort zeigte er ihm die schönsten Pferde der Welt. Stallmeister und Stallknechte waren eifrig mit der Wartung dieser kostbaren Tiere beschäftigt. Dann durchschritten sie die Vorratshallen. Diese warteten wohlgefüllt auf ihre Herrin. Das Wunderbarste in dem Schloss aber war der Kuppelsaal mit den vierundzwanzig Fenstern, deren Gitter ringsum mit blitzenden Edelsteinen ausgelegt waren.
Nachdem Aladdin die Pracht des Palastes bewundert hatte, wandte er sich an den Geist.
"Ich wünsche noch etwas von dir", sprach er. "Ich habe es dir zu sagen vergessen: Ein großer, golddurchwirkter Teppich von allerschönstem Samt soll vom Tor des Sultanspalastes bis hierher zum Zimmer der Prinzessin führen. Darauf soll die Prinzessin einherschreiten. Ihr Fuß darf den Boden nicht berühren und an keinen Stein stoßen."
Der Geist verschwand, erschien aber im nächsten Augenblick wieder und sagte: "Dein Wunsch ist erfüllt."
Da sah Aladdin zu seinem Erstaunen den gewünschten Teppich bereits ausgebreitet. Nun trug der Geist Aladdin in sein Haus zurück.
Der Morgen graute, und man öffnete das Tor des Sultanspalastes. Die Pförtner wollten ihren Augen nicht trauen. Auf der weiten Fläche vor dem Palast erstreckte sich ein prunkvolles Gebäude. Ein wunderschöner Teppich führte zu ihm hinüber. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Neuigkeit im Palast.
Da erwachte auch der Sultan aus dem Schlafe. Er erhob sich vom Lager und öffnete das Fenster. Als er hinausblickte, glaubte er zu träumen. Vor ihm stand ein herrlicher Bau mit mächtiger Kuppel. Und ein prunkvoller Teppich verband seinen Palast mit dem neuen Schloss. Da kam auch schon der Wesir. Er war nicht weniger verwundert als der Sultan, aber er versuchte, das Wunder als ein Werk der Zauberei hinzustellen. Denn kein Mensch auf der Welt könne in einer einzigen Nacht ein solches Bauwerk aufführen.
"Wesir", antwortete der Sultan, "warum sprichst du von Zauberei? Du weißt, dass der künftige Gemahl meiner Tochter hier einen Palast erbauen wollte. Bei den reichen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, scheint mir das nicht befremdend. Nut Geld kann man Wunder wirken. Ich glaube, du bist es ihm neidig, deshalb sprichst du Schlechtes von ihm."
Als Aladdin nach Hause kam, legte seine Mutter gerade eines der prächtigen Kleider an. Er bat sie, sich in Begleitung der Sklavinnen in den Sultanspalast zu begeben. Der Sultan solle ihr die Erlaubnis geben, die Prinzessin am Abend in ihren neuen Palast zu geleiten. Die Mutter tat nach dem Wunsch des Sohnes, und als sie wie eine Sultanin gekleidet mit ihren Sklavinnen zum Palast schritt, blieben wieder alle Leute stehen. Aber die Volksmenge war weitaus geringer als am Vortag. Die Frauen waren ja verschleiert und streuten keine Münzen.
Aladdin aber verließ seine Wohnung, um nicht mehr dorthin zurückzukehren. Seine Wunderlampe vergaß er nicht, er nahm sie mit sich, bat aber vorher den Geist nochmals um zehntausend Goldstücke. Diese streuten seine Sklaven wieder unter die jubelnde Menge, während sie zum Palast zogen.
Aladdins Mutter wurde vom Sultan mit allen Ehren empfangen. Er führte sie sogleich in die Gemächer der Prinzessin. Die Prinzessin nahm sie herzlich auf und ließ sie mit köstlichen Speisen bewirten. Sie selbst ließ sich unterdessen von ihren Frauen ankleiden. Als Schmuck legte sie die kostbaren Juwelen aus Aladdins Geschenk an. Dann kam der Sultan in das Zimmer seiner Tochter, er wollte noch einmal mit ihr beisammen sein, ehe sie ihren neuen Palast bezog. Zu Aladdins Mutter war er überaus freundlich. Ihr stattliches Aussehen und ihre kostbaren Gewänder setzten ihn in Verwunderung.
Am Abend verabschiedete sich die Prinzessin unter Tränen von ihrem Vater. Sie umarmten einander immer wieder, bis der Sultan endlich den Befehl gab, seine Tochter zum Schloss ihres Gemahls zu geleiten. Sogleich bestiegen die Würdenträger des Reiches ihre Pferde; sie ritten zu beiden Seiten der Prinzessin. Die Musikchöre gingen an der Spitze des Zuges und spielten fröhliche Weisen. Ihnen folgten die Krieger, hierauf die Diener und Sklaven. Edelknaben mit Fackeln in den Händen gingen zu beiden Seiten des Zuges. Aladdins Mutter hielt sich zur Linken der Braut inmitten des Ehrengeleites. Hundert Sklavinnen in der prachtvollsten Kleidung bildeten den Abschluss des Zuges.
Mit diesem Gefolge schritt die Prinzessin über den Teppich zum Palaste Aladdins. Von dorther klang ihnen Musik entgegen; diese vermischte sich mit den Weisen der voranmarschierenden Musikchöre zu vollkommenem Wohlklang. Das Volk wusste nicht, worüber es mehr staunen sollte: über diesen Aufzug oder über den prachtvollen Palast, von dem am Vortag noch kein Stein gestanden hatte.
Endlich war die Prinzessin bei dem neuen Schloss angelangt. Aladdin wartete am Eingang der Gemächer, um sie zu empfangen. Die Prinzessin erkannte ihn inmitten seines prachtvollen Gefolges sofort als ihren Gatten, denn seine Schönheit und Würde überstrahlten alle Umstehenden.
"Teuerste Prinzessin", sprach Aladdin sie an und verneigte sich ehrerbietig, "verzeiht, dass ich es wagte, Euch zur Frau zu begehren. Aber Eure Schönheit hat mich bezwungen. Ohne Euch hätte ich nicht weiterleben können."
"Mein Prinz", antwortete die Prinzessin, "ich gehorche dem Wunsche meines Vaters. Jetzt, da ich Euch kenne, tu ich es gern und ohne Widerstreben."
Aladdin ergriff ihre Hand und küsste sie zärtlich. Dann führte er die Prinzessin in einen großen, hellerleuchteten Saal zur Festtafel. Man aß aus goldenen Schüsseln und trank aus goldenen Bechern. Auch die Tafelaufsatze und Vasen waren aus gediegenem Gold und mit Juwelen verziert. Der ganze Saal funkelte von Pracht und Herrlichkeit.
Kaum hatte man sich zu Tisch gesetzt, begann ein wundersamer, ergreifender Gesang. Die Prinzessin war wie verzaubert und dachte bei sich, dass sie nie zuvor schönere Weisen gehört habe. Sie wusste nicht, dass die Sängerinnen Feen waren, die der Geist zu ihrem Hochzeitsmahl bestellt hatte.
Nach dem Abendessen traten Tänzer und Tänzerinnen auf. Sie tanzten die schönsten Volkstänze des Landes und erfreuten die Zuschauer durch nie gesehene Anmut und Gewandtheit der Bewegungen Schließlich aber tanzte Aladdin mit der Prinzessin. Und sie tanzten so schön, dass die ganze Gesellschaft in Beifallsrufe ausbrach. Damit schloss die Hochzeitsfeier. Nun nahm Aladdin seine Braut an der Hand und führte sie in ihre Gemächer. Die Gäste aber verließen den Palast
Am nächsten Morgen brachten die Kammerdiener Aladdin ein neues prächtiges Gewand und halfen ihm, sich anzukleiden. Hierauf ließ er sich eines seiner edlen Reitpferde vorführen. Hoch zu Roß begab er sich mit zahlreichem Gefolge zum Palast des Sultans. Als er den Thronsaal betrat, eilte ihm der Sultan entgegen und umarmte und küsste ihn herzlich. Dann bat er ihn, sich an seine Seite zu setzen. Gemeinsam nahmen sie das Frühstück zu sich. Nun wandte sich Aladdin an den Sultan.
"Herr", sprach er, "ich habe eine Bitte an Euch. Erweist mir die Ehre, mit dem Wesir und den Großen des Hofes das Mahl im Palast der Prinzessin einzunehmen."
Erfreut sagte der Sultan zu und begab sich sogleich mit Aladdin und den Herren des Gefolges zu dem Palast der Prinzessin.
Als der Sultan den Wunderbau betrat, stieg sein Erstaunen ins Ungemessene. Ein Zimmer übertraf das andere an Schönheit und Pracht. In dem großen Kuppelsaal konnte er seine Verwunderung nicht länger verbergen; vor allem die vierundzwanzig Fenster mit den kostbaren, edelsteinbesetzten Gittern schienen ihm unvergleichlich. Er staunte und starrte. Plötzlich bemerkte er überrascht, dass eines der Fenster unvollendet geblieben war.
"Wesir", sagte er zu seinem obersten Minister, "weißt du, warum dieses eine Fenster nicht fertig ist?"
"Herr", erwiderte der Großwesir, "gewiss ist Aladdin die Zeit zu kurz geworden. Er wird bestimmt daran weiterarbeiten lassen. Edelsteine hat er ja in Hülle und Fülle."
Inzwischen hatte Aladdin seiner Gemahlin die Ankunft des Vaters mitgeteilt. Nun kam er gerade zurück zum Sultan.
"Mein Sohn", sagte dieser, "dieses Schloss mit seinen prächtigen Räumen ist ein Wunderbau. Der große Saal aber mit der Kuppel ist das Prächtigste, was ich je gesehen habe. Sag mir nur das eine: Warum ist dieses Gitterfenster hier unvollendet geblieben? Hat man darauf vergessen? War es Nachlässigkeit der Handwerker? Oder hat die Zeit nicht mehr ausgereicht, an das herrliche Werk letzte Hand anzulegen?"
"Herr", erwiderte Aladdin, "keiner dieser Gründe trifft zu. Dieses Fenster wurde mit Absicht nicht fertig gemacht. Denn Euch allein gebührt der Ruhm, diesen Saal und Palast vollenden zu lassen. Und ich bitte Euch, diesen Wunsch zu erfüllen."
"Ich weiß dir Dank für deine edle Absicht", sagte der Sultan. "Ich will dieses Fenster vollenden. Sogleich sollen die notwendigen Befehle ergehen." Und er ließ Juweliere und Goldschmiede rufen.
Unter diesen Gesprächen war die Zeit zum Mahle gekommen. Aladdin führte den Sultan in den großen Saal, wo die Hochzeitsfeier stattgefunden hatte. Hier waren zwei Tafeln gedeckt. An der einen nahm der Sultan mit seiner Tochter und Aladdin Platz. An der andern wurden der Großwesir und alle übrigen Gäste bewirtet. Beide Tafeln erglänzten von Gold und Edelsteinen. Geschirr und Tafelaufsätze waren von gediegener Goldschmiedearbeit. Es gab die erlesensten Speisen und Getränke. Schließlich erklärte der Sultan, er habe noch nie so gut gespeist. Achtzig Sklavinnen' schön wie Vollmondschein, bedienten die hohen Gäste. Liebliche Weisen ertönten und ließen jeden Kummer vergessen. Und der Sultan war heiter und wohlgelaunt. Er meinte, es sei dies eine der schönsten Stunden seines Lebens.
Als man vom Tisch ging, waren die Juweliere und Goldschmiede bereits versammelt. Der Sultan hieß sie in den großen Kuppelsaal mitkommen. Dort zeigte er ihnen die dreiundzwanzig Fenster, besonders aber die kostbare Vergitterung mit dem Edelsteinschmuck. Dann wies er auf das unvollendete Fenster hin.
"Ich habe euch rufen lassen«, sagte er, "damit ihr mir dieses Fenster vollendet. Es soll ebenso schön und kunstvoll werden wie die andern. Tut euer Möglichstes, um eine ebenso prächtige Arbeit zu liefern. Aber verliert keine Zeit!"
Die Juweliere und Goldschmiede betrachteten nochmals eingehend Arbeit und Schmuck an den dreiundzwanzig Fenstern. Sie beratschlagten über das Material, das ihnen zur Verfügung stand. Dann waren sie sich einig, dass keiner von ihnen die Arbeit durchführen konnte. So auserlesene Steine besaßen sie nicht. Sie meldeten das Ergebnis ihrer Beratung dem Sultan.
"Herr", sagte einer der Juweliere, "trotz aller Kunstfertigkeit können wir eine so vollendete Arbeit nicht liefern. Wir haben alle mitsammen weder so viele noch so großartige Edelsteine, um Euren Wunsch zu erfüllen."
"So kommt mit in meinen Palast", sagte der Sultan. "Sucht euch aus meinem Edelsteinschatz aus, was ihr braucht!"
Die Juweliere gingen nun in den Sultanspalast. Dort wählten sie aus den vorgelegten Steinen die größten und schönsten aus. Sie nahmen vor allem jene Steine, die Aladdin dem Sultan geschenkt hatte. Doch waren es immer noch nicht genug. Der Sultan befahl, auch die Juwelen des Großwesirs und der Vornehmsten des Reiches zu nehmen. Aber nach Verlauf eines Monats war kaum die Hälfte des Fensters vollendet. Die Schönheit des Werkes blieb weit hinter der Pracht der andern Fenster zurück.
Eines Tages betrat Aladdin wieder den Kuppelsaal. Er wollte die Arbeit der Juweliere besichtigen. Da sah er nun, dass noch viel zur Vollendung des Fensters fehlte. Der Sultan hatte sich vergeblich bemüht, das Fenster ebenso herrlich wie die übrigen machen zu lassen. Darum befahl Aladdin den Juwelieren, die Arbeit einzustellen. Alles. was sie bisher zuwege gebracht hatten, wurde wieder auseinandergenommen. Die Edelsteine ließ er dem Sultan und dem Großwesir zurückgeben. Dann begab er sich in seine Kammer und rieb die Lampe. Sofort erschien der Geist.
"Verlange, was du willst", sagte der Diener der Lampe, "und ich werde gehorchen."
"Geist", sagte Aladdin, "vollende nun das Fenster im großen Saal, das du unfertig gelassen hast."
Der Geist verschwand. Als Aladdin nach einer Weile in den Kuppelsaal hinaufstieg, fand er das Fenster vollendet. Es glich den übrigen an Schönheit und Pracht.
Inzwischen waren die Juweliere zum Sultan gegangen, um ihm seine Edelsteine zurückzugeben und ihm zu melden, dass sie auf Wunsch Aladdins ihre ganze Arbeit vernichtet hätten. Der Sultan fragte nach dem Grund. Jedoch sie wussten ihn nicht. Da ließ der Sultan sein Pferd satteln. Nur von einigen Leuten begleitet, ritt er zum Palast Aladdins. Dort stieg er ab. Dann eilte er die Treppe zum Kuppelsaal hinauf Am Eingang des Saales traf er Aladdin.
"Mein Sohn", rief er ihn an, "ich komme, um dich selbst zu fragen. Warum mussten die Handwerker ihre Arbeit wieder vernichten?"
Aladdin konnte den wahren Grund nicht sagen. Es waren nämlich zu wenig Edelsteine vorhanden gewesen. Selbst alle Edelsteine des ganzen Landes hätten nicht zur Vollendung des Fensters gereicht.
"Herr", erwiderte er darum, "Ihr habt diesen Saal unvollendet gesehen. Aber seht jetzt einmal, ob noch etwas daran fehlt."
Der Sultan ging geradewegs auf das Fenster zu, das er unvollendet gesehen hatte. Er bemerkte, dass es ganz wie die übrigen aussehe. Also glaubte er, sich getäuscht zu haben, und ging zu den anderen Fenstern. Aber eines glich dem anderen. Und alle waren von vollendeter Schönheit. Da blickte er Aladdin an.
"Mein lieber Sohn", sagte er kopfschüttelnd, "was bist du für ein Mann! Was andere in Monaten nicht fertigbringen, vollendest du in einer Nacht. Bei Gott, niemand auf der ganzen Welt kann sich mit dir vergleichen."
Aladdin nahm die Lobsprüche des Sultans in aller Bescheidenheit entgegen. Er versicherte, stets alles tun zu wollen, um den Beifall seines Königs zu verdienen.
Nach einem kurzen Besuch bei seiner Tochter ritt der Sultan in seinen Palast zurück. Dort erwartete ihn der Großwesir. Ihm berichtete er voll Staunen, was er soeben gesehen hatte. Der Grosswesier wurde dadurch nur in seiner Meinung bestärkt, dass Aladdins Palast ein Werk der Zauberei sei. Aber der Sultan ließ ihn kaum zu Wort kommen.
"Wesir", sagte er, "du hast die Vermählung deines Sohnes mit meiner Tochter noch immer nicht vergessen. Ich sehe, der Neid frisst in deinem Innern."
Der Großwesir sah ein, dass er mit seinem Herrn über diesen Punkt nicht sprechen könne. Darum ließ er die Sache auf sich beruhen. Der Sultan aber bewunderte täglich von seinem Fenster aus den Palast Aladdins.
Aladdin verschloss sich indessen nicht in seinem Palast. Jeden Tag ritt er durch die Stadt. Und seine Sklaven warfen vor und hinter ihm Goldstücke unter das Volk. Alle priesen ihn wegen seiner Freigebigkeit. Er spendete reichlich den Armen, ja er verteilte mit eigener Hand Gaben an sie. Um seine Gebete zu verrichten, besuchte er die Moscheen. Manchmal speiste er beim Großwesir, und dieser machte auch ihm dann und wann seine Aufwartung. Häufig lud Aladdin vornehme Männer aus dem Hofstaat des Sultans zu sich, und gelegentlich beehrte auch er sie mit seinem Besuch. Er ging gern auf die Jagd und beteiligte sich an Turnierspielen. Sein Ruhm wuchs im ganzen Land von Tag zu Tag. Das Herz seiner Gattin schlug höher, wenn sie vom Fenster ihres Gemaches aus ihren Gemahl hinwegreiten sah. Sie dankte Allah, dass er ihr dies hohe Glück beschert habe.
So lebte Aladdin glücklich und hochgeehrt einige Jahre lang. Aber dann erinnerte sich eines Tages der Zauberer aus Afrika wieder an ihn. Dieser harte die ganze Zeit in Trübsal verbracht, denn alle seine Bemühungen, die Wunderlampe zu erringen, waren ja vergeblich gewesen. Er war der Meinung, Aladdin müsse in der Höhle schon längst umgekommen sein. Trotzdem verfluchte er ihn, sooft er an ihn dachte. Aber nun wollte er genau wissen, welches Ende er genommen habe. Darum nahm er seine Zaubergeräte zur Hand. Er warf Zaubersand zu Figuren und erkannte daraus, dass die Lampe nicht mehr in der Höhle war. Von Aladdin sah er nichts. Da warf er neuerlich den Sand; nun las er aus den Figuren, dass Aladdin auf Erden lebe und die Lampe besitze. Wutentbrannt sprach er zu sich:
"Ich habe so viel Leid und Mühsal ertragen, um die Lampe zu erwerben; aber alles war umsonst. Und dieser Taugenichts nimmt sie ohne Anstrengungen. Sicher hat er die Zauberkraft der Lampe erkannt und ist nun ein reicher Mann."
Abermals forschte er im Zaubersand. Da sah er, dass Aladdin reich und hochgeehrt als Gatte einer lieblichen Sultanstochter sein Leben verbringe Nun loderte sein Zorn hellauf, sein Gesicht wurde gelb vor Neid. Er überlegte nicht lange; gleich am nächsten Tag machte er sich hoch zu Roß auf die Reise. Er zog von Land zu Land von Stadt zu Stadt. Keine Mühe war ihm zu groß, und kein Aufenthalt dauerte länger, als das Pferd brauchte, um sich auszuruhen. So kam er in die Hauptstadt des Sultans, dessen Tochter Aladdin geheiratet hatte. Dort mietete er in einer Herberge ein Zimmer, um sich von den Beschwerden der Reise zu erholen.
Aber schon am nächsten Tag ging der afrikanische Zauberer in die Stadt. Er wollte herum horchen, was man von Aladdin spreche. So trat er in ein Speisehaus, das er von seiner letzten Reise her kannte. Viele Männer waren hier versammelt und tauschten Neuigkeiten aus. Während er einen Trunk schlürfte, horchte er nach links und rechts; und immer hörte er nur von Aladdins Palast reden. Als er ausgetrunken hatte, wandte er sich an einen dieser Männer und fragte ihn, was denn das für ein wunderbarer Palast sei, von dem alle redeten.
Wo her bist du denn?" sagte der Mann. "Du musst eben von einer Reise gekommen sein; sonst hättest du den Palast des Prinzen Aladdin schon gesehen."
Denn seit Aladdin die Prinzessin Badrulbudur geheiratet hatte, war er selbst zum Prinzen geworden.
"Sein Schloss", fuhr der Mann fort, "ist mehr als ein Weltwunder. Es ist der wunderbarste Bau auf der Welt. Geh hin und überzeuge dich selbst davon!"
"Verzeih meine Unwissenheit", sagte der afrikanische Zauberer. "Aber ich bin erst gestern aus dem fernen Afrika hier eingetroffen. Unterwegs habe ich mir kerne Zeit genommen, auf die Reden der Leute zu hören; daher habe ich von der Sache bisher nichts erfahren. Doch jetzt will ich mir sofort dieses Schloss ansehen. Wenn du mir einen Gefallen erweisen willst, so führe mich dorthin!"
Der Mann führte ihn bereitwillig zum Palast Aladdins. Nun betrachtete der Zauberer den Bau. Er war sicher, dass Aladdin nur mit Hilfe der Lampe dieses Prunkgebäude errichtet haben konnte. Zornig rief er aus:
"Dieser Schurke! Ich werde ihm eine Grube graben! Er war nicht einmal imstande, das Schneiderhandwerk zu erlernen. Und jetzt lebt er in einem Palast. Ich werde ihn töten! Seine Mutter aber soll Wolle spinnen wie vorher." Grollend und voll Ärger über das Glück Aladdins kehrte er in seine Herberge zurück.
Dort nahm er sofort seine Schachtel mit dem Zaubersand und warf Figuren, und so sah er, wo Aladdin die Lampe aufbewahrt hatte. Sie befand sich in einem abseits gelegenen Raum des Palastes. Das freute den Zauberer, denn nun durfte er hoffen, die Lampe zu bekommen. Aladdin selbst war gerade nicht in der Stadt, er hatte einen längeren Jagdritt unternommen; erst nach einigen Tagen sollte er zurückkehren. Dies hatte der Zauberer vom Wirt seiner Herberge erfahren.
Mehr wollte der Zauberer nicht wissen. Jetzt ist der günstigste Augenblick, dachte er bei sich. Und er ging in den Laden eines Mannes, der Lampen herstellte.
"Guter Freund", sagte der Zauberer zu ihm, "ich brauche ein Dutzend kupferne Lampen. Kannst du sie mir liefern? Aber es müsste rasch sein.
Der Mann versprach, die Lampen bis zum nächsten Tag fertig zu haben. Der Zauberer verlangte noch, sie müssten recht blank sein. Dann versprach er gute Bezahlung und ging in seine Herberge zurück.
Am nächsten Morgen holte er die fertigen Lampen. Er bezahlte sie und legte sie in einen Korb, und damit begab er sich zum Palaste Aladdins. Unterwegs rief er imrner wieder aus: "Wer will alte Lampen gegen neue vertauschen?"
"Dieser Mann ist verrückt", sagten die Leute auf den Straßen. "Wie könnte er sonst alte Lampen gegen neue zum Tausch anbieten?"
Die kleinen Kinder liefen hinter ihm drein. Sie lachten ihn aus und Spotteten über ihn wie über einen Narren. So kam er in die Nähe des Palastes. Er kümmerte sich nicht um das Gespött der Kinder und das Gelächter der Erwachsenen. Laut rufend bot er seine Ware weiter an. Und die Kinder schrien: "Ein Narr, ein Narr "
Diese Rufe hörte auch die Prinzessin Badrulbudur. Sie hielt sich eben im Saal mit den vierundzwanzig Fenstern auf Aber wegen des großen Kindergeschreies konnte sie nicht verstehen, was der Mann rief Des halb schickte sie eine ihrer Sklavinnen hinunter. Diese kam bald lachend zurück
"Prinzessin", sagte sie zu ihrer Herrrn, "es ist zum Lachen! Da unten geht ein Mann mit schönen neuen Lampen herum und ruft fortwährend:
,Wer vertauscht alte Lampen gegen neue?' Den Lärm machen die Kinder, die in Scharen um ihn herumlaufen und ihn ausspotren." Über diesen sonderbaren Menschen musste auch die Prinzessin herzlich lachen.
Aladdin hatte die Wunderlampe nach dem letzten Gebrauch offen stehen gelassen und sie nicht zurück in die Schatzkammer getragen. Daher hatte eine der Sklavinnen die Lampe gesehen.
"Herrin", sagte diese nun zur Prinzessin, "im Gemach Eures Gemahls steht eine ganz alte Lampe. Eine neue würde viel besser dorthin passen. Wenn es Euch recht ist, könnten wir versuchen, sie einzutauschen. Dann wird sich zeigen, ob er wirklich verrückt ist."
Die Prinzessin kannte den Wert der Lampe nicht. Sie hatte keine Ahnung, dass Aladdin den Palast und alle seine Schätze den Zauberkräften der Lampe verdankte, und ging daher auf den Scherz ein. Ein Sklave bekam den Auftrag, die Lampe bei dem Mann gegen eine neue einzutauschen. Er lief hinunter vor den Palast und ging auf den Zauberer zu.
"Hier ist eine Lampe", rief er ihm zu, "gib mir eine neue dafür!"
Der Zauberer war überzeugt, dass diese alte Lampe die gesuchte Wunderlampe sei. Denn sonst war in diesem Palast sicher alles aus Gold und Silber. Daher nahm er dem Sklaven die Lampe rasch aus der Hand und hielt ihm dafür den Handkorb hin, damit er eine neue Lampe auswählen könne. Der Sklave nahm eine Lampe und kehrte damit zur Prinzessin zurück. Als diese die neue Lampe sah, lachte sie hellauf. Nun glaubte sie, dass der Mann wahrhaftig ein Narr sei.
Die Kinder tollten, aufs Neue um den Zauberer herum und spotteten über den Tausch. Er aber ließ sie schreien, soviel sie nur wollten. Die Lampen, die er noch hatte, überließ er den Leuten, die mit ihm tauschen wollten. Den leeren Korb stellte er in einer Hausnische nieder. Dann machte er sich schnell und unbemerkt aus dem Staube. Hastig schritt er durch eines der Stadttore. In der Vorstadt kaufte er sich Lebensmittel, und schließlich kam er auf das freie Feld. An einem abgelegenen Ort erwartete er die Nacht.
Gegen Mitternacht zog er endlich die Lampe aus seinem Kleid hervor und rieb sie. Sogleich erschien der Geist vor ihm.
"Was willst du?" sprach er. "Ich bin dein Diener und der Diener aller, die die Lampe in der Hand haben. Ich und die anderen Diener der Lampe werden dir gehorchen."
"Ich befehle dir", erwiderte der Zauberer, "Aladdins Palast mit allen seinen Bewohnern und mich selbst augenblicklich nach Afrika zu versetzen. Der Palast soll in der Stadt stehen, in der ich wohne."
"Ich höre und gehorche", sprach der Geist.
Und im Nu war der Zauberer samt dem Palast Aladdins an den bezeichneten Ort geschafft.
Aber verlassen wir nun den Zauberer und das Schloss in Afrika samt seinen Bewohnern und kehren wir zum Sultan und zu Aladdin zurück. Jeden Morgen trat der Sultan an das Fenster im Erker, um von dort einen Blick auf Aladdins Palast zu werfen und dabei in Liebe seiner Tochter zu gedenken. Auch diesmal schaute er hinüber, aber da sah er nichts als einen leeren Platz. Er rieb sich die Augen, denn er glaubte zu träumen. Aber er konnte kein Schloss entdecken, so lange er auch schaute. Es war ihm unbegreiflich, was geschehen war. Wäre der Palast zusammengestürzt, hätten Schutt und Trümmer auf der Stelle liegen müssen. Hätte ihn die Erde verschlungen, wären doch Spuren davon zu sehen gewesen. Aber so lange er auch wartete, der Platz vor seinem Schloss blieb leer. Da kam ihm seine Tochter in den Sinn, und schon liefen Tränen über seine Wangen. Endlich ging er in sein Zimmer zurück. Eilig befahl er, den Großwesir zu rufen; er selbst wusste nicht ein noch aus. Wirre Gedanken bestürmten ihn.
Der Großwesir ließ seinen Herrn nicht lange auf sich warten. Er kam in großer Eile und sah daher gar nicht, dass der Palast Aladdins verschwunden war. Als er vor den Herrscher trat, bemerkte er dessen Verstörtheit.
"Verzeiht, Herr", sagte er, "warum seid Ihr in solcher Betrübnis? Ist etwas Außerordentliches vorgefallen?"
"Ja", erwiderte der Sultan, "etwas ganz Sonderbares hat sich ereignet, und du wirst mir sogleich recht geben. Sag, wo ist der Palast Aladdins?"
"Der Palast Aladdins?" fragte der Wesir verwundert. "Ich ging soeben vorbei. Und mich dünkt, er ist an seinem Platz. Wie sollte es denn anders sein?" "Dann geh ins Nebengemach", antwortete der Sultan, "und schau beim Fenster hinaus! Danach sag mir, was du gesehen hast!"
Kopfschüttelnd ging der Großwesir zum Erker. Von dort schaute er zum Palast Aladdins hinüber. Aber da war nichts zu sehen, weder der Palast noch sonst etwas, solange er auch schaute. Verwirrt kam er zum Sultan zurück. "Nun", fragte ihn dieser, "hast du Aladdins Palast gesehen?"
"Herr", erwiderte der Großwesir, "Ihr habt mir nicht glauben wollen! Ich habe schon früher gesagt, dass dieses Schloss ein Werk der Zauberei sei. Aber Ihr wolltet nicht auf mich hören!"
Dies konnte der Sultan nicht leugnen. Aber gerade deshalb wurde er sehr zornig.
"Wo ist Aladdin, dieser Betrüger, dieser Schurke!" rief er. "Ich lasse ihm sofort den Kopf abschlagen."
"Herr", antwortete der Großwesir, "er hat sich vor einigen Tagen für einen längeren Jagdritt von Euch beurlaubt. Wenn er zurückkommt, wollen wir ihn fragen. Er wird wohl wissen, wo der Palast geblieben ist."
"Das wäre zu viel Schonung für ihn", erwiderte der Sultan. "Gib sofort Befehl, dass dreißig Soldaten ihn suchen sollen! Wenn Sie ihn finden, sollen sie ihn in Ketten geschlossen hierher bringen."
Der Großwesir führte den Befehl sogleich aus. Die Soldaten ritten ab und trafen Aladdin etwa fünf bis sechs Stunden vor der Stadt auf der Heimkehr von der Jagd. Der Anführer ritt an ihn heran. Er grüßte ehrerbietig. Dann sagte er, dass der Sultan Aladdin zu sehen wünsche. Darum wären sie ihm entgegengeritten, und nun wollten sie ihn nach Hause begleiten.
So setzte Aladdin, von der königlichen Leibwache Begleiter, ahnungslos seinen Weg fort. Etwa eine halbe Stunde vor der Stadt umringten ihn die Reiter plötzlich.
"Prinz Aladdin", sagte der Anführer, "seid uns nicht böse. Der Sultan hat befohlen, Euch zu verhaften und gefesselt vorzuführen. Wir bitten Euch, uns zu verzeihen. Aber wir tun nur unsere Pflicht."
Als Aladdin dies vernahm, war er wie vor den Kopf geschlagen. Er fühlte sich unschuldig und ahnte nicht, wessen man ihn bezichtige. Er fragte den Anführer, was man ihm vorwerfe. Aber weder dieser noch seine Leute konnten ihm antworten. Da sprang er vom Pferd. "Hier bin ich", sagte er, "tut mit mir, wie euch der Sultan befohlen hat. Ich bin mir zwar keines Verbrechens bewusst, aber dem Befehl des Herrschers muss ich gehorchen."
Da nahmen die Soldaten eine lange, dicke Kette. Die warfen sie ihm um den Hals und wanden sie um seinen Leib; dadurch waren auch die Arme gebunden. Einer der Reiter fasste das Ende der Kette. Dann stieg er zu Pferd und ritt mit den andern davon. Aladdin musste zu Fuß hinter her laufen. So wurde er in die Stadt gebracht.
Die Leute in der Vorstadt sahen Aladdin gefesselt wie einen Staatsverbrecher vorbeiziehen. Sie zweifelten nicht, dass es ihm den Kopf kosten werde. Aladdin aber war wegen seiner Freundlichkeit und Freigebigkeit beim Volke äußerst beliebt. Darum bewaffnete sich die Menge mit Säbeln und Steinen und machte Miene, gegen die Reiter vorzugehen und ihn zu befreien. Die letzten Reiter des Zuges machten zu nächst kehrt und suchten die Leute abzuwehren, aber deren Haltung wurde immer drohender. Es blieb den Soldaten nichts anderes übrig, als in der ganzen Straßenbreite zu reiten und so die Menschen an die Hausmauern zu drängen. Die Soldaten waren schließlich froh, mit heiler Haut bis zum Palasttor zu gelangen. Dort nahm der Anführer die Kette und zog Aladdin rasch hinter das schützende Tor.
Aladdin wurde sofort vor den Sultan geführt. Dieser erwartete ihn mit dem Großwesir auf dem Balkon. Der Scharfrichter war schon zugegen, und der Sultan befahl ihm, Aladdin sogleich den Kopf abzuschlagen. Er wollte den Verurteilten weder anhören noch eine Frage an ihn richten. Der Scharfrichter nahm die Kette ab und verband ihm die Augen, hierauf ließ er ihn niederknien. Mit gezogenem Schwert ging er dreimal um Aladdin herum. Währenddessen wartete er auf ein Zeichen des Sultans, den tödlichen Streich zu führen.
Aber die Leute vor dem Tor hatten die ganze Szene beobachtet. Sie sahen, dass Aladdin in höchster Gefahr war. Daher schrien sie, sie würden den Palast erstürmen und dem Erdboden gleich machen, wenn Aladdin das geringste Leid geschehe Der Wesir hörte das Geschrei.
"Herr", sagte er zum Sultan, "das Volk droht, den Palast zu besetzen. Wir schweben in größter Gefahr. Darum bitte ich Euch, schenkt Aladdin das Leben. Die Leute lieben ihn mehr als uns."
Da erblasste der Sultan. Er sah, dass die Menge bereits Miene machte, in den Palast einzudringen. Darum befahl er dem Henker, Aladdin freizugeben. Zugleich ließ er von seinen Herolden dem Volk verkünden, dass er Aladdin begnadige. Jeder möge nun wieder nach Hause gehen.
Diese Nachricht ging von Mund zu Mund. Nun legte sich die Unruhe, und allmählich leerte sich der Platz vor dem Palast.
Aladdin war wieder frei. Er hob sein Haupt und schaute nach dem Balkon hinauf Dort sah er den Sultan stehen.
"Herr", rief er, "ich danke Euch für die mir erwiesene Gnade. Aber ich bitte Euch, mir eine weitere zu gewähren. Lasst mich gnädig wissen, worin mein Verbrechen besteht."
"Du kennst dein Verbrechen noch nicht?" erwiderte der Sultan. "Komm herauf, Schurke, ich werde es dir zeigen!"
Aladdin stieg hinauf "Folge mir", befahl der Sultan und ging vor ihm her an das Fenster. Er wies mit dem Arm hinaus und sagte: "Nun sieh dich nach deinem Palast um. Du wirst ja wissen, was aus ihm geworden ist.
Aladdin konnte keine Spur seines Palastes erblicken. Er starrte fassungslos hinüber und wusste keine Erklärung. Was sollte er dem Sultan antworten?
"Doch was kümmert es mich, wo dein Schloss ist", fuhr der Sultan fort. "Tausendmal mehr wert ist mir meine Tochter. Wo ist sie? Schaffe sie mir wieder zur Stelle, sonst lasse ich dir den Kopf abhauen!"
"Herr", erwiderte Aladdin, "ich weiß ja nicht, wie das geschehen ist. Ich bitte Euch um eine Frist von vierzig Tagen, um alles zu erforschen. Wenn ich innerhalb dieser Frist Eure Tochter nicht herbeischaffe, so will ich selber meinen Kopf zu Euren Füßen hinlegen. Dann könnt Ihr nach Belieben über mich verfügen."
"Ich gewähre dir die Frist von vierzehn Tagen", sagte der Sultan. "Aber glaube nicht, diese Gnade missbrauchen zu können. Meinem Zorn wirst du nicht entrinnen. Ich werde dich zu finden wissen, auch wenn du dich im entferntesten Winkel der Erde versteckst!"
Tief gedemütigt entfernte sich Aladdin aus dem Sultanspalast. Er schlich durch den Hof und wagte nicht, die Augen zu erheben. Keiner der Würdenträger des Hofes achtete jetzt mehr auf ihn. Selbst die niedrigen Hofbeamten sahen über ihn hinweg. Viele erkannten ihn gar nicht, so sehr hatte er sich verändert. Er glaubte, den Verstand verlieren zu müssen. Ja, er war wirklich nahe daran. Er ging nun von Haus zu Haus und fragte jeden, ob er seinen Palast nicht gesehen habe. Solche Fragen brachten die Leute auf den Gedanken, dass er irrsinnig sei. Einige lachten, die meisten aber hatten Mitleid mit ihm und gaben im Speise und Trank. Drei Tage irrte Aladdin ziellos in der Stadt umher, und dann wusste er noch immer nicht, wie er seine junge Frau und den Palast wiederfinden sollte.
Endlich verließ er die Stadt. Er achtete nicht darauf, welche Richtung er nahm. Mit Einbruch der Nacht kam er völlig verzweifelt an das Ufer eines breiten Flusses.
"Wo soll ich meinen Palast suchen?" fragte er sich. "Und wo werde ich meine liebe Frau wiederfinden? In welchem Winkel der Erde mag sie verborgen sein? Nie werde ich das ausfindig machen. Darum ist es besser, ich mache ein Ende."
Schon war er entschlossen, sich in den Fluss zu stürzen. Aber als frommer Moslem wollte er zuerst sein Gebet verrichten. Er kniete am Ufer des Flusses nieder, um mit den Händen Wasser zu schöpfen. Gemäß dem Gebot wollte er Hände und Gesicht waschen. Da aber die Stelle abschüssig war, glitt er aus, fast wäre er in den Strom gefallen. Im letzten Augenblick konnte er ein aus der Erde ragendes Felsenstück packen und sich daran festhalten. An der Hand trug er immer noch den Ring, den ihm der Zauberer gegeben hatte; mit seiner Hilfe war er in die Schatzhöhle gestiegen, um die Wunderlampe zu holen. Als er sich nun am Felsen festhielt, rieb sich der Ring am Gestein. Sofort erschien der Geist, der ihn damals aus dem unterirdischen Gewölbe befreit hatte.
"Was wünschest du ?" sagte der Geist. "Ich bin bereit, dir zu gehorchen. Denn ich bin dein Diener und der Diener aller, die den Ring am Finger tragen. Ich und alle übrigen Diener des Rings werden dir gehorchen."
Aladdin war durch die unerwartete Erscheinung des Geistes aufs höchste überrascht. Aber er fasste sich sofort.
"Geist", rief er, "zeige mir an, wo sich mein Palast befindet. Oder bring ihn unverzüglich an die Stelle, an der er früher stand."
"Mein Gebieter", erwiderte der Geist, "du begehrst Unmögliches von mir. Was du vedangst, ist Sache der Diener der Lampe. Ich aber bin nur Diener des Ringes."
"Dann nimm mich", entgegnete Aladdin, "und trage mich zu meinem Palast, in welchem Land er auch sein mag!"
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, trug ihn der Geist bereits fort. Mitten auf einer großen Wiese in Afrika setzte er ihn ab. Da stand Aladdin nun gerade unter den Fenstern der Prinzessin Badrulbudur vor seinem Palast. Das alles war das Werk eines Augenblicks. Dankerfüllt betete er zu Allah, er möge ihn seine Gemahlin wiedersehen lassen. Sein Kummer linderte sich bei dem Gedanken, wie nahe er ihr jetzt schon sei. Da es bereits Nacht geworden war, herrschte im Palast völlige Ruhe. Darum trat er unter einen Baum und setzte sich ins Gras. Und weil er schon sechs Tage nicht geschlafen hatte, überwältigte ihn der Schlaf
Als eben die Morgenröte aufstieg, weckte ihn der Gesang der Vögel aus dem Garten seines Palastes. Sein erster Blick fiel auf den wundervollen Bau. Er hatte wieder Hoffnung, seine Prinzessin bald in die Arme schließen zu dürfen, und das machte sein Herz froh und leicht. Nun spazierte er eine Weile unter ihren Fenstern auf und ab. Er hoffte, dass sie ihn erblicken werde.
Die Prinzessin war über die Trennung von ihrem Gatten und ihrem Vater sehr betrübt. Traurig verbrachte sie die Tage. Der Zauberer fand sich jeden Tag bei ihr ein und machte ihr das Leben vollends zur Qual. Die Sorge über ihr ungewisses Schicksal schaffte ihr schlaflose Nächte. Zeitlich am Morgen pflegte sie sich zu erheben. So war sie auch an diesem Morgen wach, als sich der erste Schimmer im Osten zeigte. Als eine Sklavin das Fenster öffnete, bemerkte sie Aladdin. Mit froher Stimme rief sie ihre Herrin herbei. Ungläubig eilte die Prinzessin ans Fenster und schaute hinaus. Da sah sie Aladdin unten an der Mauer stehen. Er hob soeben sein Haupt und erkannte sie sogleich. Er grüßte sie, sie grüßte ihn. Überschwängliche Freude war in beider Mienen zu lesen.
"Kommt rasch durch die geheime Tür in den Palast", rief die Prinzessin. "Der Elende ist jetzt nicht hier."
Eine Sklavin öffnete sofort die Geheimtür. Aladdin betrat den Palast. Da kam ihm schon die Prinzessin entgegen. Sie flogen einander in die Arme und weinten vor Glück und Freude. Nach langer Trennung waren sie endlich wieder veremt. Eng umschlungen gingen sie in das Gemach der Prinzessin. Nun wollte Aladdin alles mit ihr besprechen, was zu tun sei.
"Teure Gemahlin", begann er, "sagt mir vorerst, wo ist die alte Lampe aus meinem Zimmer hingekommen?"
Da erwiderte die Prinzessin seufzend: "Ach, das ist die Ursache meines Elends." Und sie erzählte ihm all ihre Erlebnisse vom Umtausch der Lampe bis zu ihrer Entführung.
"Und am nächsten Morgen", sagte sie abschließend, "befanden wir uns in einer ganz fremden Gegend. Höhnisch teilte mir der Zauberer mit, wie er uns betrogen habe. Mit Hilfe der Lampe hatte er uns hierher nach Afrika versetzt."
"Wenn dieses Land Afrika ist", rief Aladdin, "dann kenne ich auch den Bösewicht Er hat mir schon genug angetan. Ich will Euch von all seinen Bosheiten erzählen. Doch sagt mir vorerst, wo er die Lampe verborgen hält!"
"Er trägt sie immer bei sich in seinem Gewande", erwiderte die Prinzessin. "Ich weiß dies, weil er sie in meiner Gegenwart hervorgezogen hat, um mir Angst einzujagen."
"Was will dieser Elende von Euch?" fragte Aladdin besorgt. "Was spricht er, was hat er im Sinn? Ich bitte Euch, sagt mir alles."
"Seitdem ich hier bin", erwiderte die Prinzessin, "kommt er täglich einmal zu mir. Er dringt in mich, dass ich Euch vergessen und mein Wort brechen soll; ich solle seine Gattin werden. Dazu behauptet er, Ihr wäret nicht mehr am Leben, der Sultan habe Euch enthaupten lassen. Er sagt auch, Ihr wäret ganz armer Leute Kind, und nur ihm hättet Ihr Eure Reichtümer zu verdanken. Mit süßen Worten versuchte er, mich zu umgarnen, aber ohne Erfolg. Ich habe ihm noch kein freundliches Wort geschenkt. Vielleicht kommt er deshalb nicht öfter zu mir. Trotz dem fürchtete ich, dass er am Ende Gewalt brauchen werde. Doch Eure Ankunft hat mir diese Sorge genommen."
"Ihr sollt nicht umsonst an meine Ankunft Hoffnungen knüpfen", unterbrach sie Aladdin. "Ich glaube, ich habe ein Mittel gefunden, das uns von unserem gemeinsamen Feind befreien soll. Ich will jetzt in die nahe Stadt gehen, gegen Mittag werde ich wiederkommen. Dann werde ich Euch meinen Plan und Eure Aufgabe darin mitteilen. Wundert Euch nicht, wenn ich in Verkleidung erscheine. Lasst eine Sklavin bei der geheimen Pforte stehen, wenn ich klopfe, soll sie mir sofort öffnen."
Die Prinzessin versprach, Aladdins Anweisungen genau zu befolgen. Dieser verließ den Palast durch die Geheimtür und schritt die Wiese entlang. Unfern des Palastes traf er einen Bauern bei der Feldarbeit. Ihm machte er den Antrag, die Kleider mit ihm zu tauschen. Der Bauer weigerte sich zuerst. Aber Aladdin ließ nicht locker, bis der Bauer nachgab. Hinter einem Gebüsch wechselten sie schließlich die Kleider, und Aladdin ging in dem abgetragenen, unscheinbaren Bauerngewand der Stadt zu. Der Landmann aber machte sich mit Aladdins kostbaren Gewändern davon.
Nach mehrmaligem Fragen kam Aladdin in der Stadt in die Gasse der Spezereihändler. Vor dem größten Laden blieb er stehen, trat ein und verlangte von dem Händler ein bestimmtes Pulver. Der Kaufmann sah auf Aladdins ärmliche Kleidung und meinte, das Pulver werde ihm zu teuer sein. Da zog Aladdin aus seinem Beutel ein Goldstück heraus. Nun wog der Kaufmann sofort so viel von dem Pulver aus, wie das Goldstück wert war. Aladdin zahlte und ging. Er brauchte nicht lange an der geheimen Tür zu warten und begab sich sogleich in das Zimmer seiner Gattin.
"Prinzessin", sagte er, "ich weiß, Ihr hasst Euren Entführer. Was ich Euch zu tun bitte, wird Euch daher nicht schwerfallen. Aber es ist notwendig, mit List und Verstellung vorzugehen. Vielleicht müsst Ihr Euch dabei Zwang antun; aber schließlich wollt Ihr Euren Vater und die Heimat wiedersehen. Hört also meinen Vorschlag: Schmückt Euch so gleich mit den schönsten Gewändern. Legt Diamanten und Perlen an. Wenn der Zauberer kommt, empfangt ihn mit freundlicher Miene und seid so unbefangen, als ob nichts vorgefallen wäre! Ladet ihn zum Abendessen ein; er wird sich darüber freuen. Erwähnt auch, dass Ihr gerne den Wein des Landes kosten wolltet. Er wird dann sogleich Wein holen. Beim Mahle reicht ihm fleißig den Becher! Ist er nach einiger Zeit achtlos geworden, so schüttet dieses Pulver in Euren Becher. Füllt ihn dann wieder mit Wein und bietet dem Zauberer an, die Becher zu tauschen! Er wird diese Gunst zu schätzen wissen und Euren Becher in einem Zug leeren. Wenn er den Wein mit dem Pulver aus- getrunken hat, wird er sofort wie tot hinsinken. Ihr müsst Euch wohl so stellen, als tränket Ihr aus dem Becher; aber Ihr habt dabei nichts zu befürchten. Die Wirkung des Pulvers stellt sich sehr rasch ein. Der Zauberer wird keine Zeit haben, lange auf Euch zu achten."
"Ich bin bereit zu tun, was Ihr von mir verlangt", sagte die Prinzessin. "Es wird mich gar große Überwindung kosten, dem Zauberer freundlich zu begegnen. Aber ich will es gerne tun."
Sodann speiste Aladdin mit seiner Gemahlin. Rechtzeitig verließ er nachher das Schloss; erst bei Anbruch der Nacht wollte er sich wieder bei der Geheimtür einfinden.
Die Prinzessin hatte seit ihrer Entführung ihr Äußeres sehr vernachlässigt. Ihr Schmerz um Aladdin und den Vater war zu groß gewesen. Außerdem wollte sie sich dem Zauberer gar nicht im besten Licht zeigen.
Jetzt aber setzte sie sich an ihren Putztisch. Sie ließ sich aufs prächtigste schmücken und legte das kostbarste Kleid an. Ihr Gürtel strahlte von Diamanten. Um den Hals trug sie ein kostbares Perlenband. Als die Prinzessin völlig angekleidet war, zog sie den Spiegel zu Rate. Es fehlte nichts, was der törichten Eitelkeit des Zauberers schmeicheln mochte. Also setzte sie sich auf den Diwan und erwartete seine Ankunft.
Zur gewohnten Stunde fand sich der Zauberer ein Die Prinzessin erwartete ihn im Kuppelsaal. Im Glanze ihres Schmuckes und ihrer Schönheit begrüßte sie ihn mit freundlichem Lächeln. Sie lud ihn ein, an ihrer Seite Platz zu nehmen. Dieses Entgegenkommen war ihm ungewohnt; er war überrascht und geblendet von ihrem Liebreiz und wagte gar nicht, sich an ihre Seite zu setzen. Sie aber wies nochmals auf den Platz zu ihrer Rechten. Da gehorchte er.
Sobald er neben ihr saß, blickte sie ihn liebevoll an. Nun musste er glauben, er sei ihr nicht mehr verhasst.
"Ihr wundert Euch wohl", sagte sie, "dass ich heute anders bin als sonst. Aber ich habe mir Eure Worte durch den Kopf gehen lassen. Ich bin nun überzeugt, dass mein Gatte Aladdin nicht mehr lebt. Sicher hat ihm mein Vater den Kopf abschlagen lassen. Ich habe keine Hoffnung mehr, ihn wiederzusehen; auch meine Tränen werden ihn nicht mehr zum Leben erwecken. Ich mag aber nicht länger in Trübsal und Kümmernis leben. Darum möchte ich Euch einladen, heute bei mir das Abendessen einzunehmen. Ich bitte Euch auch, einen Schluck Wein mit mir zu trinken. Gerne würde ich den Wein dieses Landes kosten, denn ich kenne bisher nur den Wein aus meiner Heimat, und vielleicht ist Euer Wein besser als der unsere. Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr meine Bitte nicht abschlagen wolltet."
Der Zauberer war außer sich vor Freude. Nun durfte er hoffen, bald weitere Fortschritte in der Gunst der Prinzessin zu machen. Dankbar nahm er die Einladung an und versprach, auch den Wein sogleich herbei zu schaffen. Zu Hause habe er einen Krug voll der besten Sorte. Dieser Wein sei schon acht Jahre in der Erde vergraben und übertreffe die köstlichsten Weine der Welt.
"Prinzessin", fuhr er fort, "erlaubt mir, zwei Flaschen von diesem Wein zu holen. Ich werde gleich wieder da sein.
"Schickt doch einen Diener", erwiderte die Prinzessin. "Es tut mir leid, wenn Ihr Euch selbst diese Mühe macht."
"Herrin", entgegnete er, "es ist notwendig, dass ich selbst gehe. Niemand kennt nämlich den Ort, an dem sich der Krug befindet. Ich werde nicht lange fortbleiben."
"Wenn das so ist", antwortete die Prinzessin, "so geht und kommt bald wieder. Ich will Eure Gesellschaft nicht zu lange missen."
Der Zauberer war in bester Stimmung über sein vermeintliches Glück. Er lief, so rasch er konnte, um seinen Wein zu holen. In kurzer Zeit war er wieder zurück. Darauf setzten sie sich zu Tisch und speisten zusammen, sie waren fröhlich und guter Laune. Eine Sklavin schenkte die Becher voll. Die Prinzessin trank auf sein Wohl, und er wünschte ihr Gesundheit und langes Leben. So leerten sie manchen Becher. Die Gastgeberin aber hielt sich beim Trinken vorsichtig zurück. Seine Stimmung wurde immer ausgelassener, und die Prinzessin verstand es, ihn mit süffigen Reden noch mehr zu betören. Ahnungslos meinte er, die schönen Worte kämen ihr wirklich vom Herzen. Er glaubte, vor Glück vergehen zu müssen. Seine Sinne verwirrten sich allmählich. Die Prinzessin hatte bemerkt, dass dem Zauberer der Wein bereits zu Kopf gestiegen war.
"ln unserem Land ist es Sitte", sagte sie zu ihm, "dass zwei gute Freunde beim Trinken die Becher vertauschen. Ist dies in Afrika nicht üblich?"
Ohne seine Antwort abzuwarten, griff sie nach seinem Becher und reichte ihm dafür den ihren. Das Pulver hatte sie in einem unbewachten Augenblick bereits hinein geschüttet. Der Zauberer musste glauben, dass er die Frau völlig erobert habe; er hielt sich für den glücklichsten aller Sterblichen, weil sie ihm einen solchen Liebesbeweis gab.
Ehe er trank, sagte er: "Prinzessin, jetzt weiß ich, wie hoch ich Eure Gunst zu schätzen habe. Nie werde ich vergessen, dass ich aus Eurem Becher trinken durfte. Eure frühere Grausamkeit ist vergessen. Ihr habt mir das Leben wiedergegeben."
Die Prinzessin langweilte sich bei dem leeren Geschwätz des Zauberers. Deshalb unterbrach sie ihn. "Jetzt wollen wir trinken!" sagte sie. "Ihr könnt ja nachher weiterreden."
Sogleich setzte sie den Becher an den Mund und tat, als ob sie trinke. Er aber beeilte sich, es ihr zuvorzutun. Daher leerte er den Becher mit einem Zug. Im selben Augenblick verdrehten sich seine Augen; der Becher entfiel seiner Hand, und er sank wie tot zu Boden. Wie freute sich da die Prinzessin! Alle ihre Dienerinnen jubelten und eilten um die Wette zu der geheimen Tür, um Aladdin ins Schloss zu lassen.
Aladdin kam herauf und betrat den Speisesaal. Dort sah er den Zauberer auf dem Boden liegen. Die Prinzessin kam ihm mit offenen Armen entgegen. Er aber wehrt sie ab.
"Prinzessin", sagte er, "noch ist es nicht Zeit, das Wiedersehen zu feiern. Ich bitte Euch, geht mit den Sklavinnen in Euer Gemach. Sorgt dafür, dass ich ungestört bleibe. Ich will indessen hier meine Vorbereitungen treffen. Ihr sollt ebenso rasch in die Heimat zurückkommen, wie Ihr von dort weggeführt wurdet."
Die Prinzessin gehorchte sofort und zog sich mit ihren Dienerinnen zurück. Aladdin schloss hinter ihnen die Tür des Saales, dann trat er zu dem Zauberer und nahm die Lampe aus seinem Gewand. Hierauf zog er seinen Säbel und schlug dem Zauberer den Kopf ab. Anschließend enthüllte er die Lampe und rieb sie. Sogleich erschien der Geist.
"Mein Gebieter", sprach dieser, "hier bin ich. Was wünschest du?" "Geist", entgegnete Aladdin, "trage dieses Schloss unverzüglich in meine Heimat zurück und setze es an dieselbe Stelle hin, wo es früher stand, genau dem Palast des Sultans gegenüber!"
Nach diesen Worten ging Aladdin in das Gemach seiner Gattin. Nun plauderten sie, von Sorgen befreit, über die letzten Ereignisse. Währenddessen nahm der Geist den Palast und setzte ihn an die befohlene Stelle. Sie verspürten dabei nur zwei leichte Erschütterungen, als der Palast aufgehoben und niedergesetzt wurde.
Da Aladdin nichts gegessen hatte, wurde ein reichliches Mahl gerichtet. Sie setzten sich zu Tisch, aßen die köstlichsten Speisen und tranken vom Wein des Zauberers. Fröhliches Geplauder verkürzte ihnen die Zeit. Ehe sie sich versahen, dämmerte der Morgen. Nun erst begaben sie sich zur Ruhe.
Wie war es unterdessen dem Sultan ergangen? Seit der Entführung der Prinzessin hatte er sich immer tiefer in seinen Schmerz verbohrt. Er verbrachte schlaflose Nächte, und tagsüber war er für niemanden zu sprechen. Er suchte keine Ablenkung Für seine trüben Gedanken. Fast stündlich trat er ans Fenster, um nach dem verschwundenen Palast auszuschauen. Er gedachte mit Schmerzen seiner Tochter, denn er wähnte, sie nie wiederzusehen. Tag für Tag vergoss er Tränen um sein einziges Kind, bis seine Augen fast erblindeten.
Auch in diesem Tag eilte der Sultan früh am Morgen zum Fenster, um auf den leeren Platz hinauszustarren. Er rieb sich die Augen - es war keine Täuschung. Vor ihm stand Aladdins Palast. Freude und Fröhlichkeit ergriffen sein Herz. Rasch ließ er sein Pferd satteln. Dann ritt er zu dem Schloss hinüber.
Aladdin hatte den Besuch des Schwiegervaters erwartet. Darum war er schon aufgestanden und hatte sein bestes Staatskleid angelegt. Auch seine Gattin hatte sich von ihren Dienerinnen schmücken lassen. Sie freute sich, den geliebten Vater bald wiederzusehen. Ihre Augen leuchteten und blitzten mit den Edelsteinen ihres Geschmeides um die Wette.
Als Aladdin den Sultan heranreiten sah, eilte er ihm entgegen. Er wollte ihn empfangen und ihm vom Pferde helfen.
"Aladdin", sagte der Sultan, "zuerst muss ich meine Tochter sehen und sprechen. Dann erst werde ich mit dir reden." Da eilte auch schon die Prinzessin die Treppe herunter. Jubelnd warf sie sich ihrem Vater an die Brust. Der Sultan umarmte und küsste sie innig. Tränen der Freude netzten seine Wangen. Dann geleitete Aladdin Vater und Tochter die Treppe empor. Im Gemach der Prinzessin setzten sie sich, um die Freude des Wiedersehens vollends zu genießen.
"Liebe Tochter", begann der Sultan, "wie ist es dir ergangen? Macht es die Freude des Wieder sehens, dass du mir gar nicht verändert vorkommst? Ich denke, du musst Schreckliches ausgestanden haben. Erzähle rasch, wie alles sich begeben hat."'
Da erzählte ihm die Prinzessin ausführlich, was sich seit dem Umtausch der Lampe ereignet hatte. Sie schilderte die Person des Zauberers und erzählte von seiner Zudringlichkeit. Dann berichtete sie von Aladdin und wie er wieder in den Besitz der Lampe gekommen war. Nochmals kam sie auf den widerlichen Zauberer und ihr Unglück zu sprechen.
"Am unglücklichsten aber fühlte ich mich", fuhr sie fort, "dass ich von Euch und von meinem Gemahl getrennt war. Es schien ja keine Hoffnung vorhanden, Euch je wiederzusehen. Kummer und Schmerz hatten mein Äußeres sehr verändert. Ihr hättet mich kaum mehr erkannt, lieber Vater. Aber der Anblick meines Gatten hat mir schon gestern wieder Freude am Leben gegeben. Da ich Euch in die Augen sehen darf, bin ich nun vollkommen glücklich. Aber vielleicht hat Aladdin noch etwas zu berichten."
Aladdin hatte nur weniges hinzuzufügen. "Als ich den Zauberer betäubt am Boden liegen sah", erzählte er weiter, "schickte ich Eure Tochter und die Sklavinnen ins Nebenzimmer. Ich holte die Lampe aus der Brusttasche des Toren. Dann hieb ich ihm den Kopf ab. Durch die Wunderkraft der Lampe ließ ich den Palast wieder hierher versetzen. Und Eure Tochter, erhabener Herr, kann ich Euch unversehrt ans Herz legen. Dass ich meine Gattin wiederhabe, macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Von der Wahrheit unserer Erzählung könnt Ihr Euch leicht überzeugen, denn nebenan im Saal liegt noch der Leichnam des verruchten Bösewichts."
Der Sultan erhob sich und ging mit Aladdin in den Saal. Da lag der tote Zauberer. Der Sultan ließ sogleich die Leiche wegschaffen und sie verbrennen. Die Asche sollte in alle Winde verstreut werden. Aladdin aber umarmte er väterlich.
"Mein Sohn", sagte er zu ihm, "meine Vaterliebe zwang mich, deinen Tod anzubefehlen. Ich glaubte mein einziges Kind verloren. Daher wollte ich dich als den vermeintlichen Übeltäter bestrafen. Verzeih mir um der Liebe willen, die du zu meiner Tochter hegst!"
Aladdin antwortete: "Herr, ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Was Ihr getan, ist verständlich. Aber ich hatte keine Schuld. Alles Unglück hat nur dieser schändliche Zauberer angerichtet. Er allein war die Ursache, dass ich Eure Gnade verlor. Jetzt hat ihn die gerechte Strafe ereilt."
Nun ließ der Sultan in der Stadt ein zehntägiges Freudenfest ankünden. Die Rückkehr seiner Tochter und ihres Gemahls sollte gebührend gefeiert werden. Aladdin war nun zum zweiten Mal einer Todesgefahr entronnen.
Wenige Jahre später starb der Sultan, und Aladdin bestieg den Thron. Er herrschte gerecht über seine Untertanen, die ihn liebten und verehrten. Mit seiner Gemahlin aber lebte er ferner in Glück und Freuden. Keine Gefahr bedrohte mehr ihr Leben
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nächster Märchenletter am 08.07.2019
10.06.2019 Der Märchenletter und mein Märchenprogramm im Internet ist ein rein privates Hobby von mir. Somit hast Du natürlich auch keinen rechtlichen Anspruch auf die Märchen.
Wenn Du den Märchenletter einmal nicht mehr möchtest, kannst Du ihn jederzeit wieder abbestellen.
Meine Datenschutzerklärung findest Du hier
0 notes
Text
Epilog

Durch das Stechen in Marys Brust fiel es ihr schwer zu laufen, doch sie durfte jetzt nicht stehen bleiben. Je tiefer sie sich hinab bewegte, desto heruntergekommener wurde das Gebäude. Sie war noch nie so weit vorgedrungen.
Das Mädchen wagte nicht, zurückzublicken. Sie konzentrierte sich darauf, nicht die Treppen hinunter zu stolpern. Die Wände waren inzwischen aus Beton und nicht mehr aus streifenfreiem Glas, wie in den oberen Stockwerken, der WICKED-Zentrale. Neun Jahre war sie nun schon hier und dennoch war sie noch nie in den Kellerräumen gewesen. Geschweige denn, draußen gewesen.
Ihr Atem wurde mit jedem Schritt lauter und der Klang ihrer Schuhe auf dem kalten Boden wurde von den steinernen Wänden auf sie zurückgeworfen. Es war schrecklich kalt und die Beleuchtung wurde immer schwächer. Bald würde sie nichts mehr sehen können.
Mary wäre beinahe gegen die Wand am Ende der Treppe gelaufen, da sie schon so schnell geworden war. Ohne stehen zu bleiben, lief sie durch die erste Tür, die sie sah.
Ein spärlich beleuchteter Gang führte kilometerlang nur geradeaus. Kurzerhand entschied sie sich dafür, nach links zu laufen. Rostige Rahmen für die Patienteninformationen waren neben den verschlossenen Türen befestigt. In manchen waren noch die Dokumente, der Versuchspersonen, die hier früher gelebt hatten. Dieser Bereich wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt.
Nach einigen Minuten fand sie endlich eine Tür, die offen stand. Sie eilte in den Raum und schloss die schwere Tür, die laut quietschte. Sie lehnte sich an die eisige Wand und versuchte zu Atem zu kommen. Als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte sie, dass sie sich in einem alten Waschraum befand.
Die meisten Fliesen waren zerbrochen oder mit Blut verschmiert. Viele hatten sich in diesen Räumen ihr Leben genommen oder sich gegenseitig ermordet. Es musste furchtbar gewesen sein, nur zu leben, um Experimente an einem durchführen zu lassen. Wie ein Tier.
Das Mädchen ging weiter in den Raum hinein und hielt sich die Nase zu, wegen des Gestanks von abgestandenem Wasser, der die Luft erfüllte. Im hinteren Bereich, wo sich die Duschen befanden, waren so gut wie alle Fließen entfernt worden und Schimmel breitete sich in allen Ecken aus.
Sie kauerte sich zwischen die Türen zu den Toiletten und versuchte ihre Tränen zurückzuhalten. Hoffentlich finden sie mich nicht. Hoffentlich kann ich weg von hier.
Doch nur wenige Minuten später, als sie schon dachte, sie hätte ihre Verfolger abgeschüttelt, wurde die Tür aufgestoßen. Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht vor Verzweiflung aufzuschreien.
Das war's. Sie haben mich gefunden.
"Da ist sie!", die Stimme eines Sicherheitsmannes ließ sie in sich zusammensinken. Sie hatte verloren. Das war ihr Ende.
"Steh auf, dumme Göre!", der Unbekannte packte sie grob am Arm und zog sie hoch. Ihr Kopf fühlte sich leer an. Sie hatte jegliche Hoffnung verloren.
Ein zweiter Sicherheitsmann legte ihr Handschellen an und schob sie mit seinem Granatwerfer, der sie mit einem Schuss vollständig lähmen könnte, vor sich her. Sie hatte keine Lust darauf, von Elektroschocks in eine Ohnmacht getrieben zu werden, also tat sie, was von ihr verlangt wurde.
***
Das kalte Metall der Handschellen drückte gegen Marys Handgelenke. Der Mann vom Sicherheitsdienst hielt sie grob an den Armen fest und führte sie durch die weißen Gänge der WICKED-Zentrale. Sie wusste, dass es jetzt zu spät war, um nach Hilfe zu rufen. Sie wusste, dass jetzt alles vorbei war. Sie konnte niemandem sagen, was mit ihr geschehen würde. Sie hatte keine Möglichkeit mehr ihren Freunden auf Wiedersehen zu sagen. Sie wusste, dass das ihr Ende sein würde.
Sie bogen scharf rechts ab und befanden sich nun vor einer gepanzerten Tür, die sofort von innen geöffnet wurde, als sie davor zum Stehen kamen. Augenblicklich sah ihr das spitze Gesicht von Janson entgegen, dem Mann im weißen Anzug. Über die Jahre hatte sie einen unvorstellbaren Hass ihm gegenüber entwickelt. Er war stets hinterlistig und hatte immer nur sein eigenes Wohl im Sinn. Auch er konnte das Mädchen nicht ausstehen und ließ sich keine Gelegenheit entgehen, ihr das auch zu zeigen.
Er trat zur Seite und hinter ihm sah sie Dr. Ava Paige, die Leiterin von WICKED. Ihre blonden Haare waren wie immer hochgesteckt und leichte Falten zeichneten sich auf ihrer Stirn ab. Doch sie lächelte freundlich. Eine Fassade, wie Mary schon lange wusste.
Der Mann schob sie in den Stuhl, der vor dem weißen Schreibtisch stand. Sie weigerte sich ihren Blick zu erheben. Zu sehr wünschte sie sich, dass alle Menschen in diesem Raum tot umfallen würden.
"Vielen Dank Mr. Avery. Ihre Dienste werden hier nicht mehr benötigt.", mit gewohnt emotionslosem Tonfall, entließ sie den Sicherheitsmann und setzte sich ebenfalls.
"Nun ich gehe davon aus, dass du bereits weißt, warum du hier bist?"
Mary gab keinen Laut von sich.
"Gut. Wie dir klar ist, hast du mehrere schwere Verstöße entgegen deiner Verschwiegenheitspflicht begangen, die wir natürlich nicht ohne weiteres tolerieren können. Dein Forschungsprojekt unterliegt strengster Geheimhaltung und dennoch hast du mehr als sensible Daten weitergegeben. Ich nehme an, dass du dir dieses Verstoßes bewusst bist?"
Wieder gab sie keinen Laut von sich. Fall tot um, falsche Schlange.
"Antworte gefälligst, wenn man dir eine Frage stellt!", fauchte Janson aus einer Ecke des Raumes.
"Nicht nötig Janson. Sie muss nichts sagen, damit ich sie verstehen kann. Es genügt, wenn ich sie sehen kann. Sie ist ein äußerst intelligentes junges Mädchen. Sie weiß was sie tut."
"Darum hat sie auch ihrem kleinen Freund alles verraten nehme ich an?", sie konnte förmlich sehen, wie sein Gesicht rot vor Wut wurde. Sie war schon immer gut darin gewesen, ihn auf die Palme zu bringen und in diesem Moment, war es ihr das Liebste auf der Welt, denn vielleicht würde es das Letzte sein, das sie tun würde.
"Nun wie du ja schon weißt", fuhr Paige fort, "steht auf dein Vergehen die Todesstrafe."
Mary verlor plötzlich jegliches Gefühl in ihren Gliedmaßen. Sie fühlte sich als würde sie über sich selbst schweben. Sie wusste natürlich was die Konsequenz ihrer Taten war, aber es so zu hören war schlimmer, als sie sich jemals hätte vorstellen können.
"Allerdings können wir es uns nicht leisten jemanden so Talentiertes wie dich zu verlieren. Deine Fähigkeiten sind äußerst bemerkenswert."
"Wohl eher nervig auffallend", bemerkte der rattenartige Mann.
"Janson. Wenn Sie sich nicht beherrschen können, muss ich Sie bitten, den Raum zu verlassen."
Geschieht dir recht.
"Ich lasse Sie doch nicht allein mit dieser Göre!"
"Das reicht jetzt Janson", sie versuchte nicht die Fassung zu verlieren.
"Also, wie bereits erwähnt, wäre es eine absolute Verschwendung dich zu töten Mary. Darum haben wir uns für einen anderen Weg entschieden."
Sie konnte fühlen, wie ihr Herz raste. Sie musste nicht sterben? Sie hatte schon versucht sich damit abzufinden, ihre Freunde nie wieder zu sehen. Sie hatte es sich immer vorgenommen ihre Freunde im Labyrinth eines Tages wieder zu sehen, doch das wäre ihr so nicht möglich gewesen. Zu lange hatte sie Minho, Alby und Newt nicht mehr gesehen. Newt. Ihr bester Freund. Er fehlte ihr am meisten. Beinahe jeden Tag weinte sie sich in den Schlaf, bei dem Gedanken daran, was ihm alles passieren könnte.
Thomas und Teresa hielten sie zwar immer auf dem Laufenden, aber sie konnte seine Abwesenheit einfach nicht verkraften. Zu sehr sehnte sie sich nach ihm. Ob es ihm genauso ging? Ob er sich noch an sie erinnern konnte? Sie hatten sich zwar erst im Sammellager von WICKED kennengelernt, doch es dauerte nicht einen Tag bis sie unzertrennlich waren. Zu kurz war ihre gemeinsame Zeit, bevor Newt ins Labyrinth gebracht wurde. An jenem Tag schwor Mary ein Heilmittel zu finden. Koste es was es wolle. Doch es war alles vergebens.
"Wir haben beschlossen dein Gedächtnis zu löschen und dich ins Labyrinth zu bringen. Deine Gehirnaktivität ist eine der höchsten, die wir je verzeichnet haben. Somit wirst du sicher eine ausgezeichnete Ergänzung zu unseren derzeitigen Versuchspersonen darstellen. Und durch deine Gedächtnismanipulation können wir sicherstellen, dass du nicht noch mehr geheime Daten preisgibst. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch genau das, was du dir gewünscht hast, nicht wahr?", ein falsches Grinsen bildete sich auf ihrem Gesicht.
"Ja. Endlich kann sie wieder zu ihrem geliebten ..."
"Janson! Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Raum oder ich muss Sie wegen einem Verstoß gegen Ihre Verschwiegenheitspflicht hinrichten lassen!"
Mary liefen Tränen über die Wangen. Sie würde Newt wieder sehen. Es würde alles gut werden. Sie würden glücklich im Labyrinth leben. Ohne Erinnerungen an WICKED und all das Leid, das ihr hier widerfahren war.
Sie konnte ihr Glück kaum fassen.
Das war’s leider schon. Hier kannst du etwas stöbern.
#maze runner#labyrinth#brandwüste#todeszone#dylan o'brien#thomassangster#ki hong lee#thomas#newt#minho#wicked#wckd#liebesgeschichte#lovestory#fanfiction#wattpad
0 notes
Text
Brotausfahrstory
Szene 1:
Take 1
Zoom vom Baum aus auf Johnny Alina, Resa, Frederik im Garten im Kreis bei Sonnenschein
sitzend.
Take 2
von hinter den personen gefilmt:
Alle erzählen was sie am Tag gemacht haben,
dann erzählt johnny von seinem crazy traum letzte nacht
take 3
johnny beim träumen,
visuals für einleitung der traumsequenz
take 4
beim backhaus: johnny hat schwierigkeiten mit dem bäcker hannes zu sprechen, weil der raum
voller rentner ist, die bei hannes gerade einen backkurs machen. Immer wieder geht johnny rein und
raus für kleine einzelne fragen und muss jedes Mal abwarten bis er Hannes beim erklären am
wenigsten unangenehm unterbrechen kann.
Johnny stellt fest dass das kugelllager zum befestigen des anhängers noch an maries fahrrad zu
hause ist, währenddessen hat auf der straße ein mädchen einen mittwelschweren unfall, wohl arm
gestaucht und fahrradreifen ist verbogen. Allgemeines chaos, indessen johnny möglichst schnell
klären will wie er nun an ein kugellager kommt, bekommt eins von sanne, die auch im backhaus
arbeitet ausgeliehen, dass muss er mit ihr aber wieder tauschen und deshlab am tag drauf vormittags
in den vauban fahren.
Take 4.1
johnny will die kisten auf dne anhänger laden, stellt dann fest das die kisten noch nicht einmal
aufgstellt sind, hannes sagt ihm, dass er es machen muss, johnny ist pissig, aber macht es zügig,
fährt dann los.
Take 5
bei der susi stelt johnny das brot ab, aber kriegt das schloss für den brotkasten nicht mehr zu weil es
klemmt, johnny geht schlechten gewissens und fährt weiter aus
take 6
durch den feierabendverkehr in der wiehre
take 7
hinter kleinen kirche am lycee turenne will johnny den code am zahlenschloss eingeben, aber stellt
fest, dass dieser auf dem papier mit den anweisungen von marie fehlt, also klettert er über die
kirchhofsmauer, wie ein umgekehrter verbrecher und weil das brot noch in ein gartenhäuschen
müssen (zu dessen schlüssel johnny nur mit dem zahlencode zugang gefunden hätte, weil letzterer
ein schlüsselkästchen verschließt) stellt er das brot mit noch mehr schlechtem gewissen vor dem
gartenhäuschen ab, klopft bei der kirche, niemand kommt, also fährt er weiter.
Take 8
in der zugeparkten oberwiehre hält, zwei autos vorne weiter, ein weißer handwerkerwagen mitten
auf der straße, ein mann steigt aus, geht in das bebaustellte haus nebenan und schon stauen sich die
autos hinter johnny. Der mann im wagen vor ihm wird wütend steigt aus und schreitet wutentbrannt
in das haus. Man hört schreie und klirrendes glas und katzengejaul, bis der handwerker zum fensterauf seinen eigenen wagen fliegt und einen abdruck hinterlässt. Der wütende mann kommt aus dem
haus heraus, besteigt kurz den kastenwagen, löst die handbremse und schiebt mit 2 anderen
wutentbrannten wartenden fahrerInnen den kastenwagen in einen SUV, umso platz zu machen, der
verkehr fließt wieder. Indessen sind nachrichtenhubschrauber von der bz am himmel, die versuchen
heruaszufinden was den stau auf der schwarzi verursacht.
Einer fliegt auf johnny zu, vergrößert sich perspektivisch aber nicht, und als er in fliegengröße
neben johnny gesicht herumschwirrt, wedelt dieser ihn angenervt beiseite, der hubschreiber crasht
auf den kastenwagen/SUV, geht in flammen auf, die anderne autos fangen ebenfalls feuer und die
kamera schwenkt wieder auf johnny, während man im hintergrund feuerwehr sirenen hört
take 9
johnny irrt durch das institutsviertel auf der suche nach dem nächsten verteilpunkt, trifft seinen
tanzlehrer und dessen frau undoder assisstentin, johnny sagt sich irgendwas über werner herzog,
dass alles nur witzig und extrem sein muss, denkt irgendwas über zeiten ohne handy, weil er ja auch
kiens hat und deswegen grade den vertielpunkt suchen muss, denkt an gelassenheit, an norbert –
seinen Stiefvater, an hermann hesse, fragt ab und an menschen nach dem feinkosteladen die ihm
nicht weiterhfelfen können.
Dann fällt ihm ein, dass die adresse auf dme zettel sein müsste, stellt fest: ja karlsstraße, findet bald
jemensch welches ihm beim auffinden derselbigen helfen kann und kann endlich dort das brot
entladen.
Take 10
wundersamer weise passiert nichts beim asta, außer einem netten gespräch mit einem mitarbeiter
der gartencoop und johnny wundert sich, ob er sich von ihm gerade eine krankheit eingefangen hat,
ihm hier irgendwas geklaut wurde, oder er sonstiges falsch gemacht hat, was er später noch
feststellen wird.
Take 11
5 meter vor erreichen des verteilpunkts im stühlinger fährt ein junger typ beim überholen in johnnys
anhänger rein, dieser überschlägt sich um 180 grad, johnny kann gerade noch absteigen/-fallen, die
kisten und brote fliegen in alle himmelsrichtungen, es gehen schnell fenster auf und alle menschen
freuen sich über ihr warmes brot.
Johnny ist zuerst sauer auf den jungen typen, dann wird er vom widerschein der sonne in der
kirchturmuhr der kirche im stühlingerpark geblendet, erinnert sich an die einfache freude des
vergebens, gerade dann wenn man allen grund zur wut hat und schenkt dem jungen ein... lächeln!
„Hah, damit hat der nicht gerechnet!“ denkt sich Johnny. „Der dumme sack!“ denkt er sich weiter.
„Sich einfach so mit einem Lächeln abspeisen zu lassen, das sieht ihm ähnlich, diesem normalen
Typen der Dinge tut die jedem mal passieren können!“ Denkt er sich dann noch.
Auf der Fahrt zurück zum Backhaus merkt Johnny, dann dass sein Hinterrad eiert und er sich lieber
mal die nummer von dem typen hätte aufschreiben sollen.
Take 12
zurück beim backhaus fragt hannes wies so war und johnny so:
„Ein Bild kann ein Lächeln einfangen, aber nicht was die Verliebte fühlt, wenn sie es empfängt.
Eine Geschichte kann einen Tag beschreiben, aber wer nicht dabei war, wird ihn nicht gelebt
haben.“ die Kamera zeigt nun Johnny frontal und er spricht weiter „Ein Film läuft vor den Augen
ab, während wir Fahrrad fahren, schreiben, backen und erzählen. Und alles wird zum Film, zur
Phantasie, zum Unantastbaren, aber spürbaren und jeder von uns ist allzeit RegisseurIn.“
Hannes: „Geil man, du hast Magie im Brotausfahrens erfahren, wie sauschön!“ und er hüpft mit
eingezogenen Knien, und gibt Johnny high-five und Umarmt ihn.Take 13
Johnny wacht von seinem komischen Traum auf.
Take 14
Zurück im Garten.
Johnny schließt mit der Erzählung ab „Tja verrückt, oder?!“ Alle lachen, machen noch kleinere
kommentare etc.
dann fragt Alina: Aber wo kamst du denn ebengerade so verschwitzt und fertig her, du WARST
doch heute brotausfahren oder?“
Johnny schaut nachdenklich in die Luft, auf einmal ernst-nachdenklich seitwärts, dreht sich zu
seinem rucksack um, öffnet ihn, darin zwei brote, alle schauen sich gegruselt an
take 15
nachts im mooswald mit regenmänteln und laternen bei gewitter vergraben die 4 die beiden Laibe
und schwören sich nie wieder über diese saukomische geschichte zu erzählen. Sie verlassen die
Stelle. Während sie im blurry hintergrund verschwinden taucht eine dunkle person von hinten vor
der kamera auf. Sie grummelt „Das werden wir mal sehen.“
Sie dreht sich zur Kamera. Es ist Hermann Hesse! Donner! Hermann Hesse lacht diabolisch!
fin
0 notes
Text
Hello Taxi

Eine sehr bewegenden Geschichte.
Wir leben in einer an sich schrecklichen Zeit in der sich kaum Jemand um den Anderen kümmert. In dem GZSZ wichtiger ist als die Kommunikation mit einem anderen Menschen.
Doch auch in dieser Zeit gibt es herausragende Momente und Begegnungen die, wenn man bereit ist darauf einzugehen, unvergesslich sind und bleiben.
Momente die sogar dazu in der Lage sind das eigene Leben zu verändern.
Moment die es Wert sind, das man der ganzen Welt davon erzählt.

Hello Taxi
Die folgende Geschichte erzählt von so einem Moment.
Nimm Dir bitte die Zeit und lese Sie, Du wirst Dich danach bestimmt besser fühlen.
Bitte nehme dir etwas Zeit für diese schöne, kleine Lektion über Geduld.
Dies schrieb ein New Yorker Taxifahrer:
Ich wurde zu einer Adresse hin bestellt und wie gewöhnlich hupte ich als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hupte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende, dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte gebrechliche Stimme sagen "Bitte, einen Augenblick noch!" Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde.
Es verging eine Weile bis sich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillbox Hütte mit Schleier, die man früher immer getragen hat. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940 Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylon Koffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun auch in die Wohnung spiksen. Die Wohnung sah aus als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt. Die Wände waren völlig leer - keine Uhren hingen dort. Die Wohnung war fast komplett leer - kein Nippes, kein Geschirr auf der Spüle, nur hinten der Ecke sah ich etwas. Einen Karton, der wohl mit Photos und irgendwelchen Glas-Skulpturen bepackt war.
"Bitte, junger Mann, tragen sie mir meinen Koffer zum Wagen?" sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zur alten Dame um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig, zum Auto.
Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft.
"Es sei nicht Rede wert" antwortete ich ihr, "Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde!"
"Oh, sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann." erwiderte sie.
Als die Dame in meinem Taxi platzt genommen hatte gab sie mir die Zieladresse, gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten.
"Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg."gab ich zu bedenken.
"Oh, ich habe nichts dagegen ", sagte sie. "Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz."
"Ein Hospiz?" schoss es mir durch den Kopf. Scheiße, Mann! Dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an.
"Ich hinterlasse keine Familie" fuhr sie mit sanfter Stimme fort. "Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lange."
Ich schaltete das Taxameter aus. "Welchen Weg soll ich nehmen?" fragte ich.
Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, indem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus indem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten als sie noch "ein junges, wildes Paar" waren. Sie zeigte mir ein modernes neues Möbelhaus, dass früher "ein angesagter Schuppen" zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen.
An manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute dann einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren?
"Ich bin müde" sagte die alte Dame plötzlich. "Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren"
Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kauf wütiger Makler aus dem Gebäude sondern zwei eilende Sanitäter die, kaum hatte ich den Wagen angehalten, die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt.
Sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet haben.
Und während die alte Dame im Rollstuhl platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz.
"Wie viel bekommen sie von mir für die Fahrt?" fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte.
"Nichts", sagte ich,
"Sie müssen doch ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie.
"Es gibt noch andere Passagiere" erwiderte ich mit einem Lächeln.
Und ohne lange drüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest an sich.
"Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Meter noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. Danke" sagte sie mit glasigen Augen zu mir.
Ich drückte ihre Hand, und ging ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen … Hinter mir schloss sich die Tür des Hospiz. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens.
Meine nächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen - völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden, noch jemanden sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und mies gelaunten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen. Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte. Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre?
Wenn ich an diese Fahrt zurück denke, glaube ich dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben getan habe.
In unserem hektischen Leben, legen wir besonders viel wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer. Schneller. Weiter.
Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen Gesten die im Leben wirklich etwas zählen.
Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben - und nicht sofort hupen - dann sehen wir sie auch.
Aus dem Englischen übersetzt von Markus Brandl
Diese rührende Geschichte erschien heute auf Facebook und weil auch der Uru-Guru mal ein Taxifahrer war kann er diese Situation nachfühlen. Ähnliches ist ihm ja auch schon passiert wie man hier nachlesen kann

Verkehrs Seminare für künftige Unternehmer.
Liebe Grüße aus Uruguay
Peter
Read the full article
0 notes
Quote
Schriftsteller, Philosophen und Menschen, die durch Ihr Denken und ihren Lebenswandel berühmt geworden sind, behaupten, das Leben erhielte seinen Sinn durch Erleuchtung. Auch in David R. Hawkins Buch Power versus Force endet die vorgestellte Skala bei 1000 – der Erleuchtung. Das Leben Buddhas änderte sich komplett, nachdem er die Erleuchtung (also das Licht) empfangen hatte. Ist es also das wonach wir im Leben streben sollen? Oder gibt es vielleicht eine weltlichere Methode, einfache Glückseligkeit im Hier und Jetzt zu erreichen?
Die Esoterikszene profitiert sehr stark vom Reiz, der vom Wort Erleuchtung ausgeht. Damit Du Deiner Erleuchtung näher kommst, musst Du … ! Die meisten Menschen folgen den drei Punkten, was immer dafür steht, ohne groß darüber nachzudenken. Sie geben gerne Geld und guten Willen, wobei es den Urhebern der „Botschaften“ meist um Ersteres geht. Ich gestehe, dass ich selber viele Strategien auf der Suche nach Erleuchtung ausprobiert habe und auch viel Geld dafür investiert habe. Verändert hat sich meine Zielsetzung allerdings durch Erlebnisse, deren inneren Zusammenhang ich lange nicht durchschaute.
Der Erleuchtung ins Auge geblickt
Während eines Aufenthaltes in Nepal besuchten wir an einem Ruhetag einen 86 jährigen Einsiedlermönch. Er lebt zurückgezogen auf fast 4.000 m Höhe, hoch droben über der Siedlung. Seine Hütte schmiegt sich an den steilen Fels. Wir wanderten und kletterten stundenlang, bis wir seine Hütte erreichten.
Vier junge Nonnen kümmern sich um den alten Greis. Wir halfen Ihnen gleich beim Aufhängen der neuen Gebetsfahnen für das kommende Jahr. Gastfreundlich wurden wir mit Tee bewirtet und dann winkte uns der alte Mönch in sein Gemach. Er betete für und mit uns und knotete uns danach seidene Glücksschnüre um den Hals.
Es gab kein direktes Ende seiner Zeremonie, irgendwann sassen wir einfach „herum“. Die Gebetstrommel des Mönchs leierte lautlos, sein Blick lag entrückt in einer anderen Welt. Ich mochte nicht aufstehen, die Stimmung hielt mich im Bann. Ich schloss für einen Moment die Augen und wurde augenblicklich in eine andere Welt geführt.
In mir breiteten sich Gefühle grenzenloser Friedfertigkeit aus. Er, der Mönch strahlte sein Leben aus, teilte es mit mir. Ohne ein Wort zu sagen, floss seine Lehre. Nichts erreichen, bewusstes Sein im Augenblick. Eine weite, friedliche, innere Landschaft voll ergebener Anspruchslosigkeit. War das die Erleuchtung, nach der ich suchte? War das der Zustand des dauernden Glücks, nach dem ich mich sehnte und mein Leben ausrichtete? Die Erfahrung liess mich ratlos zurück, so schön sie auch gewesen war.
Buddha strahlt noch immer
Ähnliches war mir einen Monat vorher in Myanmar passiert. Ich verbrachte Kulturtage in Bagan. Beim Besuch der Shwezigon-Pagode hatte ich mich in eine stille Ecke gesetzt, war einer inneren Stimme gefolgt und hatte „für einen Moment“ die Augen geschlossen. Nach weit über einer Stunde öffnete ich die Augen wieder. Auf die gleiche Art wie in Nepal, hatte sich jene unglaubliche Friedfertigkeit und Anspruchslosigkeit in mir ausgebreitet.
Damals wusste ich nicht, dass die Pagode Reliquien Buddhas enthält. Ein Schlüsselbein, einen Zahn und den gesamten Stirnknochen, also sein drittes Auge. Jeden Tag kehrte ich in die Pagode zurück, um dieses unglaubliche Gefühl der schwebenden Mühelosigkeit, der grenzenlosen Friedfertigkeit und Ausgeglichenheit wieder und wieder zu erlangen.
Wohlgemerkt: in beiden Situationen musste ich nichts tun. Nur sitzen und mich für eine Erfahrung öffnen. Der resultierende Zustand wurde mir geschenkt. Heute wünsche ich mich oft an diese Orte zurück, wenn die Wellen der Aktion wieder einmal über meinem Kopf zusammenschlagen. Beide Erfahrungen helfen mir, besser mit meinem Alltagsleben zurecht zu kommen.
Alltagstauglichkeit der Erleuchtung
So schön, so unwiderstehlich und so hilfreich ich diese Augenblicke finde: für einen Dauerzustand scheinen sie mir untauglich. Schon gleich gar nicht wollte ich sie als ein erstrebenswertes Lebensziel für Dich hinstellen. Es ist wahr, die Welt wäre eine andere, wenn alle Menschen so erleuchtet herumliefen und miteinander lebten. Vielleicht, in einigen tausend Jahren, wird es auch so sein. Bis dahin müssen wir allerdings mit den beschränkten Gegebenheiten unserer „Zivilisationsgesellschaft“ leben.
Ich musste erkennen, dass es für viele Menschen erst einmal nicht um die Erleuchtung geht, sondern darum, die Miete für den nächsten Monat zu bezahlen. Ich muss mich damit abfinden, daß es nicht darum geht, Friedfertigkeit und Anspruchslosigkeit zu erreichen, wenn die aktuelle Beziehungen so vieler Menschen von Missbrauch auf den unterschiedlichsten Ebenen geprägt sind.
Für die Meisten unter uns geht es eben erst einmal darum, Regeln, Tipps und Techniken an die Hand zu bekommen, das aus dem Gleis gelaufene Leben etwas glücklicher zu gestalten. Es geht darum, in einer „Schule des Lebens“ jenes Wissen aufzuholen, das Andere glücklich macht, und das man selber nie erfahren hat. Dafür schreibe ich meine Newsletter! Deine Erleuchtung ist dann später dran. Vielleicht im nächsten Leben, vielleicht ein paar Leben später. Vielleicht.
Generativität
Diese lange „Einleitung“ bringt mich zu einem wichtigen Wort und der damit verbundenen Lebenseinstellung: Generativ. Wenn Du alles, was Dein Leben glücklicher, erfolgreicher und selbstbestimmter macht, öfters wiederholst, dann lebst Du das Wort „generativ“. Wenn Du nach jenen Chemikalien in Deinem Körper süchtig geworden bist, die die Momente des glücklichen Seins in Dir produziert haben, wenn Du mehr DAVON willst, lebst Du generativ.
Lies also meine Artikel. Befolge die Ratschläge, hab Spass mit den Übungen. Und gib nicht gleich wieder auf, wenn es nicht sofort klappt. Den ungeduldigen Besuchern meiner Workhops, die am zweiten Tag ungeduldig fragen, wann denn nun das „neue Leben“ endlich beginnt, denen sage ich: „…es ist schon da, es zeigt sich nur noch nicht!“ In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Du für Dich die „taktischen“ und die „strategischen“ Komponenten der Veränderung in Deinem Leben auseinander zu halten weißt.
Wo soll ich anfangen?
Wenn es Dir JETZT schlecht geht, kannst Du JETZT etwas dagegen unternehmen. Je nach Art sind die Interventionsmechanismen vielfältig. Einen kleinen Trick habe ich in einem Artikel beschrieben. Solche Tipps helfen Dir für den Moment. Du musst Dir allerdings im Klaren sein, dass Du damit diejenigen Strategien in Deinem Leben, die dazu geführt haben, dass es Dir so geht, nur vorübergehend verändert hast.
Es ist in etwa so, wie wenn Du gegen Deinen Kopfschmerz am Morgen eine oder zwei Aspirin nimmst. Die helfen wohl für den Moment, den Kopfschmerz auf Dauer wirst Du allerdings nur loswerden, wenn Du lernst, in Maßen zu trinken. (nur ein Beispiel).
Lerne Symptomveränderung und Ursachenveränderung auseinander zu halten. Ich fühle mich in diesen Artikeln nicht gewappnet, Dir inhaltliche Lebensregeln welcher Art auch immer vorzugeben. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Lebensregeln, die ich für mich gefunden habe, für mein dauerhaftes Glück reichen. Wenn ich Dir ein paar prozessorientierte Verhaltensregeln geben kann, die Du auf die jeweiligen Lebensinhalte anwenden kannst, ist das gelebtes NLP und hilft Dir weiter.
Genauso geht es Dir mit dem zweiten Begriff, der „zunehmenden Selbstverwirklichung“. Ich darf eine der Grundannahmen im NLP zitieren, die sehr gut hierher passt: „Wenn das, was Du tust (taktisch und strategisch Anm. von mir) funktioniert, tue mehr davon. Wenn es nicht funktioniert, tue etwas anderes.“ Das Leben wäre also einfach. Eigentlich.
Kontrolle ist besser
Ein guter Rat, den ich Dir in diesem Zusammenhang gebe: nutze wiederkehrende Ereignisse für eine Art von Nabelschau. Geburtstag, Silvester, Jubiläen, das sind die Ereignisse, die ich meine. Frage Dich: „Bin ich seit dem letzten Mal Nachdenken mit mir selbst weiter gekommen? Hat sich mein Leben zum Positiven verändert?“ Und ich wünsche Dir, dass Du diese Fragen mit „JA“ beantworten kannst. Wenn nicht, siehe oben.
Tage, Wochen, selbst Monate sind ein zu kurzer Zeitabschnitt, um obigen Fragen zu beantworten. Früher, als meine negativen Programmierungen noch die Oberhand hatten, habe ich mich verzweifelt gefragt, ob „diese Zustände“ denn gar nie aufhören wollen. Die kleinen Schritte der Veränderung sind im Lärm des Alltags nicht einfach auszumachen. Es braucht oft etwas Abstand, um sie klarer zu erkennen. Deshalb: „Halte durch. Ich glaube an Dich, tu DU es auch!“
Wenn Du die letzten Newsletter gelesen hast, wenn Du Bereiche in Deinem Leben herausgefunden hast, die Veränderung brauchen, wenn Du Dich entschlossen hast, mit anderem Verhalten zu experimentieren und wenn Du dies auch umsetzt, DANN, das kann ich Dir versichern:
Es wird sich etwas zum Positiven verändern.
Wenn Du dabei bleibst und Deine Strategien dauerhaft variierst und veränderst (davon handeln ja meine Artikel), dann wird sich Erfolg mit Sicherheit einstellen. Das verspreche ich Dir! Auch wenn dieser Erfolg nach drei Minuten noch nicht so sichtbar ist, wie Du ihn gerne gehabt hättest.
Da ist noch eine der großen Herausforderungen für Dich im Leben: Geduld. Vielleicht steckst Du Dir Deine Ziele zu hoch, fasst den Zeitrahmen zu kurz. Halte es nicht mit Konrad Adenauer, dem man die Aussage in den Mund schiebt, dass erreichte Ziele zu niedere Ziele wären. Es braucht auch in Deinem Leben die Freude über den Erfolg, Dein Ziel erreicht zu haben.
In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Freude über Deine Erfolge. Mag es vielleicht auch sein, dass diese Erfolge anfangs erst in Minischritten messbar sind: „Eine jede Reise beginnt eben mit dem ersten Schritt!“. Ich wünsche Dir, dass Deine Reise, mit den vielen schönen Orte, die Du unterwegs besuchst, nie aufhören wird.
Dieser Artikel ist Teil der Serie „Fünf Regeln für ein glückliches Leben“:
Fünf Regeln für ein glückliches Leben: Einführung
Führe Dein Leben, vollständig gesund und energetisch!
Führe Dein Leben im harmonischen Verhältnis mit Dir und … !
Führe Dein Leben in Unabhängigkeit!
Führe Dein Leben mit bedeutsamer Beschäftigung!
Führe Dein Leben mit zunehmender Selbstverwirklichung!
Der Beitrag Lebensziel: Erleuchtung ??? erschien zuerst auf kikidan: NLP & Hypnose.
https://www.kikidan.com/news/regel-5-fuehre-dein-leben-generativ-und-mit-zunehmender-selbstverwirklichung.html
https://www.kikidan.com/news/regel-5-fuehre-dein-leben-generativ-und-mit-zunehmender-selbstverwirklichung.html
0 notes
Text
Verstand und Gefühle, Großherzogin Auguste hat Geburtstag und ein Löwe auf dem Gendarmenmarkt – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
Das neue Jahr hat begonnen. Und vielleicht möchte man manches besser machen als im vergangenen. Zum Beispiel sich besser um sich selber kümmern, sodass es einem selber und auch anderen besser geht. Wie das vielleicht gehen kann, das zeigen die ersten beiden der fünf Deals der Woche, die im E-Book-Shop www.edition-digital.de eine Woche lang (Freitag, 05.01. 18 – Freitag, 12.01.18) zu jeweils stark reduzierten Preisen zu haben sind. Im ersten kommt eine REIKI-Meisterin und REIKI-Lehrerin zu Wort und im zweiten lädt eine Entspannungstrainerin dazu ein, dem Alltagsstress zu entkommen. Zwei Wege, ein glücklicheres Leben zu führen und somit kein schlechter Anfang für ein neues Jahr, oder?
Die anderen drei Angebote des aktuellen Newsletters führen mehr oder weniger weit in die Vergangenheit zurück und zwar in das 19. und in das 20. Jahrhundert. So erlaubt Heinz Kruschel Einblicke in das nicht unkomplizierte Leben einer jungen Frau in der DDR der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Mit der Geschichte des Schweriner Schlosses von seiner Einweihung im Mai 1857 bis zum großen Schlossbrand im Dezember 1913 befasst sich Renate Krüger. Und mit einem literarischen Kunstgriff verschafft Joachim Lindner dem Leser Gelegenheit zu einer außergewöhnlichen Begegnung mit E.T.A. Hoffmann und seiner Zeit. Wer war E.T.A. Hoffmann? Und wo und vor allem wie hat er gelebt? Siehe weiter unten. Dort erfahren Sie mehr. Aber zunächst zurück zum besseren Leben – heute.
2003 brachte Karin Hinse im Scheunen-Verlag Kückenshagen ihr Buch „Die Zweiflerin. Erlebnisse einer Reiki-Meisterin und Reiki-Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern“ heraus: Wer hat das nicht schon erlebt? Unzufriedenheit mit sich, seinem Mann, seiner Frau, den Eltern, Kindern, Freunden. Kurz mit allem, was das Leben ausmacht. Schnell ist der tägliche Stress als Verursacher gefunden. Aber wie dem Stress entgehen? Die Suche beginnt. Dieses Buch wendet sich an alle, die auf der Suche sind. Männer und Frauen. Es beschreibt humorvoll, verständlich und leicht nachvollziehbar die Suche nach einem Weg, der zu Ausgeglichenheit, innerer Harmonie, Gesundheit, Lebensfreude und heiterer Gelassenheit führt. Ihren eigenen Weg dorthin schildert in verblüffender Offenheit die Autorin, eine REIKI-Meisterin und REIKI-Lehrerin. Sie schildert ohne Wenn und Aber die Zweifel und Irrungen, die falschen Wege aber auch die richtigen Entscheidungen, die sie auf den Weg zu REIKI geführt und dann darauf begleitet haben. Ein Buch für alle, die ebenfalls suchen, jedoch noch nicht wissen, wonach eigentlich. Machen Sie es sich gemütlich, lehnen Sie sich zurück und gehen Sie mit auf die Suche. Sie werden sich schon beim Lesen entspannen, auch schmunzeln, weil Sie sich vielleicht in der einen oder anderen Situation erkennen, nachdenklich werden und möglicherweise auch Ihren persönlichen REIKI-Weg finden. Und hier ein kleiner Ausschnitt auf dem Wege zu REIKI:
„Wir Menschen neigen dazu, alles erklären und verstehen zu wollen. Ich bin da ein exzellentes Beispiel. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin froh, dass wir Menschen diesen wundervollen Verstand haben und ihn auch nutzen. Noch schöner wäre es, wenn wir ihn auch klug nutzen würden. In jeder Beziehung. Wir haben aber auch Gefühle, Empfindungen und Ahnungen. Diese werden nur allzu oft von unserem Verstand in den Hintergrund gedrängt. Ein gleichberechtigtes Miteinander findet selten statt und Entscheidungen, aus dem Bauch heraus getroffen, werden allzu oft als Sentimentalität abgetan. Sehr oft habe ich mir das Leben schwer damit gemacht, sehr viele Tränen geweint – und doch nicht verstanden, warum. Darauf werde ich später noch ausführlich eingehen.
Was aber ist denn nun Reflexzonenmassage? Das Verfahren genau zu erklären, ist nicht meine Absicht. Es gibt im Fachhandel zahlreiche Bücher mit sehr guten Anschauungsbildern und Übungen zur Selbstanwendung. Wer tiefer einsteigen möchte, ist gut beraten, sich ein solides Ausbildungsinstitut zu suchen. Hier nur ein kleiner Überblick: Reflexzonen sind Nervenpunkte, die mit einer andern, von diesem Punkt entfernten Körperstelle in Verbindung stehen. Im ganzen Körper finden wir Reflexzonen. Sehr viele davon in den Füßen. Das hat einen guten Grund. Von Natur aus war vorgesehen, dass der Mensch barfuß geht und dann beim Gehen über Stock und Stein seine Reflexzonen in den Füßen aktiviert. Der Erfindungsgeist des Menschen und sein Hang zur Bequemlichkeit hat aber unsere Umwelt verändert. Der Boden ist nicht mehr uneben, sondern flach gewalzt und asphaltiert. Hinzu kommt das Schuhwerk. Durch jahrelanges Einzwängen wurde die Blutzirkulation unterbunden. Die Folge davon sind nicht nur kalte Füße, sondern auch schlecht durchblutete Reflexzonen.
Durch die Massage der Reflexzonen erreichen wir eine bessere Durchblutung derselben und des zugehörigen Organs. Die Durchblutung ist aber für jedes Organ lebenswichtig, denn das Blut ist das Transportmittel für sämtliche Aufbaustoffe, den Sauerstoff, die Hormone, die Abwehrstoffe und für die Abbauprodukte. Wir sollten bedenken, dass sämtliche Störungen oder Verletzungen im gesamten Organismus nur über die Durchblutung ausgeheilt werden können! Die Reflexologie ist eine sehr dankbare Methode. Einerseits geeignet, den Heilungsprozess zu beschleunigen, andererseits ein sehr gutes Mittel zur Vorbeugung. Zudem bringt eine derartige Massage sofortige Entspannung.
So viel erfuhren alle Teilnehmerinnen im Schnellüberblick und waren überzeugt. Danach „schwebten“ wir wie auf „Wolke Sieben“ mit leichten Füßen Richtung Heimat. Zuhause musste sich mein lieber Mann meinen Erlebnisbericht anhören. Nicht nur das. Neugierig geworden, hielt er mir seine Füße entgegen und ich hatte sogleich einen Probanden gefunden! Später habe ich ernsthaft überlegt, ob mein Mann nach dieser Massage süchtig geworden ist. Listig wurde ich häufig gefragt, ob ich nicht wieder einmal üben müsse. Natürlich habe ich dieses großzügige Angebot dankbar angenommen. Sein an einen Kater erinnerndes Schnurren war mein Lohn. Und ich konnte Erfahrungen sammeln. Neben dem nun wöchentlich einmal stattfindenden Unterricht hatte ich hier die Möglichkeit, das Erlernte praktisch umzusetzen. Ich bekam mehr und mehr Sicherheit, die feinen Unterschiede bei Verhärtungen der Fußsohlen festzustellen. Sehr gut konnte ich die Auswirkungen beobachten und somit die Zusammenhänge besser verstehen. Auch andere Familienmitglieder forderten die ihnen ihrer Meinung nach zustehende Fußmassage ein. Und weil Neinsagen noch nie meine Stärke gewesen ist, wurden auch alle bedient.“
2013 erschienen bei der EDITION digital das Buch und das E-Book „Wunderkind der neuen Zeit. Erfolgreich entspannt – „beglücklicht“ durchs Leben“ von Susanne Christa Hüttenrauch. Die Autorin selbst schreibt über ihr Buch Folgendes: „Meine Arbeit als Entspannungstrainerin erlaubt es mir, mich ganz auf die vielfältige Entspannungslehre einzulassen. Jedoch bemerkte ich schon früh, dass die Teilnehmer meiner Seminare darüber klagten, dass sie mit ihren Übungen irgendwann ohne wirklichen Grund aufhörten. Dies beleuchtete ich näher und entdeckte, dass einige Entspannungstechniken keine echte Motivation freisetzten, um sie nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Also forschte ich im Selbstversuch, um eine Möglichkeit zu finden, gezielter dem Tagesstress zu entkommen. Ich erkannte, dass der ehrliche Umgang mit unseren Emotionen der Schlüssel war und fing an zu beobachten, wann und in welcher Situation meine Gefühlswelt ins Wanken geriet. Diese Erkenntnis war der Durchbruch, den ich brauchte, um eine geeignete Form zu entwickeln, die sofortige Resultate brachte. Die Methode der Gedankenreise bot mir eine Plattform, um selbst kreierte Bilder entstehen zu lassen, die umgehend für emotionales, mentales und körperliches Wohlgefühl sorgten. Lieber Leser, ich lade Sie ein, sich Ihren ganz persönlichen Themen zu widmen, um endlich eine Form der Erlösung, Selbstverwirklichung und der tiefen inneren Zufriedenheit zu spüren. Erkennen Sie Ihr wahres Selbst durch das Praktizieren der Gedankenreisen und leben Sie Gelassenheit, Optimismus und neue Lebensfreude getreu dem Motto: Nur ein entspannter Mensch ist ein glücklicher Mensch! Katapultieren Sie sich selbst in den Olymp der inneren Zufriedenheit! Ihre Susanne Christa Hüttenrauch“
Hier ein paar Gedanken darüber, wie man dem persönlichen Labyrinth entkommt:
„Habe ich eine Wahl, diesem Labyrinth zu entkommen, oder führt mich mein weiterer Lebensweg immer tiefer in die Verstrickung hinein?“ Lassen Sie diese Frage einige Zeit auf sich wirken! Fühlen Sie Unbehagen, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen? Trauen Sie sich weiterzugehen, um eine Antwort zu erhalten? Wird sie Ihnen gefallen und wenn ja, was tun Sie dann? Bevor wir starten, atmen Sie bewusst tief ein und aus! Lauschen Sie wieder in sich hinein! Werden Sie ruhig und halten Sie Abstand! Sie sind Ihr stiller Beobachter bei jedem weiteren Erkennen Ihres Selbst!
Die Erkenntnis befreit: Nachdem wir die Kindergartenzeit einigermaßen unbescholten überstanden haben, beginnt nun ein weiterer, sehr prägender Lebensabschnitt. Die Schulzeit! Voller Freude stürzen wir uns in dieses Abenteuer, vieles lernen zu wollen, was uns eine glückliche Zukunft verspricht. Schon früh wird uns erklärt: „Du lernst fürs Leben. Also streng dich an, damit etwas aus dir wird und du nicht auf der Straße landest …“ Diese Worte motivieren uns zu Höchstleistungen und spornen uns an, wirklich fleißig zu sein, schließlich will keiner von uns auf der Strecke bleiben …Das westliche Belohnungssystem ist im vollen Gange! Die Einführung des ersten Taschengeldes knüpft geschickt bestimmte Erwartungen an unsere Verhaltensweisen an. Zumal gute Noten uns einige Extrataler einbringen, denn wir funktionieren nach wie vor so, wie es von uns verlangt wird. Es wird uns etwas gezeigt, und wir machen es nach … Wir mutieren langsam zu einer Kopie der äußeren Gesellschaft mit ihren Werten und Normen ohne weiter zu hinterfragen, und es sieht so aus, als wenn es der richtige Lebensweg für uns wäre.
So zu sein, wie alle anderen auf der Straße des Lebens. Riskante Überholmanöver werden sogar gewünscht und bringen uns dem Ziel des erfolgreichen Abschlusses ein Stück näher. Wir erkennen, dass Konkurrenzdenken und -verhalten die Wegweiser zum Olymp der Welt sind! Freudlosigkeit, Faulheit und jede Form der Lernschwäche halten nicht stand, und Sanktionen werden durch Pädagogen und Eltern verhängt. Schlechte Schulnoten, Ignoranz unserer Mitmenschen, schmerzlicher Liebesentzug und sogar der Ausschluss aus dem Kollektiv sind „die Haftstrafen dieses Fehlverhaltens“. Dem vermittelten Wissen die bedingungslose Aufmerksamkeit zu zollen und alles Gelehrte für wahr und echt zu befinden, brav im Systemrad zu strampeln, bestimmen unseren täglichen Lebensinhalt. Selbst die wissbegierigen, schlauen Kinder, die sich in der Schule langweilen und aufmüpfige Züge entwickeln, fallen in ihrer Beliebtheit zurück. Einfach jede Form des Aufbegehrens ist nicht gewollt und wird nicht toleriert. Diese Störenfriede werden als sogenannte „Schwarze Schafe“ der Familie tituliert und als fehlerhaftes Programm unserer Eltern angesehen, und dabei wollen wir doch nur unsere Einzigartigkeit leben können.
Wir wollen hinterfragen, ausprobieren und selbstständiges Entdecken entwickeln. Wir wollen verstanden und so geliebt werden, wie wir eben sind. Ein geborenes Original! Wir verstehen, dass, was dem einen Spaß und Freude bereitet, nicht das ist, was uns ein beschwingtes Glücksgefühl beschert. Dafür fühlen wir enormen Druck, Schmerz und ständiges Leid, wenn wir gegen unsere innere Natur ankämpfen. Das Funktionieren nach äußeren Einflüssen lässt uns im Inneren ein unterschwelliges Unwohlsein spüren, das uns ständig begleitet. Doch solange wir dies für uns selbst nicht erkennen und denken: „Ah, so fühlt sich also die Welt an!“ und es geschehen lassen, werden wir niemals unsere Originalität leben können. Wir eifern unseren Eltern nach, auch dann, wenn wir schon lange aus dem Hause sind und unsere eigene Familie haben. Wir laufen durchs Leben mit anerzogenen Verhaltensweisen und einem Job, der uns ernährt, jedoch selten glücklich macht. Wir tun eben das, was unsere Eltern von uns erwarten … Karriere, Häuschen, schickes Auto und vieles mehr, was einzig und alleine dazu dient, den materiellen Lebensstandard hochzuhalten. Diese elterlichen Erwartungen projizieren wir dann wiederum auf unsere Kinder und Kindeskinder, weil wir es nicht besser wissen. Schließlich tun Eltern nur dies, weil sie uns lieben und nur das Beste für uns wollen. Ob unsere Ausbildung, unser Studium oder Beruf nun genau das ist, was wir uns wirklich wünschen und konform mit unseren Vorstellungen ist, mögen wir zwar bezweifeln, doch dagegen angehen kommt überhaupt nicht in Frage. Die elterliche Anweisung, was gut für uns ist, wird befolgt, und oft verstecken sich dahinter vertane Chancen von Mutter und Vater, die sie eben gerne selbst in ihrer Jugend gelebt hätten. Um sie somit nicht noch mehr zu enttäuschen und ihre Entscheidung in Frage zu stellen, springen wir auf den Berufszug der Eltern auf und benutzen ihre Schienen in eine glückliche Zukunft. Ein ewiger Kreislauf von falschen Illusionen und Wünschen für das eigene Leben entsteht. Wir laufen blind durchs Leben und merken es noch nicht einmal, dass wir die Vorstellungen und Erwartungen anderer erfüllen. Nur damit wir in die Norm passen und nicht unangenehm auffallen und unsere Eltern uns auch weiterhin lieb haben.“
Erstmals 2006 veröffentlichte Renate Krüger in einer Online-Ausgabe „Das Schloss im Feuerschein. Eine Geschichte um das Schweriner Schloss“: Die Autorin schildert anschaulich die Feierlichkeiten zur Einweihung des umgebauten Schweriner Schlosses am 26. Mai 1857, den 35. Geburtstag der Großherzogin Auguste an diesem Tag, die erste Filmvorführung im Goldenen Saal, Petermännchens Warnung und schließlich den verheerenden Schlossbrand. Aber schauen wir erst mal auf die Zeit vor dem Einzug, besser gesagt auf einen Tage vor dem Einzug:
„Endlich ist es soweit! Ein großes Fest wird es geben. Morgen zieht die großherzogliche Familie mit ihren hohen Gästen in das fertige Schloss ein.
Morgen, am 26. Mai 1857.
Auch die Schweriner Kinder sind voller Erwartungen. Auf dem Markt hat sich ein ganzer Trupp versammelt, viele in Holzpantinen. Es knallt ordentlich auf dem Kopfsteinpflaster. Auf dem Markt ist heute Birkengrün zum Schmücken der Häuser verteilt worden, kostenlos. Bürgermeister und Rat waren großzügig. Die Stadt soll so schön wie möglich aussehen. Vor den grünen Hügeln gab es Gewühl, jeder wollte, soviel er tragen konnte. Die Kinder waren schnell zur Hand: „Sall ick helpen?“ Jede kleine Münze war willkommen. In so mancher Hosentasche klimpern Dreier und sogar Sechser. Und nun erst morgen! Ein Junge mit blauer Schirmmütze, die Hände bis zu den Ellenbogen in den ausgebeulten Taschen, weiß ganz genau, wie es sein wird. „Hier kommen sie längs! Und vorher stehen sie am Paleh in der Neustadt und versammeln sich. Da können wir zwischen gehen, da kriegen wir was. Und dann wieder von den Leuten, die an der Straße stehen und Hoch! schreien, wenn der Großherzog kommt. Und die Großherzogin. Bloß die Schandarmen vorne weg, die mögen uns nicht!“ „Betteln?“, fragt ein Mädchen und verzieht die Nase.
Langsamen Schrittes kommt ein Stadtpolizist aus dem Rathaus und sieht sich auf dem Marktplatz um. Es gefällt ihm gar nicht, dass sich die große neue Fahne in den mecklenburgischen Landesfarben blau-gelb-rot am Kirchturm verheddert hat. Da wird er wohl noch einmal die vielen Stufen hochsteigen müssen. Und warum hat der Straßenkehrer den Abfall von den Birkenzweigen nicht zusammengefegt? Und was haben die Kinder hier zu suchen? Die machen doch immer nur Unordnung. Schmeißen Papier auf die Straße, betteln die Leute an. Morgen sollen die Schweriner Straßen aussehen wie das blitzblanke Parkett im Schloss. Morgen ist es soweit. „Macht, dass ihr hier wegkommt!“, donnert der Polizist. „Und lasst euch ja morgen hier nicht sehen!“ Die Kinder nehmen Reißaus auf Strümpfen, damit es schneller geht, die Holzpantinen in der Hand. Der Stadtpolizist ist zufrieden. Auch mit den geschmückten Häusern in der Königsstraße, durch die sich der Festzug bewegen wird. Die Regierungsgebäude in der Schlossstraße sehen besonders prächtig aus. Auf dem großen Platz vor dem neuen Schloss sind Spritzenwagen dabei, den Sandboden zu befeuchten, damit es nicht staubt.
Frisch, neu und sauber steht das Schloss auf seiner Insel im Schweriner See. Drinnen legen fleißige Dienstleute letzte Hand an, damit morgen jeder Winkel blitzt und glänzt, damit man auch vom Fußboden essen kann, wie der Schlosshauptmann von Lützow befohlen hat. Na, das muss wohl ein Witz sein, denn wem von den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften käme es schon in den Sinn, vom Fußboden zu essen, und sei er auch noch so schön mit farbigen Hölzern ausgelegt! Die Herrschaften speisen ja nicht einmal wie normale Leute von gewöhnlichen Tischen, bei denen heißt es Tafel. Jeder bekommt eine goldgedruckte Speisekarte, damit er auch genau weiß, was er isst. Die Speisen sind so vornehm, dass die Küchenleute ihre Namen nicht richtig aussprechen können, der Oberhofkoch ausgenommen, der war in Frankreich, um es an Ort und Stelle zu lernen. Auf ihren Bohnertuchschuhen gleiten die Dienstleute durch die Säle, als schwebten sie. Sie spiegeln sich im Glanz des Parketts, aber ihre graubraune Arbeitskleidung ergibt kein besonders interessantes Bild. Doch morgen zieht der Großherzog in sein neues Schloss ein, und die vielen goldgestickten Uniformen und die Rüschen und Pelzverzierungen an den Damenroben werden sich vorteilhafter spiegeln.
Es wird ja auch allmählich Zeit für das neue Schloss. Wie lange ist der Bau nun schon im Gang? Fünfzehn Jahre mindestens. Nur die älteren Schweriner können sich noch daran erinnern, wie das alte Schloss ausgesehen hat. Eigentlich sollte ja ein ganz neues und ganz anderes Schloss gebaut werden, solch ein niedriges, neumodisches, breit hingelagert und ohne Türme. Es sollte an einer ganz anderen Stelle stehen, nämlich auf dem Alten Garten, gleich neben dem Theater. Angefangen hatte man schon damit, doch dann war der Großherzog Paul Friedrich plötzlich gestorben, und sein Sohn und Nachfolger ließ die Fundamente einfach liegen.
Was soll das denn auch - ein Schloss ohne Türme! Großherzog Paul Friedrich war eine Seele von Mensch, schade, dass er so früh sterben musste, aber von Schlössern hatte er keine Ahnung. Da ist unser junger Großherzog Friedrich Franz denn doch ganz anders und weiß, was seine Schweriner brauchen: das alte Schloss im neuen Glanz. Ein so prächtiges Bauwerk ist in Mecklenburg schon lange nicht errichtet worden. Es wird Zeit, dass man wieder etwas vorzuweisen hat.“
Erstmals 1982 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig der Roman „Leben. Nicht allein“ von Heinz Kruschel: „Renate Jago ist eine erfolgreiche junge Frau: Sie hat ihr Journalistikstudium abgeschlossen, in der Redaktion bieten sich ihr alle Aufstiegschancen, die sie unbekümmert nutzt. Sie lebt mit der kleinen Tochter Suse allein — nicht mit Suses Vater, dem verheirateten Riska, nicht mit dem Bildhauer Friedrich Perr, den sie einmal liebte. Sie will auf eigenen Füßen stehen, sie will ihre Ziele erreichen, ohne kräftezehrende Bindungen. Da geschieht etwas, das ihr ganzes bisheriges Leben verändert, alle Zukunftspläne in Frage stellt: Suse verunglückt tödlich. Wie soll Renate nun weiterleben? Wie sollen sich die anderen gegenüber dem maßlosen Leid verhalten? Taugt Arbeit als Therapie? Oder wäre ein Kind von Riska eine Lösung? Heinz Kruschel erzählt vom schwierigen Weg Renates aus der Isolation hin zu einem Leben — nicht allein. Aber vorerst sind wir am Anfang – des Romans und bekommen einen ersten Eindruck von der Heldin des Buches und von der Zeit, in der seine Handlung spielt:
„Vera Severin erschrak doch, als die junge Frau den Sekretär nicht weiterreden ließ. Denn nach dem Programm, das durchgesprochen und beschlossen worden war, hätte er weiterreden müssen. Aber Renate Jago sprach, unter dem beifälligen Gemurmel der Erwachsenen, selber weiter, und zwar frei. Es war so, als habe sie diesen Sekretär, ihren Vorgesetzten doch, schon abgelöst von seiner Funktion, als habe sie über ihn das Urteil gesprochen: Du bist fehl auf deinem Platze. An dem Tage lernte Vera Severin, Journalistin und verantwortlich für die Unterhaltungsbeilage der Tageszeitung dieser Gegend zwischen dem Mittelgebirgsrand und den Flüssen, die der Elbe zuflossen, Renate Jago kennen. Die Jago war eine Frau von zwanzig Jahren. Schwarze Haare, offen auf schmalen Schultern liegend, von fester, kleiner Gestalt. Sie rauchte stark und sprach schnell. Für Vera war sie irgendeine Mitarbeiterin in irgendeinem Bereich der Leitung des Jugendverbandes.
Renate Jago stand hinter dem Sekretär, einem dicken jungen Mann, der eine rote Mappe unter dem Arm hielt und sehr aufgeregt war. Klasse um Klasse marschierte auf. Wimpel und Fahnen flatterten in dem frischen Wind, der von der Elbe her über die Wiesen wehte. Die Kinder waren aufgeregt. Sie hatten das Aufmarschieren geübt, den Ablauf des Appells, sie hatten sich die Kommandos eingeprägt. Alles war oft geprobt worden, und dennoch waren sie neugierig geblieben. Neugierig auf die Ehrengäste. Zum Beispiel auf die alte Frau, die mit dem Manne zusammengelebt hatte, dessen Namen ihre Schule tragen sollte. Neugierig auf den roten Sergeanten, der den Mann einmal befreit hatte, vor vierzig Jahren. Der Gedenkstein noch verhüllt, auch die Schrift an der Stirnseite der Schule. Trommeln und Lautsprecher übertönten das Hundegebell im Dorf. Die Musiklehrerin dirigierte mit ausholenden Armbewegungen einen kleinen Chor. Aber das Lied flog schnell hinweg in den Wind. Es war viel zu dünn, um den weiten Platz zu füllen.
Vera Severin sah die Gesichter der Kinder: so erwartungsvoll. Diese großen Augen, so ernst. Diese schönen, offenen Gesichter, hoffentlich werden sie nicht enttäuscht. Für die Kleinen aus den ersten und zweiten Klassen hatte man Bänke hingestellt. Vera wusste, dass sie sich erst dagegen gewehrt hatten. Sie wollten wie die Großen stehen, auch wenn es Stunden und Stunden dauern sollte. Nun saßen sie aufgereiht, die Knie aneinandergepresst. Das Lied konnten sie nicht verstehen, dennoch blieb in ihnen die Vorfreude wie eine Brücke in Unbekanntes. Vera Severin stand in der zweiten Reihe, hinter der alten Frau, die ihren hellen Mantel offen trug, und hörte, wie sie den Direktor leise fragte: „Können denn nicht alle Kinder gemeinsam ein Lied singen? Früher, da ...“ Mehr konnte sie nicht verstehen, weil aus den Lautsprechern Lieder und Märsche dröhnten. Die alte Frau schüttelte den Kopf. Ihr dünnes, weißes Haar bewegte sich im Wind wie zartes Geseide.
Oder die Hymne, dachte Vera Severin, seit Jahren singen wir unsere Hymne nicht mehr, weil der Text nicht mehr zeitgemäß ist, weil zwei Staaten mit ganz unterschiedlichen Systemen auf deutschem Boden existieren, weil der Staat des Gestern das Deutschland-einig-Vaterland deuten würde zu seinen Gunsten, ummünzen zu seinen Forderungen, dienlich machen seinen Zielen, die Geschichte zurückzudrehen. Aber unser Land, dachte Vera, hat doch seine Dichter, es hätte einen neuen Text geben können, eine Hymne muss man singen, so aber stehen unsere Sportler als Sieger stumm auf den Podesten, wenn AUFERSTANDEN AUS RUINEN UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT ertönt, und halten die Lippen geschlossen.“
1990 ging die Geschichte des im vorigen Roman beschriebenen Staates zu Ende. Im selben Jahr 1990 veröffentlichte Joachim Lindner im Verlag der Nation Berlin erstmals seine Erzählung über den Kammergerichtsrat und Dichter E. T. A. Hoffmann „Die Frucht der bitteren Jahre“: Wer war E.T.A Hofmann? Wo und vor allem wie hat er gelebt? Auf ungewöhnliche Weise nähert sich Joachim Lindner in diesem Buch dem Menschen und Künstler, seinem Leben und seiner Kunst. Im Frühjahr 1882 wird ein Berliner Student, der mit Hoffmann verwandt ist, gebeten, Briefe seines Vetters wortgetreu abzuschreiben. Auf diese Weise gelingt es dem Autor, die Lebensstationen Hoffmanns zwischen Königsberg und Berlin, seine politischen und künstlerischen Auffassungen, aber auch seinen persönlichen Mut, sich für Recht und Gerechtigkeit einzusetzen, auf literarische Weise dazustellen. Gottlieb, so der Vorname des Berliner Studenten, lernt wie der Leser E.T.A. Hoffmann sehr viel genauer und ganz anders kennen als es das häufig in der Öffentlichkeit herumschwirrende Zerrbild vom ewig betrunkenen Gespensterdichter vorgibt – eine Einladung, dem wirklichen Hoffmann näher zu kommen. Bemerkenswert ist ein Vorspruch des Autors zu seinem Buch: „Die Personen sind bis auf eine, die einer Erzählung Hoffmanns entlehnt wurde, historisch verbürgt. Ähnlichkeiten sind nicht zufällig, sondern, soweit es im Vermögen des Verfassers stand, angestrebt.“ Und schon befinden wir uns nicht mehr im Jahre 2018, sondern fast 200 Jahre früher und zwar in Berlin und lernen dort einen jungen Mann kennen, einen Studenten:
„An einem Märzmorgen des Jahres 1822, einem der ersten frühlingshaften Tage jenes Jahres, verließ ein junger Mann sein Quartier in der Berliner Friedrichstraße, um seinen Vetter, den Kammergerichtsrat Hoffmann, zu besuchen. Sein Weg führte durch jenes Stadtviertel, das, in wenigen Stunden zerstört und in vier Jahrzehnten wieder aufgebaut, heute nahezu so aussieht wie zu des Kammergerichtsrats Tagen — ein Wunder, das ihn kaum in Erstaunen versetzt hätte, da er in seinen Erzählungen die guten und nützlichen, mehr noch die schlimmen, unheilvollen Seiten moderner Entwicklung erahnt und vorweggenommen hat.
Aber niemand, selbst sein leiblicher Vetter nicht, glaubte ihn ernst nehmen zu müssen, sodass dann die spätere Wirklichkeit die Fantasie des Dichters weit übertraf. Was er schrieb, meinte der junge Mann, mochte gut und ergötzlich sein, jedenfalls lasen es die Leute gern; ihm indessen, dem Studenten der Rechte an der Berliner Universität, lag mehr an der Unterhaltung des geistreichen und witzigen Mannes, so bissig und spöttisch er mitunter auch sein konnte.
Eben deswegen war er an jenem sonnigen Märzmorgen unterwegs zum Gendarmenmarkt, einem der schönsten Plätze Altberlins, mit Schinkels Theater in der Mitte, flankiert von den Türmen der deutschen und französischen Kirche. Dort, an der Ecke Tauben- und Charlottenstraße, im Hause des Geheimen Obersteuerrats von Alten, wohnte sein Vetter, der Kammergerichtsrat und Dichter E. T. A. Hoffmann. Als gewandter Zeichner und Karikaturist hatte er das belebte Viertel sehr anschaulich auf einer Skizze festgehalten und sie dem jungen Mann gezeigt, den er wie den Studenten aus dem Goldnen Topf Anselmus nannte, obwohl er Gottlieb hieß und mit jener merkwürdigen Figur nichts gemein haben wollte, die sich teils in der wirklichen, teils in einer imaginären Welt aufhielt. — Zugutezuhalten war es Hoffmann, dass es sich um ein Märchen handelte, wenn auch aus neuer Zeit; und nicht die märchenhaften Züge irritierten Gottlieb, sondern wie Hoffmann mit der Wirklichkeit umsprang. Warum machte er sich über so brave und biedere Leute wie den Konrektor Paulmann oder den Registrator Heerbrand lustig und zog ihnen den geheimen Archivarius Lindhorst vor, den er doch selbst einen wunderlichen, merkwürdigen Mann nannte?
Wie mit dieser und manch anderer Erzählung konnte sich Gottlieb auch mit des Vetters Skizze vom Gendarmenmarkt bei allem Respekt vor dessen Zeichenkünsten nicht recht befreunden, denn auch dort schienen ihm Wirklichkeit und Erfindung, Reales und Fantastisches auf eine nicht geheure Art gemischt. Dass sich auf den Straßen rings um den Platz, wie Hoffmann ihn dargestellt hatte, dessen Freunde und Bekannte aufhielten, fand er ganz amüsant: Da näherte sich in flotter Fahrt der Baron Fouqué in seiner hochherrschaftlichen Kutsche den Ständen der Gemüseweiber vor der deutschen Kirche; dort, in der Markgrafenstraße, begegnete Ludwig Tieck, gefolgt von Clemens Brentano, seinem Schwager Bernhardi. Der Vetter selbst fehlte nicht, am Fenster seines Arbeitszimmers stehend, unterhielt er sich mit dem aus dem Nachbarfenster blickenden Schauspieler Ludwig Devrient, seinem Freund und Zechbruder, wie man ihn wohl nennen musste. Doch was sollte es, dass er gleichzeitig im Schlafkabinett neben seiner Ehefrau Mischa lag?
Immerhin konnte man es gelten lassen, und vielleicht auch, dass er, als Komponist, Kapellmeister und Theaterenthusiast mit den Vorgängen im Schauspielhaus eng vertraut, wie durch die Mauern hindurch in das Innere des Musentempels zu blicken vermochte und genau wusste, was sich zur Mittagszeit, wie die Theateruhr anzeigte, dort zutrug. Im Direktionszimmer empfing eben der Intendant Graf Brühl drei Dichterlinge, die ihm devot ihre Manuskripte darboten, während sich vor dem leeren Parkett mehrere Damen und Herren mit weit aufgerissenen Mündern im Chorgesang übten und im Theaterrestaurant der schwergewichtige Kapellmeister Anselm Weber ein volles Tablett in beiden Händen vor sich hertrug. Doch wer war das schmächtige Männchen, das ihn gelassen und mit verschränkten Armen erwartete? Kein anderer als der Kapellmeister Kreisler aus Hoffmanns Erzählungen, der ihm überdies zum Verwechseln ähnelte. Und schaute man genauer hin, dann wimmelte es auf den Straßen von Figuren aus dem Reich der Dichtung. Abgesehen davon, dass nicht einzusehen war, was ein Löwe und ein Vogel Strauß zur Mittagsstunde auf dem Gendarmenmarkt zu suchen hatten nebst einem auf dem Giebel des Schauspielhauses herumturnenden Affen — war es merkwürdig, ja absonderlich, dass sich Erasmus Spikher aus den Abenteuern der Silvester-Nacht, der Doktor Dapertutto mit der Kurtisane Guilietta Arm in Arm auf der Straße bewegten, als gehörten sie ebenso dorthin wie die gestikulierenden Juden, der mit geschultertem Gewehr zur Wachablösung marschierende Soldat oder der Anonymus, der in der Nähe des Kammergerichts seine Notdurft verrichtete.
Kein Wunder, dass auch der Student Anselmus, die lange Pfeife schmauchend, am Bildrand erschien und dicht neben dem großen Klecks Chamissos Peter Schlemihl, wie immer ohne Schatten. Der Vetter war ein Schelm und trieb ein verwirrendes Spiel mit dem braven Bürger, auf der Skizze genauso wie in seinen Erzählungen. Auch ihn, den Studenten Gottlieb, verspottete er gern und oft so lange, bis ihm das Blut zu Kopf stieg. Dennoch zog es ihn immer wieder zu dem seltsamen Mann, dem an seinen Besuchen gelegen zu sein schien, besonders, seitdem er krank war und die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Die Beine versagten ihm den Dienst, sodass der sonst so lebhafte und bewegliche Vetter an den Lehnstuhl gefesselt war. Das ertrug er mit großer Fassung und litt mehr unter einem geistigen Versagen, das damit verbunden war. Er vermochte nämlich nicht mehr seine wie eh und je wie aus einem Quell sprudelnden Gedanken und Einfälle zu Papier zu bringen, und zwar nicht, weil ihm die Finger den Gehorsam versagten, sondern weil die Gedanken, sobald er sie schriftlich fixieren wollte, wie Rauch im Wind zerstoben.“
Und vielleicht wirkt dieses Buch wie eine Einladung, sich (wieder) einmal ausführlicher und gründlicher mit Leben und Werk dieses außerordentlich vielseitigen Künstlers der Romantik und kämpferischen Menschen E.T.A. Hoffmann zu befassen, der seine eigentlichen Vornamen Ernst Theodor Wilhelm 1805 in Anlehnung an den von ihm bewunderten Wolfgang Amadeus Mozart in Ernst Theodor Amadeus änderte.
Hoffmann starb am 25. Juni 1822 in Berlin an den Folgen einer schweren Krankheit, die am Tage seines 46. Geburtstages am 24. Januar 1822 an seinen Füßen und Beinen begonnen hatte, ihn zunehmend lähmte und rasch vorangeschritten war. Und so konnte er eine Verteidigungsschrift wegen eines ihm vorgeworfenen Dienstvergehens nicht mehr mit eigenen Händen schreiben, sondern nur noch diktieren. Gleiches gilt für eine Reihe letzter Erzählungen, darunter „Des Vetters Eckfenster“, welche am 14. April 1822 vollendet wurde und die erstmals vom 23. April bis 4. Mai 1822 in Symanskis Blatt „Der Zuschauer. Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung“ erschienen war. Johann Daniel Symanski war ein deutscher Jurist, Journalist und Literat und wie Hoffmann ein gebürtiger Königsberger. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.
Von Hoffmanns Nachlass ist leider manches nicht mehr auffindbar. Ansonsten aber ist Hoffmann auf jeden Fall immer wieder eine (Neu) Entdeckung wert …
Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/edition-digital/news/3889 sowie http://edition-digital.de/Specials/Preisaktion/.
Über EDITION digital Pekrul & Sohn Gbr:
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books Bücher über Mecklenburg-Vorpommern und von Autoren aus dem Bundesland heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen.
Pressekontakt:
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Gisela Pekrul
Alte Dorfstr. 2 b
19065 Pinnow
Deutschland
03860 505788
[email protected]
http://www.edition-digital.de
#schweriner schloss#renate krüger#reiki#kindstod#joachim lindner#heinz kruschel#entspannung#e.t.a.hoffmann
0 notes
Text
Chapter 5
“Und Dr.Freeman wie macht sich unsere Truppe?”, “Sehr gut Sir. Sie sind auf dem Weg nach Helena.”, gab der Blondschopf von sich und tippte auf seinem PC herum Freeman war Professor einer Universität in Harvard.
Wesker hatte die besten Leute zusammen getrommelt.
“Sehr gut. Mal sehen ob sie es schaffen:”, meinte Wesker und grinste als er uns den Monitor blickte wo wir zusehen waren.
Wesker hatte sich in Umbrellas Überwachungsnetz gehackt.
Wir stoppten vor der Tür meiner Adoptivmutter.
“Ok, das ist jetzt mein Part.”, gab ich von mir und sah in die Runde.
Ich holte Luft und war unglaublich nervös.
“Du schaffst das.”, meinte Anoe. “Wir decken dir den Rücken.”.
Ich nickte und wollte gehen, doch griff Jonathan mein Arm.
Ich sah ihn an. “Ich weiß zwar noch nicht ganz was ich von diesem außerirdischen Gerede halten soll..aber..sollte dir was passieren… ..”.
Er sah mir in die Augen. Seine andere Hand ließ ein paar meiner Haarsträhnen durch seine Finger gleiten. “Dann folge ich dir…in den Tod.”,wisperte er und meinte das toternst
Ich sah ihn verlegen an. Mein Herz pochte wie wild.
“Ich werde nicht sterben Unsere Körper sind feinstofflicher, nicht so dicht wie die der Menschen So leicht sterben wir nicht.”,meinte ich und kam ein Schritt näher. Ich legte meine Arme um seinen Hals und beugte mich zu seinen Lippen.
“Wenn das vorbei ist…heiratest du mich dann?” hauchte ich ihm entgegen.
Er legte seine Hände auf meine Hüften. “Ist das nicht noch zu früh Liana?”, hauchte er zurück und beugte sich zu meinen Lippen.
Er wusste selbst dass es nicht zu früh war. Es war nur sein Körper der es vergessen hatte, unsere Seelen waren schon vorher zusammen es war ja nichts Neues. Es war nur für ihn noch neu weil er sich nicht mehr an sich erinnerte.
“Ich will dich als Mensch heiraten und wenn wir Zuhause sind nochmal.”.
Ich verlor mich in ihn und küsste ihn sinnlichst Jonathan erwiderte den Kuss.
Löste ihn aber darauf wieder “Geh jetzt.” .Ich nickte und wandte mich ab.
Ich ging zur Tür und holte nochmals Luft. Die anderen 4 versteckte sich.
Ich öffnete die Tür. Helena stand mit dem Blick zum Fenster.
Sie drehte sich um und war einwenig überrascht..
“Wie bist du daraus gekommen?”, “Ich hatte Hilfe.”, gab ich ernst von mir.
Sie kam auf mich zu. “So? Von wem denn?”, “Als wenn ich die Person verraten würde.”. Sie ging um mich herum.
“Verstehe.”. Sie stoppte wieder vor mir.
“Nun denn…dann muss ich dich wohl willenlos machen.”.
Sie hob ihre Hand und wollte mich anfassen, doch griff ich ihren Arm und hielt ihn gut fest. “Fass mich nicht an!”, “Du bist ganz schön stark für ein Mädchen:”, “Das steckt uns Plejadier im Blut!”. Ich drückte fester zu, dass es ihr wehtat. “Noch fester?”, drohte ich ihr.
Sie verzog das Gesicht einwenig. “Ich habe dich unterschätzt..”, meinte sie noch und ich ließ sie los. Sie wich zurück.
“Aber dennoch kann ich dich überlisten!”, “Kannst du das ja?”.
Wir sahen uns beide in die Augen. “Reden wir doch lieber über den Grund wieso du so bist wie du bist….Mum.”, “Der Grund brauch dich nicht zu interessieren!”, “Oh doch das tut es aber! Menschen tun nicht grundlos solche Gräueltaten! Also was hast du erlebt? Strenge Erziehung? So wie du es mir vorgelebt hast? Schläge? So wie du es bei mir getan hast?”, “Das brauch dich nicht zu interessieren.”, antwortete sie kühl und hielt ihre Fassade aufrecht.
Ich versuchte es weiter auf sie einzureden, doch blockte sie ab..
Dann holte sie einen Stein aus ihrer Hosentasche hervor und benutzte ihn. Er besaß Magie. Ich knallte gegen die Wand.
“Du willst also den Grund wissen?”. Sie kam auf mich zu und hockte sich vor mir. Eiskalt sah sie mir in die Augen. “Ich war ein unsicheres Mädchen gewesen, ,dass immer brav tat was ihre Eltern wollten, doch egal wie lieb ich war, wurde ich für bestraft Mit Gewalt jeglicher Art!”. Sie griff meinen Hals und drückte ihn leicht. “Ich werde diese Welt in eine Welt tauchen die mehr Bedeutung hat. Wo man mir zuhört und sich mir fügt!”, “Du wirst doch nur benutzt von den Dunklen! Sie sind nicht daran interessiert einem Menschen die Macht zugeben!”, keuchte ich und rangte nach Luft..
“Ich weiß dass sie mich benutzen, aber dasselbe tue ich mit ihnen Ihre Macht zu Nutze machen und sie dann zu töten!”. Ich sah sie verzweifelt an.
“Du kannst doch noch immer die sein die du wirklich bist. Deine Eltern haben dich vielleicht nicht so akzeptiert, aber es gibt sicher andere die dich so mögen wie du bist!”, “Nein, es gibt niemanden…nichtmal Constance. Sie hat mich verraten.”. Sie drückte fester zu.
“Hat mich mit meinem Mann betrogen, deinem Adoptivvater. Ohjja das sieht man Arthur nicht an nicht wahr? Er war immer so nett zu allen, als würde er niemanden was zu Leide tun. Doch dann habe ich ihn mit meiner besten Freundin erwischt. Weißt du eigentlich dass Jonathan seine Eltern ermordet hat?”, “Ja das weiß ich, ich habe ihn beobachtet. Ich weiß alles über ihn.”, “Ach wirklich?”. Sie drückte noch fester zu. Ich bekam kaum noch Luft.
“Auch dass er mit seiner Schwester geschlafen hat?”. Ich hielt inne.
Meine Augen weiteten sich. Dass er eine Schwester hatte wusste ich, aber dass er mit ihr was Intimes hatte, das hatte ich nicht mitbekommen.
“Oh das tut weh nicht wahr? Er hat es sogar fast noch mit ihr getrieben als ihr euch wiedergefunden habt. Mensch sein verändert einen.”, “Er ist immer noch derselbe der er Zuhause ist.”, “Wirklich? Tötest und foltert er oben auch andere Wesen und schläft mit seiner Schwester?”.
Ich schluckte. Meine Hände griffen ihr Handgelenk, ich versuchte ihre Hand von meinem Hals los zu bekommen. “Als Mensch sind wir nicht direkt wie Zuhause, aber wir sind immer noch dieselbe Seele, wir haben denselben Charakter. Nur unsere Erfahrungen auf der Erde verändern uns einwenig.”.
Ich riss sie los von mir und stand auf. Rasch eilte ich ein paar Schritte von ihr weg. Helena richtete sich ebenfalls wieder auf.
“Du kannst nicht leugnen dass es dir nicht wehtut wenn du das hörst dass er Sex mit seiner Schwester hat! Und vorallem dass er während ihr zusammen ward fast mit ihr geschlafen hat!”. Ich stand nur verwirrt da. Wusste nicht was ich dazu sagen oder was ich darauf denken oder fühlen sollte.
Sie kam wieder auf mich zu. “Du bist so naiv wenn du glaubst dass er sich für dich interessiert! Liebe existiert nicht!!” Sie wollte mich wieder attackieren, doch dann richtete ich meine Hände auf sie und schleuderte Wasser in ihre Richtung. Sie flog durch den Raum und knallte gegen die andere Wand, der Stein lag darauf weit von ihr entfernt. Somit war sie angreifbar.
Ich kam auf sie zu und sah sie an. Sie erwiderte meinen Blick verhasst.
Ich erinnerte mich an Jonathans und Vergils Worte, dass man Menschen manchmal nicht anders helfen kann als sie zu töten.
Doch ich zögerte. Sie griff nach meinem Fuß und grinste finster.
“Ich werde dich brechen! Du wirst genauso schwarz werden wie ich! Dein Licht soll nicht mehr leuchten!”. Ich sah sie nachdenklich an.
Ich zögerte einen Moment, dann holte ich Luft. “Jonathan.”, rief ich.
Die Tür öffnete sich und die 4 stürmten herein.
Ich schaffte es nicht sie zur Vernunft zu bringen. Es gab keinen anderen Ausweg für sie.
Helena sah kühl zu den anderen und richtete sich auf.
“Die Nervensäge. 5 gegen einen, ist das nicht etwas ungerecht?”.
Ich hob darauf den magischen Stein auf. “Es ist ungerecht was du vorhast.”, gab ich von mir. “Unschldige Menschen zu versklaven! Menschen die dir nie etwas getan haben!” ,”Oh niemand ist unschuldig Schätzen! Alle haben was Böses getan! Jeder von ihnen! Sie sollten alle dafür bestraft werden.”.
Ich wich dann zurück und stellte mich neben Jonathan.
Ich schluckte und zögerte dann aber öffnete ich meinen und sprach es aus.
“Töte sie.”. Anoe sah mich entsetzt an.
Jonathan richtete darauf die Waffe auf Helena.
Er hatte keine Probleme Menschen zu erschießen.
“Guckt weg wenn es euch zu unangenehm ist.”, meinte er zu Anoe und mir.
Anoe grif meinen Arm, zog mich zu sich und wir sahen beide weg.
Jonathan legte den Finger auf den Abzug.
Helena sah uns wütend an. “Das würdet ihr noch büßen! Ich bin nicht die EInzige die die Welt vernichten will!”, meinte sie noch und Jonathan schoss.
Er traf sie direkt in die Stirn. Helena sank zu Boden. Das Blut verteilte sich über diesen und sie starb sofort.
Der Alarm ging darauf los.
“Wir sollten schnell weg hier:”, meinte Vergil.
Ich sah darauf zu Helenas Leiche. Sie war meine Adoptivmutter. 3 Jahre hatte ich bei ihr und Arthur gelebt. Nun war sie tot, genau wie Arthur.
Anoe zog mich schon mit. “Nymph komm!”. Ich folgte den anderen aus dem Raum. Wir liefen durch das Gebäude und wir versteckten uns immer wieder mal, da viele Dunkle durch die Gänge stürmten um uns zu suchen.
Wie kamen schließlich in der Einganghalle an.
Dort waren jedoch viele von ihnen. Wie sollten wir an denen vorbei?
Plötzlich warf eine Granate in die Mitte des Raumes und sie explodierte. Die Wesen starben und keiner war mehr im Weg.
Skeptisch und überrascht sahen wir uns um, wir kamen aus dem Versteckt hervor. Ein großgebauter und muskelöser Typ kam darauf auf uns zu.
“Hey, ich soll euch abholen.”, “Abholen?!”, gab Anoe von sich.
“Ja, Albert Wesker möchte euch sehen.”, “Und wer bist du?”, gab Anoe skeptisch von sich. “Chris, Chris Redfiel.”. Er lächelte.
“Also dann, folgt mir.”, “Moment mal! Wer sagt dass wir mitkommen?!”, “Wesker.”, “Und wieso sollten wir das tun?”, “Er will euch nur einmal sehen, danach könnt ihr gehen.”, meinte Chris. Anoe seufzte.
“Na schön.”. Wir folgten Chris darauf hinaus und zu dem Helicopter mit dem er gekommen war. Kurtis jedoch stoppte davor. “Ich habe noch was zu erledigen.”, “Willst du nicht mitkommen?”, fragte Anoe. “Nein, ich muss noch was wichtiges erledigen. Wir sehen uns.”, meinte er noch und ging dann.
“Er ist eh nicht so wichtig, Wesker wollte auch nur euch 4 sehen. Der Kerl war nur zufällig hier.”, meinte Chris und wir stiegen alle ein.
Er schloss die Tür und der Flieger hob ab.
So saßen wir nun dort drin. Rachel und Vergil saßen neben Chris auf der Bank gegenüber von Jonathan und mir..
Anoe musste sich erstmal von dem ganzen Schrecken erholen.
Jonathan griff darauf meine Hand. Ich war etwas überrascht und sah zu ihm.
Er blickte ebenfalls zu mir. Doch als ich ihn ansah erinnerte ich mich an Helenas Worte was seine Schwester anging und sah weg.
“Was ist?”, fragte er. “Nichts.”, meinte ich nur. Er merkte jedoch dass ich was hatte. Er strich mit der anderen Hand eine Haarsträhne hinter mein Ohr.
“Du kannst mir alles sagen Liana.”. Ich zögerte und sah ihn dann wieder an.
“Schläfst du mit deiner Schwester?” Er sah mich nun auch überrascht an, dann hielt er inne. “Ich habe… . Veronica und ich….haben beide keine Liebe erfahren und als wir uns fanden…da versuchte wir uns diese Liebe gegenseitig zu geben die uns fehlte. Es war nicht wie bei dir….dass es wirklich Liebe war. Es war nur eine Suche nach Liebe, ein Moment…wo wir zufrieden waren als wir Sex hatten. Aber das ist vorbei…ich kann mit keiner anderen Frau mehr schlafen als mit dir.”., flüsterte er mir darauf ins Ohr.
Ich wurde verlegen und mir wurde ganz warm. Ich lehnte mich darauf an ihn und schloss die Augen. .Meine Hand drückte die seine.
“Ich liebe dich” sagte ich es nun das erste Mal zu ihm als Jonathan.
“Ich liebe dich auch…Liana.”, meinte er dann und gab mir einen Kuss auf den Kopf.
Anoe lächelte zufrieden als sie uns sah. Vergils saß gelangweilt links von ihr und Chris, der seine Waffe pullierte rechts von ihr.
Anoe sah ihn darauf schief an “Rennst du immer mit Waffen herum?”, “Ja, es ist mein Job.”, “Ach echt? Das heißt du tötest auch ja?”, “Wenn es sein muss ja. Als die Zombies los waren habe ich eine Menge davon abgeschossen.”,, “Zombies?”, “Ja infizierte Menschen, die mit dem T-Virus infiziert waren.”, erklärte Vergil ihr darauf.
Jonathan und ich hörten den dreien einwenig zu.
“Wenn es stimmt was du sagst.. .”, fing er darauf an und sah mich an.
Ich erwiderte seinen Blick. “…wie nahe stehen wir uns da wo wir herkommen?”.
Ich grinste. “Das ist doch klar. So nah wie hier. Wir lieben uns, weil wir zusammen gehören. Es gibt keinen perfekteren Partner für uns.”
“Sind wir dort verheiratet?”, “Nein noch nicht. Wir waren noch Jugendliche, naja ich, du schon ein junger Erwachsener als du gegangen bist. Wenn du zurückkehrst dann wird man uns vermählen. Man wird nur mit seinem Seelenpartner verheiratet.”, gab ich von mir und sah ihm dabei in die Augen.
Er verlor sich in den meinen. “Ich will dir das so gerne glauben.” wisperte er und legte eine Hand auf meine Wange eh er sich wieder zu meinen Lippen beugte.
Das alles klang zu schön für ihn, da er soviel Gewalt erlebt hatte als Mensch.
Er küsste mich wieder zärtlich. Ich erwiderte den Kuss.
Vergil seufzte. “Kleben die immer aneinander?”, beschwerte er sich.
Anoe grinste. “Lass sie, es ist eben Liebe, das wovon du keine Ahnung hast”. Er sah sie mit gehobener Augenbraue an. “Ich und keine Ahnung davon? Glaube mir ich weiß was Liebe ist!”, “Ach wirklich? Was denn?”, “Die Fürsorge zueinander.”, “Du weißt nicht was Liebe ist.”, grinste Anoe und amüsierte sich über ihn. “Weiß ich wohl! Vielleicht weißt du es ja nicht!”,”Wer weiß. Finde es raus.”. Sie grinste ihn an. Vergil sah ihr in die Augen. Aufeinmal wurde ihm so anders. Er sah schnell wieder weg. Chris sah zu den beiden und pullierte immer noch seine Waffe. “Ihr scheint euch ja gut zu verstehen.”, “Ja wir sind die besten Freunde”, scherzte Anoe. .”Als wenn!”, mischte sich Vergil ein der eingeschnappt war. Der Helicopter setzte zur Landung ein, es wurde holprig.
“Schön sitzen bleiben!”, gab Chris von sich. “Ne weißte ich stehe jetzt auf!”, erwiderte Anoe.
Schließlich landete der Vogel und wir stiegen aus.. Chris führte uns in ein großes Gebäude. Es war wirklich riesig.
In der Eingangshalle kam ein großer, breiter blonder Mann mit Sonnenbrille auf uns zu. “Willkommen! Ich hoffe ihr hattet einen angenehmen Flug.”, begrüßte er sie. “Den hatten wir.”, meinte Anoe sofort und sah sich um, dann sah sie wieder zu ihm. Sie spürte dass seine Aura ebenfalls nichtmenschlich war.. Sie war sofort skeptisch. “Wieso sind wir hier?”, “Oh weil ihr gute Arbeit geleistet habt. Ich wollte euch belohnen.”, “Belohnen?”. Anoe hob eine Augenbraue in die Höhe.
“Ja belohnen, aber dazu kommen wir später. Ich führe euch einwenig rum. Ihr könnt eine Weile hier bleiben.”, “Haben wir aber nicht vor! Wir wollte nur Hallo sagen.”. Anoe war recht skeptisch. Wesker lächelte und blieb gelassen.
“Da draußen sind noch immer die Dunklen! Sie sind nun auf der Jagd nach euch. Ich würde mir das nochmal gut überlegen ob ihr nach Hause wollt.”.
Er wandte sich ab. “Folgt mir.”. Wir setzten uns in Gang und liefen ihm nach.
“Ich habe kein gutes Gefühl dabei! Er hat eine nichtmenschliche Aura”, flüsterte Anoe mir zu. Ich nickte nur “Vielleicht ist er ja ein nettes unmenschliches Wesen.”, flüsterte ich zurück.
Wesker zeigte uns sämtliche Räume. Labore, Büros und so weiter und zu guter Letzt unsere Gästezimmer “Ihr könnt euch aussuchen wer mit wem in ein Zimmer geht.”, “Ich gehe sicher nicht mit einem Fremden in ein Zimmer.” gab Anoe von sich und sah zu mir. “Aber okay du willst sich bei ihm bleiben.”. Dann fiel ihr Blick zu Vergil. Sie griff ihn am Oberteil und riss ihn schon mit in eines der Zimmer. Chris lächelte nur und wandte sich dann ab da seine Arbeit erledigt war.
Wesker sah zu Jonathan und mir. “Jonathan Crane, wie schön dich mal persönlich kennenzulernen”. Jonathan erwiderte seinen Blick kühl.
“Freut mich nicht wirklich mit ihnen Bekanntschaft zu machen.”, “Das macht mir überhaupt nichts….Scarecrow.”. Jonathan warf ihn nur weiter einen kühlen Blick zu. Ich zog Jonathan darauf schon in das andere Zimmer da ich bemerkte wie es in ihm brodelte. Wesker wandte sich dann ab und ging.
Wir waren somit allein in unseren Zimmern.
“Was erlaubt der sich?!”, kam es gereizt von Jonathan.
Ich schloss die Tür und ging zu ihm. “Shhh!”, sagte ich und legte meinen Zeigefinger auf seine Lippen. Er sah mich an. Ich nahm den Finger wieder weg.
“Reg dich nicht auf. Wir finden sicher noch raus ob er nett oder fies ist Aber hier sind wir erstmal sicher.”, “Ich traue ihm nicht!” Ich seufzte und wandte mich ab.
Ich ging zu dem großen Fenster das von der Decke bis zum Boden reichte.
Es hatte einen weißen Rahmen. Man konnte direkt in den Garten blicken, welcher grün war. Es war ein wirklich schöner Anblick, fast wie Zuhause.
Ich versank dadurch in Gedanken.
Jonathan kam zu mir und umarmte mich von hinten.
“Woran denkst du?”, fragte er mich und flüsterte es mir ins Ohr. Er biss leicht an meinem Ohrläppchen.
“An Zuhause. Dort ist es genauso schön, nur noch schöner.”.
Ich löste mich von ihm und wandte mich ihm dann ganz zu indem ich mich zu ihm umdrehte. “Dort waren wir viel in der Natur Wir haben viel gelacht und getanzt….am See. Wir haben gekuschelt und uns geküsst.”. Ich wurde leicht rot.
Er musste darauf lächeln. “Haben wir das?”,”Ja. Wir waren ständig zusammen als man uns vorgestellt hat. Ich habe mich auch öfters mal nachts aus meine Zimmer geschlichen. Du standest unten und hast mich aufgefangen. So hoch sind die Stockwerke bei uns nicht. Es sind keine Häuser wie hier, es sind so eine Art Koppeln.”, “Und dann? Was haben wir dann gemacht?”
Er strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Ich versank in Gedanken und im Rausch dieser Gefühle zu ihm.
“Wir sind dann oft in den Wald…haben uns auf eine Lichtung gelegt und den Himmel beobachtet. Wir waren frei. Wir konnten machen was wir wollten Selbst wenn meine Eltern mich mal erwischt haben, sie waren nie erzürnt wie es hier der Fall ist wenn man nicht hört. Sie schütteln nur den Kopf und lachen dann.”.
Ich sah ihm tief in die Augen. “Wir waren uns immer wieder verfallen.”.
Er lächelte noch immer und beugte sich dann zu meinen Lippen.
“Ein schöner Gedanken..Nymph.”, gab er von sich und nannte mich das erste Mal bei meinem richtigen Namen. Worauf mein Herz noch höher schlug.
Ich wurde leicht rot im Gesicht.. Er legte seine Lippen auf die meine und ich erwiderte dies. Meine Arme legten sich um seinen Hals und seine Hände legten sich auf meine Hüften. Er zog mich näher zu sich und wir verloren uns in dem Kuss.
“Wir müssen hier wegkommen! Der Kerl hat irgendwas vor!”, meinte Anoe und war gereizt. Sie starrte aus dem Fenster und sah sich die Gegend draußen etwas an. Vergil lag chillig auf einem der beiden Betten.
“Lass uns doch erstmal zur Ruhe kommen. Du weißt sicher wie gefährlich die Dunklen werden können.”, “Sicher weiß ich das!”. Sie drehte sich gereizt zu ihm um. “Sie haben ja den Heimatplaneten meiner Freundin zerstört!”, “Siehst du,auch dass wir hier erstmal sicher sind.:”,”Klar! Und dann enden wir als Versuchskanninchen für irgendwelche Laborexperimente! Ich gehe! Ob du willst oder nicht! Ich hole Nymph und Jonathan und dann verschwinden wir von hier!”.
Sie stiefelte auf die Tür zu und hatte sie fast erreicht. Sie wollte nach dem Türgriff greifen.
Vergil stand auf und ging auf sie zu Er griff ihren Arm.
“Die beiden wollen sicher für sich sein.. Lass sie doch erstmal.”.
Anoe wandte sich ihm zu. Sie kochte förmlich. “Wir verschwenden hier Zeit während dieser Kerl irgendwas mit uns plant! Nein ich gehe!”.
Sie versuchte sich loszureißen. Vergil riss sie jedoch zurück und sie landete in seinen Armen. Sie sah darauf automatisch zu ihm.
Vergil sah sie ernst an. “Wenn der Kerl was vorhat, dann werden wir uns schon zu wehren wissen! Ich bin ein Dämon, du und deine Freundin sind Aliens und der Freund deiner Freundin ist ein Schwerverbrecher mit einem Angstgast.”, “Woher weißt du was Jonathan kann?”, “Ich habe von ihm gehört.”, “Du kanntest ihn?!”, “Ja, vom hören. Er ist ja nicht unbekannt als Scarecrow.”. Anoe riss sich dann los.
Sie seufzte. “Na schön, dann lass uns aber wenigstens…rumschnüffeln!”, “Gut, wenn du dann zur Ruhe kommst.”. Beide verließen darauf das Zimmer.
Jonathan und ich taumelten schon Richtung Bett.
Er drang wieder mit seiner Zunge in meinem Mund ein.
Seine Hände fuhren unter mein Oberteil. Und ich fing an ihn von seiner Krawatte und Anzugsjacke zu befreien. Wir landeten auf dem Bett.
Ich über ihn. Jonathan löste den Kuss kurz und sah mich an.
Sein gut gestyltes Haar hing einwenig wirr herum durch seinen Sturz.
Ich lächelte und griff ihn darauf in das dichte Haar.
“So schön weich.”, “Gefallen sie dir?”, gab er von sich. “Ja.”, wisperte ich.
Er packte mich darauf und tauschte mit mir die Position dass er über mir war.
Er stand darauf wieder auf und schnappte sich seine Krawatte die am Boden lag.Ich hatte mich derweil richtig hingelegt dass ich auf dem Kopfkissen lag mit dem Kopf.
Jonathan kletterte wieder über mich. Er griff meine Hände und platzierte sie wieder über meinen Kopf. Er nahm seine Krawatte und fesselte mich dieses mal ans Bett fest, da es ein Bett war mit Gitter.
Ich musste leicht grinsen und biss mir auf die Unterlippe.
Jonathan wandte sich mir darauf wieder zu.
“Damit es aufregender wird für dich.”, meinte er noch eh meinen Hals anfing zu küssen. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und schloss die Augen, ließ mich voll und ganz gehen. Seine Hand strich dabei über meinen Oberkörper. Über meinen Bauch und dann über meine Seite.
Es prickelte wie verrückt in mir und mir entwich ein Keuchen durch seine intensive Nähe.
Er beugte sich zu meinen Lippen und küsste sie wieder.
Während wir unser Liebesspiel spielten, waren Anoe und Vergil im Keller des Gebäudes angekommen.
Beide schlichen sich durch die Gänge.
Als sie jedoch Wachposten sahen, versteckten sie sich in eine Art Abstelltkammer wo es sehr eng war. Sie stand direkt an ihn dran gedrückt.
“Hier muss man ja echt aufpassen wo man hintritt.”, meinte sie nur und sah zu ihm auf. Vergil erwiderte ihren Blick. “Hier kann man nirgendswo hintreten.”, “Ja das weiß ich auch.”, “Dann sage doch nicht dass man hier aufpassen muss wenn man sich hier nicht bewegen kann!”. Sie sah ihn gereizt an.
Der Blick der beiden fiel wieder zur Tür, sie lauschten.
Anoe hörte sein Herz pochen da sie ein gutes Gehör hatte.
Irgendwie lenkte es sie von der eigentlichen Mission ab. Warum wusste sie nicht. Ihr Blick fiel automatisch wieder zu seinem Gesicht.
Er sah sie ebenfalls an aus Reflexe
In dem Moment war es als wäre bei beiden ein Funke rübergesprungen.
Sie näherten sich beide von ganz allein wie Magneten und beide Lippenpaare trafen aufeinander. Anoe lege ihre Arme um seinen Hals und presste ihren Körper noch enger an sich. Vergil küsste sie intensiver und legte seine Arme widerum um ihren Körper.
Sie vergassen vollkommen die Mission die sie hier hatten und knutschten erstmal miteinander rum. Anoe kam dann aber wieder zur Besinnung und löste den Kuss wieder. Sie räusperte sich. “Wir ähm….sollten uns auf unsere eigentliche Mission konzentrieren”, “Ja du hast Recht.”, meinte er und beide sahen wieder zur
Dann aber sah sie ihn wieder an, er blickte erneut wieder aus Relexe zu ihr und Anoe brannten die Sicherungen durch. Sie griff seine Jacke, drängte sich ihm auf und küsste ihn noch stürmischer als vorhin. Er konnte ihr darauf nicht wiederstehen und erwiderte das Ganze. Sie fingen an wild rumzukntuschen und sich mit den Händen gegenseitig zu berühren.
Jonathan und ich genossen derweil unser Liebesspiel ebenfalls.
Wir züngelten miteinander und er strich weiter über meinen Körper, bis er mit seiner Hand wieder zu meiner Hose wanderte und anfing mich dort zu verwöhnen. Ich keuchte und stöhnte leicht.
Er löste den Kuss und küsste mich wieder am Hals. Seine Hand rieb immer fester. Ich biss mir auf die Unterlippe.
Jonathan biss mir leicht ins Ohrläppchen. Ich keuchte vor mir her.
Es war einfach so schön. Ich wollte nicht dass es endete.
Und diese Bettspielchen waren noch aufregender. Vorallem mit ihm zu erleben.
Er sah mich darauf an. Ich erwiderte seinen Blick, verlangte nach ihm.
Ich wollte ihn küssen. Nicht seine Lippen, seine Wange, seinen Hals.
Doch ich konnte es nicht weil er nicht so nah an mir dran war.
Jonathan küsste mich wieder auf meine Lippen. Er war mir darauf wieder so nah gewesen dass ich den Kuss lösen konnte und den Spieß umdrehte.
Ich fing an seine Wange zu küssen. Jonathan musste lächeln.
Er sah mich darauf wieder an. Seine Hand verließ meinen Schritt und er befreite mich darauf von den Fesseln weil er wusste dass ich auch ran wollte.
So tauschten wir wieder die Position und er war unter mir.
Ich sah ihn mit Rotschimmer im Gesicht an.
“Nicht so schüchtern, nur ran, traue dich.”, gab er von sich.
Ich zögerte kurz, dann beugte ich mich zu seiner Wange und küsste sie, eh ich zu seinem Hals wanderte. Es war solange her wo ich das getan hatte.
Seine Hände griffen die meine und sie umfassten sie.
Ich erwiderte dies und spürte noch mehr starke Gefühle ihm gegenüber durch diese Berührung. Das Händedrücken war für mich ein Zeichen von vereint sein. Der Ausdruck tiefer Liebe.
Jonathan genoss was ich tat und hatte ebenfalls die Augen geschlossen.
Als ich mich aber von seinem Hals wieder löste und ihn ansah öffnete er sie wieder. Er löste seine Hände von meinen und legte seine Hand an meinen Hinterkopf eh er meinen Kopf zu sich runter druckte und mich verlangend auf die Lippen küsste, immer und immer wieder. Ich wollte nicht mehr von ihm ablassen. Wir fingen an uns gegenseitig zu entkleiden und letztenendes schliefen wir wieder miteinander. Wir vergassen alles andere um uns herum.
Vergil und Anoe lösten sich voneinander als sie fast vollständig nackt obenrum waren. “Wir….sollten uns auf unser Problem konzentrieren.”, meinte sie nervös und war einwenig überfordert mit der Situation. Vergil grinste leicht und zog sich wieder an. “Wir können es ja heute Abend nachholen.”, “Was? Nein…das… .”, “Sei doch nicht so verbissen Rachel. Dir hat es doch gefallen.”, “Ja hat es aber….du bist ein Dämon.”, “Ja und? Ich bin kein böser Dämon! Jedenfalls nicht dir gegenüber.”. Anoe hob eine Augenbraue und zog sich wieder an.
Als sie beide wieder vernünftig angezogen waren schlichen sie sich aus dem Raum. Die Luft war rein. Dann schlichen sie sich weiter umher, auf der Suche nach Beweisen… .
….continue…
0 notes
Text
Schottland: Edinburgh und Inverness
Die letzten Tage meines North Coast 500 Roadtrips
Die Reise hat meinen Mann und mich von Edinburgh in den Westen Schottlands und dann ganz in den Norden geführt, nun sind wir fast am Ende der Tour in Inverness und Edinburgh. Ein Roadtrip auf der fantastischen North 500 in Nord-Schottland. (To the English blog.)
Dieser Beitrag enthält unbezahlte Werbung und Affiliate Links
In Fortrose
Wir kommen am späten Nachmittag in dem uns bereits bekannten B & B Water´s Edge in Fortrose an. Das ist ein kleiner Ort am Moray Firth, einem tiefen Einschnitt der Nordsee in das Land, fast wie ein Fjord.
B & B Water´s Edge in Fortrose, Zimmer 3
Gill und Bill freuen sich, dass wir ihr B & B wieder ausgewählt haben und bereiten uns einen wirklich herzlichen Empfang. Die Zimmer sind immer noch so schön und bequem wie damals, ausgestattet mit allem, was der müde Reisende benötigt. Einschließlich einer Nespresso Maschine und leckeren Keksen, Schirmen, wenn´s mal wieder nass von oben kommt und einem Fernglas, um die fantastische Aussicht auf den Firth zu genießen.
die Bar im „The Anderson“
Wir haben aber erstmal Hunger und freuen uns wieder auf das leckere Pubessen im „The Anderson“. Hier ist nicht nur das Essen unglaublich gut, sondern auch die Auswahl an Bier-und Whiskey-Sorten ist riesig. Wer hier nichts findet, hat wirklich selber schuld!
Ruinen in Fortrose
Nach einem opulenten und frisch gekochten Frühstück unserer Wirtsleute und einem anregenden Gespräch mit weiteren Gästen, wollen wir Inverness erkunden. Nach einem Blick auf den Tidenkalender sehen wir aber, dass die Flut jetzt langsam aufläuft und damit ist die Wahrscheinlichkeit die hier lebenden Delfine, Große Tümmler sind es, zu beobachten.
die Tümmler am Chanonry Point, im Hintergrund Fort George
die Tümmler vor Fort George
Also fahren wir zum Chanonry Point, einer Landspitze, die recht weit in den Moray Firth hinein reicht. Gegenüber liegt Fort George und hier jagen die Delfine gern die Fische, die durch die Flut mit in den Firth geschwemmt werden.
der Leuchtturm am Chanonry Point
Kaum sind wir am Leuchtturm angekommen, sehen wir auch die ersten. Gar nicht weit vom Strand entfernt. Ich freue mich, dass ich mein Fernglas dabei habe. Über eine Stunde stehen wir im kalten Wind und beobachten die jagenden Delfine! Dann wollen wir doch mal nach
Inverness
Wir parken recht zentral in der Nähe des Bahnhofs. Von hier aus laufen wir ein bisschen durch die Stadt, am Inverness Castle vorbei, dass sich über dem Fluss Ness erhebt.
Blick auf Inverness
Leider ist es nicht zugänglich, bzw. man kann nur den Turm besteigen, da es ein Gericht ist. Wir laufen ein bisschen am schnell fließenden Ness entlang, über diese und jene Brücke und quer durch die Fußgängerzone. Da es jetzt recht warm ist, entschließen wir uns ganz spontan, Fort George noch einen Besuch abzustatten.
Fort George
ist eine Kaserne in Betrieb, aber trotzdem für den Publikumsverkehr zugänglich. Mit einem Audiosystem ausgestattet treten wir über den tiefen Graben durch das Tor und sofort fühlen wir uns um viele Jahre zurück versetzt. Viele Räume sind noch wie im Originalzustand und vermitteln eindringlich, wie Soldaten im 18. Jahrhundert gelebt haben. Von der hohen Verteidigungsmauer können wir sogar wieder Delfine beobachten.
ein Museumsraum in Fort George
Auf nach Edinburgh
Auf dem Weg nach Edinburgh machen wir noch einen Abstecher nach Balmoral Castle, das ich mir viel größer und imposanter vorgestellt habe. Leider gießt es, so dass wir pitschnass durch den wirklich toll angelegten Garten laufen und uns kurz in der großen Halle, dem einzig zugänglichen Raum im Schloss, aufwärmen.
Balmoral Castle
Endlich kommen wir in Edinburgh an und wir sind heilfroh, dass wir ein Navi haben. Hier gibt es so viele Einbahnstraßen und leider auch viele Baustellen, so dass wir einige Umwege fahren müssen. Unser B & B ist hier das Sonas Guest House, das in einer Wohngegend liegt, aber einen guten Busanschluss in die Stadt hat.
Es ist sauber und ordentlich hier, das Wlan funktioniert und das Frühstück wird frisch für jeden Gast zubereitet. Die Gastgeber ist sehr freundlich und geben gern Auskunft, wo es leckeres Essen gibt usw.
Wir reservieren noch schnell einen Tisch im Salisbury Arms, einem Pub mit Restaurant. Wir sind so begeistert, dass wir noch schnell einen Tisch für den nächsten Abend reservieren. Ohne Reservierung bekommt man hier kaum einen Tisch, dass es hier einen super Service und tolles Essen zu vernünftigen Preisen gibt, hat sich wohl herum gesprochen.
Palace of Holyrood House
Es ist der Geburtstag meines Mannes, also darf er heute bestimmen, was wir machen. Mit dem Bus fahren wir in das Stadtzentrum und laufen dann einen kurzen Weg zum Palace of Holyroodhouse, dem offiziellen Zuhause der Queen in Schottland. Hier wird die schottische Geschichte eindrucksvoll erzählt, der Rundgang durch das Schloss gibt Einblicke in das Leben der Royals. Auch Bonnie Prince Charles hat während des Aufstands 1745 kurz hier gelebt.
die Ruinen von Holyrood Abbey
Die Residenz liegt gegenüber des Schottischen Parlaments, einem hochmodernen Gebäude, im Hintergrund sehe ich Menschen auf die umliegenden Berge steigen, um einen besseren Überblick über die Stadt zu bekommen.
Mit den anderen Touristenmassen schieben wir uns die Royal Mile hügelan. Gefühlt kommen wir an 1000 Souvenirläden vorbei, wobei der eine oder andere wirklich interessante Sachen bietet.
ein schönes Haus an der Royal Mile
Wir wollen nun Edinburgh Castle besichtigen, das am anderen Ende der Royal Mile liegt. Die Schlange an den Schaltern ist erlenlang, so dass wir uns kurz entschlossen im Internet eine Karte besorgen mit einer fixen Eintrittsuhrzeit. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, so dass wir an den Aufbauarbeiten des Edinburgh Military Tattoos entlang den Hügel wieder abwärts gehen. Das Tattoo findet jedes Jahr direkt vor den Castle statt, riesige Tribünen werden aufgebaut. Können dann noch mehr Touristen durch die Straßen strömen als jetzt schon? Kaum vorstellbar.
Blick von Edinburgh Castle über die Stadt
Am Grassmarket vorbei biegen wir in die King´s Stables Road ein, um zu den Princes Street Gardens zu kommen, die direkt unterhalb der Burg liegen und von vielen als kleines Naherholungsgebiet genutzt werden. Auf einer Parkbank in der Sonne ruhen wir uns auch ein wenig aus, denn gleich müssen wir uns den Burgberg natürlich wieder hinauf quälen.
Im Edinburgh Castle
angekommen, können wir mit unseren Tickets gleich an den Schlangen vorbei und hinein gehen.
Edinburgh Castle
Das Audio-System sparen wir uns. Überall ist alles gut ausgeschildert. Von der Burgmauer aus haben wir einen fantastischen Blick über die Stadt, in den einzelnen Räumen wird viel zur (kriegerischen) schottischen Geschichte erzählt. Auch durch das düstere Gefängnis gehen wir. Gut, dass hier niemand mehr eingesperrt wird. Im Burgcafé gönnen wir uns einen Scone mit Tee und genießen den Blick zum Hafen.
Trotzdem lockt mich noch die Princes Street mit den vielen Läden. Also gehen wir wieder bergab und lassen uns ein wenig von dem überwältigenden Angebot an Waren inspirieren, ehe wir mit dem Bus zurück fahren.
eine alte Mall in Inverness
Hier endet mein Roadtrip durch das nördliche Schottland. Leider… Nach Edinburgh und Schottland kommen wir wieder! Wer auch über die anderen Teilstücke unserer Reise auf der North 500 lesen möchte, findet sie hier, hier und hier
Ich freue mich auf eure Kommentare und Likes, hier oder auf Tripadvisor, Instagram, Facebook oder Pinterest.
Schottland: Edinburgh und Inverness was originally published on Gabriela auf Reisen - Reiseblog und Reisetipps
#Balmoral#Edinburgh#Edinburgh Castle#Große Tümmler#Holyroodhouse#Inverness#Moray Firth#Schottland#Waters Edge
0 notes